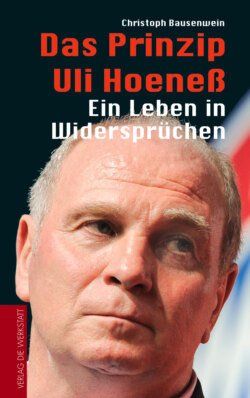Читать книгу Das Prinzip Uli Hoeneß - Christoph Bausenwein - Страница 8
ОглавлениеKAPITEL 2
Der umtriebige Macher
Uli Hoeneß und seine zahllosen Geschäfte
Der Aufstieg des Uli Hoeneß zum Fußballstar war erstaunlich, aber nicht beispiellos. Der kleine Bub aus der Ulmer Metzgerei musste sich enorm anstrengen, um nach oben zu kommen. Aber so wie er haben auch die anderen Bayern-Größen, die ebenfalls allesamt aus einfachen Verhältnissen stammten, für ihren Aufstieg gekämpft. Der Vater von Franz Beckenbauer war Postbeamter, Karl-Heinz Rummenigge kam aus einer Werkzeugmacher-Familie, Sepp Maier war Maschinenschlosser, Gerd Müller hatte den Beruf des Webers erlernt. Alle nutzten sie die Chance, die ihnen der Fußball bot. Und alle waren sie dankbar. So wie Uli Hoeneß. »Dass es so gekommen ist«, kommentierte er seinen Weg auf den Gipfel des Erfolges, »erfüllt mich bis heute mit tiefer Demut.«
Anders als seine Mannschaftskameraden wollte sich Uli Hoeneß allerdings nicht mit einer Karriere als Fußballspieler begnügen. Will man Parallelen zum Werdegang des Bayern-Managers finden, so muss man über den Tellerrand des Fußballs hinausschauen.
Uli Hoeneß hat seinen eigenen Lebensweg öfter mit dem von Erfolgsmenschen aus der Politik verglichen. Insbesondere mit Metzgersöhnen wie Franz-Josef Strauß und Joschka Fischer. Ein Strauß-Freund war er schon in jungen Jahren, aber auch mit dem einstigen Frontmann der Grünen, der es vom Taxifahrer bis zum Außenminister und beliebtesten Politiker Deutschlands gebracht hatte, habe er sich »immer prima verstanden«. Obwohl Fischer das aus seiner Sicht falsche Parteibuch besaß, war er ein großer Freund von ihm. »Ich liebe Menschen, die genau wissen, dass man ohne Arbeit keinen Erfolg hat«, begründete er seine Sympathie. »Der Beruf der Eltern ist sicher kein Garant, aber was man diesen Leuten ansieht, ist mit Sicherheit Ehrgeiz, Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit. Das sind Werte, die dir mitgegeben werden und die auch heute Gültigkeit haben.« Er selbst, so Hoeneß weiter, habe zu Hause gelernt, Leistung anzuerkennen und einzufordern, aber auch etwas dafür zu geben und dabei bodenständig zu denken. Gerade in der heutigen Zeit sei es gar nicht schlecht, wenn in verantwortungsvollen Positionen Menschen aus einfachen Verhältnissen sitzen. Menschen, die nicht vergessen hätten, woher sie kommen. Und so könnte wohl, nimmt man Hoeneß beim Wort, sein eigener Lebensweg immer noch als Vorbild für künftige Macher in Politik und Wirtschaft gelten.
Ein »Gscheitle« mit Geldinstinkt
Typisch für Uli Hoeneß ist es, wie er die Geschichte von seinem ersten sportlichen Erfolg als Sechsjähriger erzählte: »Ein Sieg, ich schoss mein erstes Tor – und mein Onkel stiftete die erste Prämie meines Lebens: Er steckte zehn Mark in mein Sparschwein.« Andere hätten diese »Prämie« vielleicht vergessen, für ihn aber war sie genauso erwähnenswert wie das Tor.
Das Geld spielte ein große Rolle in dem grau verputzten, schlichten Haus Am Eselsberg 1, wo die Familie Hoeneß lebte und arbeitete. Als Kind ist Uli Hoeneß im elterlichen Geschäft mit dem ganzen Ernst des mittelständischen Berufslebens konfrontiert worden. Vater Erwin war Metzger mit Leib und Seele, stand ab morgens um drei bis spätabends in der Wurstküche, Mutter Paula hat im Laden verkauft, am Wochenende die Buchhaltung gemacht und zwischendurch die Kinder großgezogen. »Unser ganzes Leben war auf den Betrieb abgestimmt«, erzählte Sohn Uli. »Ich war schon immer kaufmännisch orientiert und habe samstags, wenn keine Schule war, hinter der Kasse gestanden. Ich wusste genau, was eine Lyonerwurst kostet.« Während der Fußball trotz allen Ehrgeizes vor allem auch eine Lust blieb, wurde ihm der Umgang mit Geld, der ihn schon immer faszinierte, geradezu zu einer Sucht. Hinter der Kasse zu stehen, gestand Hoeneß, »war meine Leidenschaft, und das scheint mich bis heute geprägt zu haben«. Fiel beim Kassieren ein Geldstück durch den Holzrost am Boden, so eine oft zitierte Geschichte, musste Uli nach Ladenschluss so lange danach suchen, bis die Tagesbilanz des kleinen Handwerksbetriebs wieder stimmte. »Ich sehe nicht ein«, sagte er noch Jahrzehnte später, »dass man zehn Cent irgendwo liegen lässt, nur weil sie verdreckt sind.«
Im Gegensatz zu ihm habe sein Bruder Dieter nie in der Metzgerei geholfen. »Dieter war eher der Künstler, der gemalt hat.« Ja, bestätigte Mutter Paula, »Dieter war ein Rechengenie und musisch begabt. Er konnte besser malen und singen als Uli.« Uli dagegen war das »Cleverle« von den beiden und besaß das größere Durchsetzungsvermögen. Uli hatte auch schon früh eigene Geschäftsideen. »Einmal zogen Uli und ich mit Hammer, Meißel und Schubkarre los«, erzählte Dieter. »Wir bauten Quarzsteine ab und dachten, eine Fensterfirma würde sie uns abkaufen.« Tatsächlich wurden sie die Steine los: Mutter Paula hatte den Leuten von der Fensterfirma Geld gegeben und sie gebeten, zum Schein auf den Deal einzugehen, um die Jungen nicht zu enttäuschen. Als die Eltern dann ihre Kinder irgendwann über den wahren Sachverhalt aufgeklärt hatten, wurde der Satz: »Verkauft ihr wieder Steine?«, zu einem Running Gag in der Familie.
Die typischste Hoeneß-Jugendgeschichte ist aber wohl nicht die Sache mit den Steinen, sondern die, in der es um einen besonders tollen Ball geht, der bei »Sport Sohn« in Ulm im Schaufenster lag. Er war nicht braun wie die gewöhnlichen Bälle, sondern schwarz-weiß. Es war ein sogenannter Flutlichtball, und er kostete die stattliche Summe von 34 Mark. In den Ferien arbeitete der Dreizehnjährige vier Wochen lang bei der Lebensmittelfirma Gaissmaier als Beifahrer, um das Geld aufbringen zu können. Nach der Arbeit fuhr er jeden Tag mit dem Fahrrad zu dem Sportgeschäft, um zu sehen, ob der Ball noch da war. Und als er dann das Geld zusammenhatte, kaufte er sich das begehrte Objekt und war fortan der König. Denn wenn er mit dem Flutlichtball auf die Spielwiese kam, konnte er jetzt sagen: »Du darfst mitspielen, du darfst mitspielen – und du nicht.« So war aus dem kleinen Hoeneß, der sich gegen die Größeren immer hatte durchboxen müssen, plötzlich der Bestimmer geworden, der alle, die ihm nicht passten, auf die Ersatzbank verbannen konnte. Da war wohl schon angelegt, dass er einmal mehr werden wollte als nur ein Fußballspieler – nämlich einer, der die Spielbedingungen dirigieren kann.
Bei der Sache mit dem Flutlichtball von »Sport Sohn« hatte der kleine Uli gelernt, dass eine besondere Anstrengung auch einen besonderen Lohn nach sich zieht. Das Vorbild der Eltern allerdings war gerade in dieser Hinsicht irgendwann nicht mehr sonderlich überzeugend. »Die Eltern haben uns Kinder das Arbeiten gelehrt und dass man nur durch Leistung nach oben kommt«, so Hoeneß. Das Problem dabei war nur, dass die Eltern ja selbst nie so richtig nach oben kommen wollten. Man lebte sehr bescheiden, konnte sich nie viel leisten. In seiner Kindheit sei es schon das »Allergrößte« gewesen, wenn die Eltern mit den Kindern für eine Woche zum Zelten nach Italien gefahren sind. Im Wesentlichen bestand das Leben der Familie aus Arbeit. Aus sehr viel Arbeit. Und die Arbeit in der Metzgerei war äußerst anstrengend, insbesondere an Weihnachten. »Da wurde gearbeitet, bis die letzte Gans verkauft war. Am Heiligabend um zehn Uhr waren wir dann alle tot. Wir konnten gerade noch etwas Anständiges essen, dann sind wir ins Bett gefallen.«
Die oft recht bedrückende Stimmung zur Weihnachtszeit hatte aber nicht nur etwas mit den Anstrengungen zu tun. Denn sie war immer davon abhängig, wie das Geschäftsjahr gelaufen war; und das war häufig schlechter gelaufen als erhofft. »Wenn man an einem Samstag mal nur 1.200 statt 1.500 Mark umgesetzt hat, hieß es gleich: Was ist da los? Hat die Schinkenwurst nicht gepasst? Im Sommer haben wir manchmal Sportfeste beliefert. Da hat mein Vater die ganze Nacht Wiener und Bratwürste gemacht. Und dann hat’s geregnet – ein Drama.« Die Konsequenz des Sohnes lautete: »So wollte ich es später nie haben. Ich war bereit, hart zu arbeiten, aber ich wollte die Sonntage sorgenfrei verbringen können.« So viel wie der Vater zu arbeiten, von drei Uhr morgens bis spätabends, dabei nur wenig Geld erwirtschaften und dann auch noch Existenzängste ausstehen müssen – was das heißt, so Hoeneß, habe er nie vergessen. Für ihn war klar, dass Aufwand und Ertrag in einem anderen Verhältnis stehen müssen als im Berufsleben seines Vaters.
In einem aber waren und blieben die Eltern Vorbild: in der Vorsicht, das Geld zusammenzuhalten. Im Haus von Erwin und Paula Hoeneß wurde nie mehr Geld ausgegeben, als da war, Schuldenmachen war verpönt. Sohn Uli hielt sich an das elterliche Gebot, und der Gedanke an eine Kreditaufnahme sollte ihm auch in seinen späteren Jahren als Bayern-Manager stets zuwider bleiben. »Das ist eine rein menschliche Sache«, begründete er diese schwäbische Bedachtsamkeit. »Manche können mit Schulden leben und sind bereit, gewisse Risiken einzugehen. Meine Sache ist das nicht. Ich habe noch nie Schulden gemacht, auch im Privaten nicht.« Insofern ist es wohl kein Zufall, dass er seinen ersten großen geschäftlichen Erfolg als »Schuldenvernichter« feierte: Als Schulsprecher des Schubart-Gymnasiums sanierte er die defizitäre Schülerzeitung. Der Chefredakteur war ein guter Schreiber, aber ein Chaot. Also ließ Hoeneß ihn schreiben, während er sich um die Geldbeschaffung kümmerte. Und bald hatte er so viele Anzeigenkunden für die »Schubart-Chronik« geworben, dass alle finanziellen Sorgen der Vergangenheit angehörten. »Plötzlich hatten wir einen Überschuss«, berichtete Uli Hoeneß stolz, »und mit dem haben wir jedes Jahr ein Riesenschulfest für 2.000 Leute veranstaltet.« Geradezu »legendär« seien diese Schulfeste in seiner »Ägide« gewesen, schwärmte noch der Fünfzigjährige: »Höhepunkte in Ulms Kulturleben.« Alle seien begeistert gewesen, vor allem seine Kumpels, die als Ordner arbeiteten und dafür Freibier erhielten. »Einer hat 25 Halbe geschafft an einem Tag.«
Der Macher selbst langte beim Bier weniger hin und erfreute sich vielmehr an einem anderen angenehmen Nebeneffekt seiner Tätigkeit. Zur Professionalisierung der Schülerzeitung hatte er eine Kooperation mit einer Mädchen-Realschule initiiert und dabei ein nettes Mädchen kennen gelernt, das dort Schulsprecherin war. »Wir waren ein erfolgreiches Gespann und hatten tollen Erfolg bei den Geschäftsleuten, die wir zusammen abklapperten«, erinnerte sich die spätere Susi Hoeneß und war voller Stolz auf ihren Uli, der sich geradezu als Werbegenie erwies. »Ihm fiel immer wieder etwas Neues ein, wenn es darum ging, die Zeitung zu finanzieren.« Auch der Geldeintreiber vom Schubart-Gymnasium war zufrieden mit sich und genoss die Anerkennung, die er sich erarbeitet hatte. Ein Klassenkamerad charakterisierte seinen Mitschüler mit den Worten: »Hoeneß hat immer Sachen für die Allgemeinheit getan. Aber ihm war auch klar, dass er sich damit eine gewisse Position verschaffen konnte.« Der junge Uli Hoeneß war ein psychisch Frühreifer und das, was man im Schwabenland ein »Gscheitle« nennt. Im Prinzip immer redlich, mitunter schlitzohrig, vor allem aber äußerst ehrgeizig und stets etwas vorlaut eine geistige Überlegenheit herauskehrend.
Der Fußball blieb freilich weiterhin die Hauptsache im Leben des Uli Hoeneß. Bereits als Siebzehnjähriger war der angehende Fußballstar Thema einer Sendung im Südfunk-Fernsehen. Der Film zeigt den stets mit guten Noten glänzenden Vorzeigeschüler beim Unterricht im Schubart-Gymnasium, bei einer Sitzung des Schülerrates, dessen Vorsitzender er war, bei einem Fußballspiel im Ulmer Stadion zwischen einer Auswahl des Schubart-Gymnasiums und des Gymnasiums Ellwangen, das die Ulmer mit Hilfe zweier Hoeneß-Tore 4:2 gewannen, beim Training mit Ulm 1846, beim konzentrierten Erledigen der Hausaufgaben, schließlich beim Tennisspielen. Er erschien wie ein Tausendsassa, dem man alles zutrauen konnte.
Eine leichte Trübung dieses Bildes gab es erst, als er sich nach dem Abitur – da hatte er bereits einen Vertrag bei den Bayern – zum Studium der Betriebswirtschaft an der Maximilians-Universität in München anmelden wollte. Da er aus Baden-Württemberg kam, wurde ihm der Numerus Clausus zum Verhängnis. Der lag bei 3,0 und war eigentlich keine große Hürde, aber als Nicht-Bayer bekam er einen Malus von einer ganzen Note – und so wurde aus seiner Abi-Durchschnittsnote von 2,4 eine 3,4. An die große Glocke gehängt hat er das damals nicht, und vermutlich hielt sich eben deswegen in der Sportpresse noch lange Zeit die Auffassung, er sei ein Einser-Abiturient gewesen. Anfangs sei er sehr ehrgeizig und oft Klassenbester gewesen – im Gegensatz zum Bruder Dieter, der einmal eine Ehrenrunde hatte drehen müssen. Uli hatte erst im Alter von etwa 15 Jahren etwas nachgelassen, als der Fußball immer wichtiger geworden war. Immerhin sei sein Notendurchschnitt aber ganz beachtlich gewesen, betonte er, zumal er im letzten Schuljahr wegen des Fußballs 50 Tage gefehlt habe.
Uli Hoeneß schrieb sich für ein Lehramtsstudium in Anglistik und Geschichte ein. Mit einer allzu großen Überzeugung stand er nicht dahinter, er tat es wohl vor allem seiner Mutter Paula zuliebe, die ihn gerne als Lehrer gesehen hätte und besonders stolz auf die Schulpreise war, die er in den Sprachen abgeräumt hatte. Die Eltern, so Hoeneß, hätten immer größten Wert auf eine solide Ausbildung gelegt. Vor allem die Mutter, die in der Familie die starke Person gewesen sei, habe sich auf Fußball nie verlassen. »Sie hat viel mehr Wert darauf gelegt, dass wir das Abitur machten. Eine Karriere als Fußballer war ja längst nicht das wie heute. Es war gar nicht im Bereich des Vorstellbaren.«
Die Mutter bestand auch darauf, dass die Söhne nach dem Abitur an die Uni gingen, damit aus ihnen »was G’scheit’s« werde. So nahmen beide Söhne ein Lehramtsstudium auf, wobei Uli weniger Kondition bewies. Zwei Jahre später war dem zum Nationalspieler avancierten Profi das Nebeneinander von Studium und Fußball zu viel geworden, und er konzentrierte sich, trotz der Skepsis der Mutter, voll auf seine sportliche Karriere. Paula Hoeneß verließen ihre Zweifel auch nicht, als er auf den Managerposten gewechselt war und nun das Kaufmännische im Vordergrund stand. »Nach jeder Niederlage fürchtete sie, ich werde entlassen«, berichtete er über ihre Existenzängste. Irritieren ließ sich der Sohn davon aber nicht, und er war froh darüber. »Ohne Fußball wäre ich wohl in der Provinz der Stadt Ulm untergegangen. Ich wäre vielleicht Lehrer.« Überhaupt hatte Uli Hoeneß vor den Studierten wie vor dem Studium als solchen nicht allzu viel Respekt. »Wenn ich Mathematikprofessor oder Physiker werden will, brauche ich ein Studium«, meinte er. »Aber um einen kaufmännischen Beruf auszuüben, in dem jeden Tag etwas Neues passiert, muss ich nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag studieren.« Der stets am realen Geschehen orientierte Tatmensch fand seine Lebensmaximen nicht im Pauken trockenen Bücherstoffes, sondern in der täglichen Praxis des »learning by doing«.
Auf jedem Gebiet allerdings funktionierte das Prinzip des »Lernens durch Handeln« nicht. Der Schüler Hoeneß lag wohl ganz richtig, als er bei der Schülerzeitung nicht die Stelle des Chefredakteurs anstrebte, denn der Versuch, sich selbst als Hobby-Journalist bei der »Südwest Presse« zu profilieren, endete wenig glücklich. Am 4. November 1972 erschien seine erste Kolumne in der Ulmer Heimatzeitung mit dem Titel: »Das meine ich«. Pro Artikel erhielt der Nachwuchsstar des FC Bayern, der in der Schule stets gut benotete Deutschaufsätze abgeliefert hatte, 150 DM. Die Serie erschien mit einem Foto des Autors, das ihn hinter einer Schreibmaschine sitzend zeigt, den Kopf im Denkergestus auf die Hand gestützt. Er nutzte den Raum vorwiegend zur Selbstdarstellung und zu recht belanglosen Betrachtungen. Einen Blick hinter die Kulissen des FC Bayern, den sich die Blattmacher eigentlich versprochen hatten, gewährte er nicht. Und so wurde die Kolumne schon bald ersatzlos gestrichen.
Der Zimmergenosse und Geschäftspartner
»Uli Hoeneß und ich haben uns 1967 bei einem Turnier der süddeutschen Jugendauswahl kennen gelernt«, berichtete Paul Breitner über den Beginn einer langjährigen Freundschaft. Die beiden Fünfzehnjährigen waren damals auf ein Zimmer gelegt worden. Kurz darauf trafen sie sich in der deutschen Jugendnationalmannschaft wieder, und als sie gleichzeitig beim FC Bayern anheuerten, waren sie erneut beisammen. In München bewohnten die beiden ein gemeinsames Appartement in Trudering, bei Trainingslagern und Auswärtsspielen schliefen sie in einem Doppelbett. Das Verhältnis war eng zwischen den beiden, sehr eng. So eng, dass sie schon bald als »siamesische Zwillinge« bezeichnet wurden. »Jeder kannte von dem anderen alles«, so Breitner. »Es war so, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt haben: Es ist eigentlich egal, wer ans Telefon geht, wenn’s läutet. Weil: Beide wissen sowieso, worum’s geht, beide können für den anderen antworten.«
Das unzertrennliche Pärchen hielt in allen Lebenslagen zusammen. Als Breitner zum 1. Oktober 1970 zur Bundeswehr einrücken sollte, weigerte er sich, dem Einberufungsbefehl Folge zu leisten, und schlich sich, als die Feldjäger vor der Haustür standen, in den Kohlenkeller. Sein Mitbewohner wimmelte die Häscher ab und erfand dabei die fantasievollsten Ausreden. Elf Tage hielt Breitner als »Kellerkind« durch, dann meldete sich der Bayern-Präsident Wilhelm Neudecker und redete ihm ins Gewissen: Die Gefahr, dass man ihn auf dem von sensationslüsternen Journalisten umlagerten Trainingsplatz verhafte, wachse von Tag zu Tag. Breitner gab schließlich auf und versuchte unter Verweis auf seine Wirbelsäulenbeschwerden bei der Bundeswehr den Kranken zu spielen – vergeblich. Während seines Wehrdienstes geriet er völlig außer Form und wurde umso übellauniger, je erfolgreicher sein Wohnungspartner währenddessen seine Karriere vorantrieb. Immer häufiger krachte es zwischen den beiden Freunden. Vielleicht zwickte den nörglerischen Breitner neben seiner frustrierenden Situation zudem ein wenig der Neid, dass Hoeneß immer einen Tick schlauer war als er. So auch in Sachen Bundeswehr. Mit der Begründung, dass er Probleme mit dem Knie habe und ihm das Tragen eines Helmes Schmerzen im Kopf verursache, hatte es Hoeneß tatsächlich geschafft, untauglich geschrieben zu werden.
Als Typen waren die zwei Freunde sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite der schwäbische Modellathlet, der sehr viel Wert legte auf ein gepflegtes Äußeres. Er sei nicht nur hoffnungslos ehrgeizig, erläuterte der junge Hoeneß, sondern auch eitel. Seinem damals noch wallenden blonden Haar widmete er allergrößte Aufmerksamkeit; er wusch es täglich und brachte es mit einem überdimensionalen Fön in Form. Zimmergenosse Paul Breitner wunderte sich und machte seine Witze über diesen »Foeneß«. Er selbst wirkte wie das Gegenmodell zu diesem Strahlemann: Bärtig, die dunklen Haare im Afrolook, stets mürrisch und überkritisch, umgab den Pädagogikstudenten aus Freilassing die Aura eines linken Revoluzzers. Der »rote Paul«, wie Breitner bald von den Medien getauft wurde, ließ sich mit der kommunistischen »Peking Rundschau« vor einem Mao-Poster ablichten und erklärte eine Niederlage der Amerikaner in Vietnam zu seinem größten Wunsch. Der stockkonservative Präsident Neudecker wunderte sich über den seltsamen Sozialisten Breitner. »Der gibt sich sozialistisch und verdient mehr als zehn Arbeiter zusammen.« Als der FC Bayern im September 1971 zum Europapokalspiel gegen den tschechoslowakischen Vertreter Skoda Pilsen reiste, schlug der tiefschwarze CSUler dem »Revoluzzer« vor, den Mannschaftsbus zu verlassen, um in den »Sozialismus« überzusiedeln. Breitner blieb natürlich dort, wo es bequemer war und wo es mehr Geld gab. Viel mehr Geld. Geld, das er zu einem großen Teil nicht zuletzt den Aktivitäten seines Partners Hoeneß zu verdanken hatte, der ihn immer wieder an seinen Geschäften beteiligte.
Hinter dem »Parade-Linken« Breitner stand freilich nicht viel linke Substanz. »Ich kam in einer Phase nach München, in der in ganz Deutschland jeder, der jung war und sich zu irgendwas Politischem geäußert hat, ein Linker war«, erklärte er im Jahr 1982 gegenüber der Zeitschrift »Konkret« die Hintergründe seines Images. »Ich habe damals in einem Interview auf die Frage, was ich denn lese, gesagt, dass ich mich für Jerry Cotton und Western interessiere. Und als die fragten: Was haben Sie denn dabei, habe ich geantwortet: Irgendwelche Bücher und Psychologie und wahrscheinlich auch den Lenin oder so. Aha, auf Wiederschaun, am nächsten Tag war ich der Rote, der Linke.« Der CSU-Wähler Hoeneß indes empfand sich ebenfalls als Teil der 68er-Generation, jener Generation also, die sich gegen das Establishment und verkrustete Hierarchien auflehnte. »68er« könne man auch sein, meinte er, ohne zugleich ein »Linker« werden zu müssen. Er verstand sich als Modernisierer und sah keinen Widerspruch darin, einerseits die alten Strukturen aufzubrechen und andererseits als bekennender Anhänger von Franz-Josef Strauß die CSU zu wählen. Neu und modern war zudem seine Interpretation des Profidaseins und vor allem die Art, wie er seine Position selbstbewusst und selbstbestimmt zum Geldverdienen nutzte.
Breitner bewunderte die enorme Geschäftstüchtigkeit seines Zimmergenossen. »Als ich den Uli kennen gelernt hab’ mit 16, 17, 18 Jahren, war er schon so viel Geschäftsmann, wie andere mit 40 oder 45 sind«, meinte er bewundernd. Überall, wo er ging und stand, witterte er etwas, was sich in Geld umsetzen ließ. »Er macht noch mit ausgegangenen Haaren Geld«, witzelte Breitner voller Anerkennung für seinen permanent neue Geschäftsideen entwickelnden Kompagnon und freute sich, dass er von der Umtriebigkeit des Freundes profitieren konnte. Ohne Hoeneß, bekannte er, würde er außerhalb des Fußballs keine Mark verdienen. Anders als andere Profis, die zu ihrer Vermarktung einen eigenen Manager benötigten, schloss Hoeneß – »ehrgeizig, gierig, unersättlich«, so der Autor Roderich Menzel im Jahr 1981 – alle seine Verträge selbst ab. »Wozu Geld für Provisionen hinauswerfen?«, meinte er. »Das mach’ ich selber am besten!« Und so handelte er respektable Honorare für Autogrammstunden aus, schloss Werbeverträge mit »Wienerwald« und »Kaufhof«, mit einer Margarinemarke und einer Bank ab, warb für Eiscreme und posierte neben seinem Kumpel Breitner – und mit respektablem Waschbrett-Bauch – als Modell für Unterhosen.
Der zentrale Antrieb für Hoeneß’ enorme Umtriebigkeit lag wohl nicht nur in einer schier unersättlichen Gier; man kann sein Verhalten sicher auch als Versuch interpetieren, die von den Eltern vorgelebten Existenzängste zu besiegen. Wie ausgeprägt die waren, wird unter anderem durch den Umstand belegt, dass die Eltern bis zu ihrem Tod Geld für die Absicherung ihrer Söhne zurücklegten, trotz deren Millionenverdienstes. »Als meine Eltern gestorben waren«, äußerte ein beschämter Uli Hoeneß, »war ich schockiert, wie viel sie uns hinterlassen hatten. Sie hatten sich offenbar teilweise für uns den Urlaub gespart.«
Der Uli, die Susi und der Franz-Josef
Trotz aller Gemeinsamkeiten gab es in der »Männerehe« Breitner und Hoeneß aber auch anhaltende Turbulenzen. Man saß einfach zu eng aufeinander. Beide waren fest liiert, der Uli mit seiner Susi und der Paul mit seiner Hildegard, und vor allem am Wochenende, wenn die jungen Pärchen Zeit füreinander hatten, wurde es schwierig. Man vereinbarte zwar einen Terminplan, wer an welchen Wochenenden Alleinherrscher über das Appartement sein durfte, aber der wurde meist durch irgendetwas Unvorhergesehenes über den Haufen geworfen. Auch als sich das Wochenendproblem nach Breitners Heirat und dessen Auszug aus der gemeinsamen Wohnung gelöst hatte, verbrachten die beiden, die ja meist fünf Tage in der Woche unterwegs waren, immer noch mehr Zeit miteinander als mit ihren Partnerinnen. Es war ein Zusammenleben, meinte Breitner, fast so eng wie bei einem alten Ehepaar.
Uli Hoeneß entschloss sich im Herbst 1973, mit seiner Jugendfreundin Susanne den Bund fürs Leben zu schließen. Und er verband diesen Entschluss, wie bei ihm eigentlich nicht anders zu erwarten, mit einer Geschäftsidee. Auch dieses private Ereignis lasse sich schließlich vermarkten, meinte der Bräutigam, und bot über eine Werbeagentur die Exklusivrechte für Interviews und Fotos an. 25.000 DM sollte der Spaß kosten, doch diesmal hatte der nimmersatte Geldscheffler Pech: Niemand griff zu, stattdessen gab es allenthalben spöttische Reaktionen. Die »Sport-Illustrierte« druckte eine Fotomontage, die Uli Hoeneß mit seiner Braut zeigt, wie er ihr einen Ehering überstreift. Bildunterschrift: »Dieses Bild kostete genau 177,30 Mark, 150 Mark Honorar für den Fotografen und 27,30 Mark für die Fotomontage.« Würde dieses Foto zum tatsächlichen Hochzeitstermin gemacht, so der Artikel weiter, dann wäre »es allerdings 24.822,70 Mark teurer«. Zum Trauungstermin am 18. November waren schließlich etliche Fotografen und Journalisten da, doch keiner hatte ein Honorar entrichtet. Die Braut, der die Sache hernach etwas peinlich war, versuchte sich zu rechtfertigen: »Wir sind mit einem Werbeagentur-Besitzer aus Winnenden befreundet, und einer seiner Angestellten hat aus lauter Übereifer heraus derartige Angebote an verschiedene Illustrierten gerichtet – ohne unser Wissen! Der Mann wurde dann kurz darauf entlassen.« Der Bräutigam bereute die Sache ebenfalls. Als er im Jahr 2009 zum x-ten Mal auf die Angelegenheit angesprochen wurde, sprach er von einem »Riesenfehler« und davon, dass er damals, in den siebziger Jahren, zu sehr hinter dem Geld her gewesen sei. Angenehm war ihm das Image des Raffkes offensichtlich schon damals nicht, denn er war stets bemüht, sich als ehrlicher Makler der von ihm beworbenen Produkte zu präsentieren. »Die Produkte, die er anpreist, verwendet Uli Hoeneß auch zu Hause«, schrieb etwa die »Abendzeitung« in einem Personality-Artikel. »Er schmiert Rau-Margarine aufs Brot, isst Langnese-Eis zum Nachtisch und hat sein Geld auf einer Raiffeisenbank.«
Die Fotos von der Trauungszeremonie in Rottach-Egern zeigen den Bräutigam im schwarzen Anzug mit Fliege, die Braut im langen, weißen Kleid, ein Myrtenkränzchen im blonden Haar. Eigentlicher Star des Ereignisses war aber nicht das Brautpaar oder der extra engagierte Tölzer Knabenchor, sondern ein spezieller Gast. Die Trauungszeremonie lief bereits, da öffnete sich plötzlich mit lautem Knarren die Tür zur Sakristei, so der Reporter der »Bild am Sonntag«, und die massige Gestalt von Franz-Josef Strauß erschien. »Als der letzte Ton der Orgel verstummt, hat sich der CSU-Vorsitzende Strauß mit einem Gewürzblumenstrauß in der Hand bis zur Höhe des Brautpaares vorgerobbt. Jetzt gratuliert er dem blonden Fußballstar und seiner Frau unter dem Blitzlichtgewitter zahlreicher Fotografen als Erster.«
Uli Hoeneß war glücklich wie selten. Beflügelt von einer Art Hochzeitseuphorie hatte er gegen Dynamo Dresden im Achtelfinale des Europapokals sein bisher bestes Spiel im Bayern-Trikot absolviert, und dann hielt auch noch der von ihm bewunderte Franz-Josef Strauß spontan eine Rede zum Lob der Dame, die er ausgewählt hatte. »Das war nicht so vorgesehen, es war aus dem Stegreif«, kommentierte er das Ereignis. »Alle waren begeistert, auch die, die politisch nicht seiner Meinung sind.« Er selbst, daran ließ er keinen Zweifel, bekannte sich klar zur damaligen Opposition und ihrem bayerischen Aushängeschild. Er sei zwar kein CSU-Mitglied, wähle diese Partei aber, weil sich in Deutschland einiges ändern müsse und dies nur durch einen Regierungswechsel geschehen könne. Aber sein Faible für Strauß, mit dem er sich ab und an zu einem gemeinsamen Essen traf, hatte auch noch andere Hintergründe. »Ich war eigentlich ein unpolitischer Mensch«, bekannte er einmal. »Aber mein Ziel war klar: Ich wollte nach oben, und da lagen in München Strauß und die CSU natürlich nahe.« Und so wie der CSUAnhänger Hoeneß ein Fan des bayerischen Ministerpräsidenten war, so war das Bayern-Mitglied Strauß ein Fan des aufstrebenen Fußballstars.
Die vertrauliche Nähe zu einem Mann wie Strauß war genau das, was Hoeneß mit seiner Umtriebigkeit hatte erreichen wollen. Das Dasein als Fußball- und Werbestar befriedigte den Anerkennungshunger des ehrgeizigen Aufsteigers nicht wirklich. Er wollte auch den direkten Kontakt zu hochrangigen und mächtigen Leuten. Die wiederum sperrten sich nicht, sondern begrüßten den jungen Mann freudig als Gleichgesinnten. Nicht nur ein Franz-Josef Strauß erkannte in Hoeneß jenen unerbittlichen Ehrgeiz wieder, der ihn selbst groß gemacht hatte. Hoeneß fand auch Aufnahme in einen erlauchten Kreis von Geldleuten, darunter Rudolf Houdek, der Fleischmagnat, Rudolf-August Oetker, der Chef des riesigen Multikonzerns, die Discounter-Könige Albrecht und die schwerreiche Unternehmerfamilie Snoek. »Ich habe eben die richtigen Partner fürs Leben gefunden, und darauf kommt es an«, frohlockte er mit dem Stolz des Metzgersohns, der einen märchenhaften Aufstieg geschafft hatte. Hier, unter diesen Erfolgsmenschen, fühlte er sich zu Hause und am richtigen Platz. Die gewaltigen unternehmerischen Leistungen, die solche Leute vollbracht hatten, inspirierten ihn. Was er noch brauchte, war eine eigene Position, mit der er sich im Kreis dieser Mächtigen würde profilieren können. Nur Fußballspieler zu sein, und sei es mit noch so vielen Werbeverträgen, genügte jedenfalls nicht. Seine Bescheidenheit, die er geradezu demonstrativ zur Schau stellte, war für ihn kein Widerspruch zu seinen Ambitionen. Mit seiner Ehefrau bewohnte er zunächst noch eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in München, den größten Teil seines Verdienstes, etwa vier Fünftel, sparte er an.
Geld allein macht nicht glücklich
Geld verdienen sei nicht das Wichtigste beim Fußball, betonte Hoeneß regelmäßig, wenn er gerade einen großen Erfolg zu feiern hatte. Seine überragende Leistung beim triumphalen 4:0 gegen Atlético Madrid im Europapokal-Finale von 1974, verriet er nach dem Spiel der Münchner »Abendzeitung«, habe rein gar nichts mit den ausgelobten Prämien zu tun. Er sei sich »ganz sicher«, sagte er, »dass die 12.000 Mark, die nach Abzug aller Steuern für jeden von den 30.000 Mark Prämie übrig bleiben, nicht ausschlaggebend waren. Bei allen angenehmen materiellen Begleitumständen meines Berufes waren die Tage von Brüssel ein unvergessliches Erlebnis. Ein Abschnitt in meiner Karriere, den ich nie vergessen werde. Ich hätte weder für mehr noch für weniger Geld in Brüssel besser spielen können.« Das Umrechnen von Brutto auf Netto hatte er über seinem Idealismus freilich doch nicht vergessen.
Ähnlich ambivalent äußerte er sich wenige Wochen später, als es um die Prämien bei der anstehenden WM-Endrunde ging. Nachdem Franz Beckenbauer mit dem DFB in Malente eine Staffelprämie ausgehandelt hatte, von 15.000 DM (für die Teilnahme) bis 60.000 DM (für den WM-Titel), wurde den Nationalspielern umgehend in bissigen Kommentaren unersättliche Profitgier angelastet. Diese erstmalige Auslobung einer Erfolgsprämie sei eine »zukunftsweisende Sache«, meinte Uli Hoeneß, stellte aber zugleich auch fest: »Wir Profis leben zwar vom Fußball, aber wir denken nicht unablässig ans Geld.« Als dann jedoch die Zuschauer in Hamburg beim mäßigen Vorrundenspiel gegen Australien die »geldgierigen Profis« mit einem gellenden Pfeifkonzert bedacht hatten, kam er ins Grübeln. »Stunden später erinnerte mich ein Zeitungsmann, dass ich so ›nebenbei‹ für das Erreichen der zweiten Finalrunde 25.000 DM (brutto) verdient hatte. Geld beruhigt auch Fußballer. Aber – es macht uns allein auch nicht glücklich.«
Hoeneß’ Verhalten vor, während und nach der Weltmeisterschaft war tatsächlich wenig geeignet, den Vorwurf der Geldgier zu entkräften. »Wenn wir Weltmeister werden, haben wir zeitlebens ausgesorgt«, äußerte der Jungprofi, der zu diesem Zeitpunkt bereits einen BMW, einen Porsche Carrera und drei Eigentumswohnungen in Ulm besaß, vor dem Turnierbeginn und sorgte damit für große Aufregung. Und die legte sich natürlich nicht, als er in den ersten Spielen nur bescheidene Leistungen brachte, in seiner Freizeit aber fleißig herumtelefonierte, um irgendwelche Geschäfte am Laufen zu halten. Hoeneß hatte sich nachhaltig unbeliebt gemacht, und daran änderte nicht mehr viel, dass er seine Aktivitäten dann stoppte und nach der WM am Lesertelefon der »Bild« bekannte: »Ich hätte auch ohne Geld gespielt.«
Laut »Stern« verdiente Hoeneß, dessen Jahreseinkommen damals bei rund einer halben Million DM lag, mit seinen Werbeaktivitäten im Umfeld der WM noch einmal so viel. In der »Bild« schrieb er eine kleine Serie, in der er sich selbst ins rechte Licht setzte. Der letzte Absatz der letzten Folge lautete: »Uli Hoeneß, 22, Student und Weltmeister. So begann mein erster Bericht. Dem letzten möchte ich noch ein Detail hinzufügen: Hausbesitzer. Ja, in zwei Wochen ziehe ich in ein eigenes Haus mit Swimmingpool. Ich habe es mir vor der Weltmeisterschaft gekauft – mit 22! Und da sind wir wieder beim Thema: Der Fußball hat es möglich gemacht. Das hört sich großartig an – und auch irgendwie ungerecht (vor allem für einen, der in der Fabrik oder im Büro arbeitet).«
Nun, Hoeneß arbeitete ja ebenfalls unentwegt, wenn auch nicht in der Fabrik und ohne Büro. Beim Vertrieb eines WM-Buches, das er zusammen mit Paul Breitner und Udo Lattek herausgegeben hatte, holte er sich wunde Finger: Jedes Exemplar war nummeriert und von den Autoren signiert. »Zwei- bis zweieinhalbtausend Unterschriften hat er geschafft an einem Abend, während wir den ›Kommissar‹ angeschaut haben«, berichtete sein Zimmergenosse Karl-Heinz Rummenigge, genervt habe es ihn nie, denn für jede Unterschrift bekam er eine D-Mark. Zusätzlich zu dem Honorar von 250.000 DM holte Uli Hoeneß auf diese Weise noch weitere 100.000 DM Unterschriftsvergütung heraus. Seinen Plan, durch private Buchreklame die Verlagswerbung zu unterlaufen und den Eigengewinn weiter zu erhöhen, durchkreuzte der Verleger dann allerdings mit einer Klageandrohung. Solche Aktivitäten kamen bei vielen gar nicht gut an, aber Hoeneß ließ sich von niemandem bremsen.
Zu einem kleinen Skandal kam es im November 1974, als er nach Frankfurt zu einer Autogrammstunde reiste (Gage: 3.000 DM) und dafür das Training schwänzte. Neudecker tobte, als er davon erfuhr, und belegte Hoeneß für das nächste Spiel in Bochum mit einem Auftrittsverbot (Bayern verlor 0:3). Auch Franz Beckenbauer hatte nun allmählich genug von solchen Sperenzchen. Er hielt die Geschäftstüchtigkeit seines Mitspielers nicht nur für fragwürdig, sondern vor allem für wenig leistungsfördernd. Unverblümt kritisierte er die »Verbissenheit«, mit der Uli Hoeneß nach dem Geld schiele. »Machst du zu viel nebenbei, gibst du nur noch Autogrammstunden – dann wirst du bald merken, dass der Schuss nach hinten losgeht. Es ist ganz einfach: wenn Fußball nicht mehr die Hauptsache für dich ist, sondern Geld, dann bringst du bald eine sehr schlechte Leistung.«
Paul Breitner, der mit Werbeverträgen für Maggi, Coca-Cola, Trumpf und Nestlé kaum weniger verdient hatte als sein ehemaliger Zimmergenosse, hatte nach der WM mit seinem Wechsel zu Real Madrid den direkten Weg zum Geld gesucht: Drei Millionen brachte ihm sein Dreijahresvertrag bei den »Königlichen« ein. Der Großverdiener wollte bald auch seinen alten Kumpel zum Wechsel überreden, und tatsächlich sollten sich zwei Jahre später die Gerüchte verdichten, dass Hoeneß demnächst im weißen Trikot Reals auflaufen könnte. Doch dann entschied sich Breitner für eine Rückkehr nach Deutschland, und Hoeneß verkündete, dass er seinen bis 1978 laufenden Vertrag bei den Bayern erfüllen wolle. Ausschlaggebend für seine Entscheidung war wohl die Befürchtung, dass er durch den Wechsel die Anwartschaft auf einen Platz in der Nationalmannschaft einbüßen könnte. »Legionäre« waren damals beim DFB sehr unbeliebt, und das hatte auch Breitner zu spüren bekommen, der es während seiner Real-Zeit lediglich zu zwei Länderspielberufungen brachte. »1978 bin ich 26«, kalkulierte Hoeneß, »dann kann ich immer noch im Fußball großes Geld verdienen.«
Da er mit seinem in München erzielten Gehalt nie zufrieden war bzw. seine Fußballeinnahmen immer nur als »Basis« betrachtete, ließ er sich nach dem Motto »Kleinvieh macht auch Mist« weiterhin keinen Zusatzverdienst entgehen. So schloss er etwa für ein Honorar von rund 1.500 DM jährlich einen Vertrag ab, der ihn verpflichtete, an Veranstaltungen teilzunehmen: Autogrammstunden, Diskussionen, ein Schüler-Fußballspiel zu pfeifen, ein Training zu leiten bei einem Amateurverein – oder auch mal die Gewinner eines Preisausschreibens zum »Frühstück mit Uli Hoeneß« einzuladen, bei dem Susi im trauten Heim Brötchen und Leberkäse auftrug. Begeistert war sie nicht gerade von den fremden Eindringlingen, aber sie trug alle Entscheidungen ihres Mannes mit. Immerhin hatte der gewisse Kriterien aufgestellt und war nicht zu allem bereit. Für alles werde er sich nicht hergeben, meinte er, und sicherte sich daher, als er seine Werberechte an eine Agentur vergab, ein Mitspracherecht. Jugend- und Freizeitmode passe zu ihm, war er überzeugt, eine Versicherung ebenso, vor allem aber eine Bank. Wer für eine Bank werbe, der müsse solide sein und mit dem Geld umgehen können. Und wer wäre da als Repräsentant besser geeignet als er, der Mann mit dem riesigen Sparkonto, der Mann mit den stattlichen Geldanlagen, der Mann, der trotz aller innovativen Geschäftsideen nie ein Risiko einging und mithin alles Materielle achtsam behandelte, sogar seinen Porsche, den er zur Schonung in jedem Winter abmeldete? Geld allein macht nicht glücklich – der Satz mochte schon stimmen. Aber es stimmte auch, dass Geld für einen wie Uli Hoeneß unabdingbare Voraussetzung für Glück war und blieb. Je vielfältiger die Quellen waren, aus denen es floss, desto unabhängiger machte es ihn. Und materielle Unabhängigkeit zu erreichen – das empfand der Metzgersohn als Grundmodul eines gelungenen Lebens.
Das Ende bei den Bayern
Die Saison 1978/79 war die letzte des Spielers Uli Hoeneß und die wohl turbulenteste in der Geschichte des FC Bayern München überhaupt. Im Sommer kehrte Paul Breitner nach drei Jahren in Madrid und einem recht unbefriedigenden Intermezzo in Braunschweig nach München zurück. Den Transfer hatte Uli Hoeneß durch seine Kontakte zur Ulmer Firma Magirus Deutz möglich gemacht: 600.000 DM der Ablöse von insgesamt 1,96 Millionen steuerte Magirus Deutz als neuer Trikotsponsor bei. Erhalten habe Hoeneß diese Summe nur unter der Voraussetzung, sie ausschließlich für seinen Transfer zu verwenden, kommentierte Breitner voller Stolz. Und das Geld sei gut angelegt gewesen, bilanzierte er ohne falsche Bescheidenheit Jahre später: »Das war der Beginn des Werdegangs des FC Bayern in diese Höhe, in der der FC Bayern heute ist.« Damals, im Sommer 1978, machte ein vor Tatendrang nur so strotzender Uli Hoeneß beim Pressetermin zur Vorstellung der neuen Mannschaft deutlich, dass man die Scharte vom Vorjahr, als man sich mit dem äußerst blamablen zwölften Platz hatte begnügen müssen, umgehend wieder auswetzen wolle. »Bei den Fototerminen im nächsten Jahr werden zwei Dinge gleich bleiben. Die Aufschrift wird gleich bleiben, die Spieler werden wahrscheinlich auch größtenteils dieselben bleiben, aber eines muss sich ändern – da müssen wieder Pokale stehen.« Dabei nickte er mit dem Kopf leicht in die Mitte des Trainingsplatzes – dorthin, wo früher immer die Meisterschale präsentiert worden war, aber nun schon seit vier Jahren keine Trophäen mehr hatten platziert werden können.
Der Mann mit dem übergroßen Selbstbewusstsein schien sich also einiges zuzutrauen – und das trotz des seit geraumer Zeit kursierenden Gerüchts, er sei eigentlich schon fast ein Sportinvalide und somit von ihm nicht mehr viel zu erwarten. Uli Hoeneß war ein Spieler, der von seiner Dynamik lebte. Und die hatte nach zahlreichen Läsionen – Leistenbruch, Verletzung der Achillessehne, zwei Meniskusoperationen – unübersehbar gelitten. Uli Hoeneß sei wie ein Kerze, die von beiden Seiten angezündet wird, hatte die »FAZ« im Frühjahr 1977 geschrieben. Das sollte heißen: Seine kraftraubende Spielweise mit den entsprechenden Verschleißerscheinungen führe zwangsläufig zu einer Karriere von nur kurzer Dauer.
Noch aber lief die Karriere, und noch war der Ehrgeiz des angeschlagenen Stürmers riesig. Dem möglichen Vorwurf, ein Geldabzocker auf der Reservebank zu sein, wollte er unbedingt entgegenwirken, und so handelte er mit Bayern-Präsident Neudecker einen Sondervertrag aus, in dem er auf jedes Grundgehalt verzichtete und ausschließlich nach tatsächlichen Spieleinsätzen bezahlt werden sollte. »Nun kann mir niemand mehr vorwerfen, ich liege dem Verein auf der Tasche«, kommentierte er sein Vorgehen. »Das volle Risiko trage nur ich.« Außerdem gefalle es ihm, schob er als weitere Begründung für sein Vorgehen hinterher, ein außergewöhnliches Experiment durchzuziehen. »Ich will ausprobieren, wie das geht. Ich will sozusagen Fußball im Extremfall spielen. Ich will mich bewusst allen Einflüssen, Unwägbarkeiten, Gefahren meines Berufes aussetzen.« Selbst der Gefahr, im Zweifel kein Geld zu verdienen. Aber das hatte er inzwischen aufgrund seiner zahlreichen Nebeneinkünfte sowieso nicht mehr unbedingt nötig. Fußball nur aus Leidenschaft zu spielen – das war die Freiheit, die er sich erarbeitet hatte und nun nutzen wollte.
Laut der Münchner Boulevardzeitung »tz« war Hoeneß 1977/78 auf ein Jahresgehalt von 450.000 DM gekommen, nun sollte er pro Einsatz 10.000 DM erhalten, dazu die üblichen Prämien. Das Risiko des neuen Vertrages zeigte sich rasch. Im ersten Saisonspiel (0:1 in Dortmund) zur Halbzeit ausgewechselt, saß Hoeneß bereits beim 6:2-Heimsieg gegen Duisburg auf der Bank. Trainer Gyula Lorant meinte nach dem Spiel: »Hoeneß passt momentan nicht in mein Konzept. Außerdem kommt er mit der Raumdeckung nicht zurecht.« Der Geschasste war erbost, aber nicht wegen des verlorenen Geldes, wie er feststellte, sondern weil er nicht spielen durfte, obwohl er sich so gut in Form fühlte wie zu seiner besten Zeit. Ansonsten nahm er die Sache noch humorvoll. Der Präsident Neudecker habe am Spieltag ganz freundlich Grüß Gott zu ihm gesagt. »Früher, wenn ich verletzt war und nicht gespielt habe und trotzdem einen Haufen Geld gekostet habe, hat er mich kaum angeschaut.« Während der Präsident ihn anlächelte, wurde er allerdings vom Trainer kaum mehr beachtet. »Hoeneß ist nur noch Ersatzmann für Rummenigge«, hatte Lorant entschieden.
Für den einstigen Jung-Siegfried gestaltete sich die Lage immer unbefriedigender. Es wurde zunehmend deutlich, dass er in den Planungen des nicht nur von Breitner als inkompetent eingeschätzten Lorant keine Rolle mehr spielte. An Lorant allein lag es freilich nicht, denn Hoeneß’ Laborieren an den Folgen seiner schweren Verletzungen war unübersehbar. Breitner verteidigte seinen Freund: »Ein Spieler wie der Uli, der in erster Linie von seiner körperlichen Verfassung abhängig ist, der braucht länger als ein Spieler, der vielleicht mehr von der Technik lebt.« Hoeneß selbst sollte Jahre später zugeben: »Ich habe damals drei Jahre lang nicht mehr ohne Schmerzen trainieren und spielen können. Das war eine furchtbare Zeit.«
Im September 1978 hoffte er freilich noch auf eine Genesung und versuchte, sich bei anderen Vereinen ins Gespräch zu bringen. Tatsächlich zeigte sich der HSV-Manager Günter Netzer bereit, einen Blitztransfer des Münchner Edelreservisten für ein Jahresgehalt von 200.000 DM nach Hamburg zu arrangieren. Der wechselwillige Hoeneß absolvierte ein Probetraining – und war dann wie vor den Kopf gestoßen, als Netzer vor Unterzeichnung des Vertrages eine Arthroskopie des lädierten Knies forderte. In der Boulevardpresse war kolportiert worden, dass Hoeneß seine über eine Summe von 1,5 Mio. DM abgeschlossene Sportinvaliditäts-Versicherung nicht mehr hatte verlängern können, und das hatte den HSV wohl skeptisch werden lassen. Der HSV-Arzt Dr. Mann, ein Spezialist in Sachen Kniespiegelung, begründete, dass diese Untersuchung »die beste Aussagekraft in unklaren Fällen« habe und zudem nur eine Routinesache sei. Uli Hoeneß jedoch war empört, lehnte den Eingriff aus Angst vor einer weiteren Schädigung seines Knies ab und flog wieder zurück nach München. Über die eigentlichen Hintergründe von Netzers Forderung wurde später in Hamburg hinter vorgehaltener Hand geflüstert: HSV-Trainer Zebec habe bereits nach wenigen Minuten im Probetraining gesehen, dass mit Hoeneß nichts mehr los sei.
Präsident Neudecker nahm den bereits verloren geglaubten Sohn wieder auf, und alles schien ins Reine zu kommen, als der knorrige Trainer Lorant sich ganz offensichtlich willens zeigte, an dem ehemaligen Weltklassestürmer festzuhalten. Vor einem Auftritt im »Aktuellen Sportstudio« am 23. September, bei dem er zu der Sache mit der Arthroskopie Stellung nehmen wollte, äußerte Hoeneß über Lorant: »In einem langen Gespräch heute Morgen hat er mir zugesichert, alles zu tun, um mir eine neue Chance zu geben.« Noch am Nachmittag desselben Tages hatte sich gezeigt, dass es durchaus angebracht sein könnte, es noch einmal mit dem Stürmer Hoeneß zu versuchen: Da waren die Bayern nämlich im Olympiastadion sensationell mit 4:5 in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück ausgeschieden. Der erst in der 85. Minute eingewechselte Hoeneß hatte das Verhängnis zwar nicht mehr abwenden können, aber vielleicht wäre ja alles anders gekommen, wenn er von Beginn an hätte mitwirken dürfen. Kurz vor der Sendung freute er sich in den Kulissen des Studios, nun endlich vor laufenden Kameras die seiner Meinung nach völlig falschen Berichte in der Presse richtigstellen zu können. »Man müsste jeden Tag eine Fernsehsendung haben, um die Dinge zu korrigieren.« Hoeneß’ Abneigung gegen die angeblich von Lügen und Verfälschungen durchsetzten Printmedien trat hier zum ersten Mal deutlich zutage.
Vor den Kameras des ZDF legte er einen großen Auftritt hin. Wie ein Anwalt beim Plädoyer präsentierte er ein monströses Arthroskop und erläuterte: »Es kann A) Infektionen geben, B) es kann dabei das Knie beschädigt werden, und drittens – und das ist mir das Entscheidende –, jeder Arzt sagt: In ein solches Knie, das nach Auskunft auch von Dr. Mann vom HSV reizfrei ist, so etwas zu machen, ist unverantwortlich. Und in München gibt es einen Arzt, der spricht sogar von einem Kunstfehler. Und jetzt frage ich den Herrn Netzer: Wenn er zu mir sagt, er sei tief enttäuscht von mir, dann kann ich ihm dazu nur antworten: Im Moment ist nur er enttäuscht. Wenn irgendetwas passiert wäre, dann wäre meine Familie enttäuscht worden. Ich muss fragen, was ist wichtiger. Und wenn im Fußball solche Dinge sich durchsetzen, und der Günter Netzer sagt, als Profi muss der Uli das mit sich machen lassen, dann kann ich nur eine Antwort geben: Dann möchte ich kein Profi mehr sein, und dann höre ich auf mit dem Fußballspielen.« Es war ein für damalige Medienverhältnisse sehr ungewöhnlicher Auftritt, in dem Hoeneß sich einmal mehr als der herausragende Vertreter einer Fußballergeneration präsentierte, die mündig geworden war.
Die Hintergründe der Geschichte mit der Arthroskopie also konnte Uli Hoeneß richtigstellen. Mit Lorant aber klärte sich nichts. Hoeneß saß weiterhin auf der Bank. Am 21. Oktober kam es beim Spiel in Stuttgart zum Eklat. Die Bayern lagen mit 0:2 zurück, und Breitner gestikulierte wie wild auf dem Platz, schrie in Richtung Trainerbank: »Bring doch endlich den Uli rein, du Wahnsinniger.« Lorant aber wechselte – wohlgemerkt: bei einem Rückstand von 0:2! – mit Klaus Augenthaler erst einen Verteidiger ein, bevor er kurz vor Schluss und natürlich viel zu spät doch noch Hoeneß brachte. Als der ehemalige Weltklassestürmer eine Woche später nur noch in der zweiten Bayern-Mannschaft kicken durfte, kommentierte die »Welt« hämisch: »Jung-Siegfried von einst heute ausgelacht.«
Es zeichnete sich nun mit aller Deutlichkeit ab, dass die Differenzen mit dem verstockten und zu keinerlei Diskussionen bereiten Trainer nicht mehr zu kitten sein würden. Er sei wegen seines Knies »natürlich schon gehandicapt« gewesen, sollte Hoeneß im Rückblick zugeben. Das sei aber nur die eine Seite gewesen. »Auf der anderen Seite hatten wir damals mit Gyula Lorant einen Trainer, der relativ wenig Rücksicht genommen hat auf Spieler, die mal verletzt waren und die man hätte heranführen müssen. Er hat so nach der Methode gearbeitet: Vogel, friss oder stirb. Das war für meine damalige Situation natürlich schwierig.« Ihr Mann sei sensibler, als man denke, fügte Gattin Susi hinzu. Die Verstocktheit seines Trainers, die Zweifel und die Kritik an ihm hätten dazu geführt, dass er zuletzt auch selbst nicht mehr richtig an sich geglaubt habe.
Es war also höchste Zeit für eine Luftveränderung, um wieder frischen Wind zu bekommen. Am 1. November wechselte Uli Hoeneß für eine Leihgebühr von 150.000 DM zum abstiegsgefährdeten 1. FC Nürnberg. Sein Brutto-Monatsgehalt betrug laut Auskunft des stolzen »Club«-Präsidenten Lothar Schmechtig 5.000 DM.
Ein Manager im Wartestand
Am 4. November, beim ersten Hoeneß-Auftritt im Nürnberger Stadion, sahen 58.000 erwartungsfrohe Club-Fans einen motivierten, engagierten und richtig starken Uli Hoeneß – erlebten aber zugleich eine 0:2-Niederlage ihrer Mannschaft gegen Schalke 04. Als es auch in den folgenden Spielen nicht besser lief – auf Niederlagen gegen Frankfurt und Bielefeld folgte ein 0:4 in München –, begann der immer weniger überzeugend auftretende Hoeneß selbstkritisch zu werden und sprach davon, dass er die Höhen von früher möglicherweise doch nicht mehr würde erreichen können. Ganz so schnell wie einst, gab er zu, sei er sicherlich nicht mehr, aber er wolle natürlich weiterhin sein Bestes geben. »Das kommt oder es kommt nicht«, äußerte er in einem etwas fatalistischen Ton über die Chancen, sein Leistungsvermögen zu steigern, »und wenn es nicht kommt, kann man auch nichts machen.«
Uli Hoeneß fühlte die Zeit gekommen, da er sich würde Gedanken machen müssen über das, was nach dem Ende seiner aktiven Karriere folgen sollte. »Es scheint mir das Wichtigste zu sein«, erläuterte er, »dass es einem gelingt, auch nachher eine Persönlichkeit zu sein, also ohne dass man jedes Wochenende Erfolgserlebnisse auf dem Fußballplatz hat. Das strebe ich an. Ob es mir gelingt, das kann ich im Moment noch nicht sagen.« Eine Idee, was er künftig tun könnte, hatte er bereits: Fußballmanager. Im November äußerte er gegenüber dem »Fußballmagazin«: »Ich verstehe etwas von Finanzen und Geschäften. Ich verstehe etwas von Fußball und Fußballspielern. Ich bin prädestiniert für diesen Beruf.«
Sein Vorbild war Robert Schwan, der den Posten des Managers bei den Bayern bis 1977 bekleidet hatte, als er seinem Schützling Franz Beckenbauer nach New York gefolgt war. Schwan war eine starke Persönlichkeit und aufgrund seiner Selbstverliebtheit für sein unmittelbares Umfeld zuweilen nur schwer erträglich – er kenne nur zwei intelligente Menschen, hatte er einmal geäußert, »Robert Schwan am Vormittag und Robert Schwan am Nachmittag« –, doch er war auch ein Mann mit Visionen, dem insbesondere daran gelegen war, den Fußball von seinem proletarischen Image zu befreien – etwa durch die Einführung von Englischkursen für die Spieler oder durch das Buchen bester Hotels bei Auswärtsspielen. Als Spieler war Hoeneß so etwas wie der Assistent von Robert Schwan gewesen und hatte dessen Aktenkoffer tragen dürfen. »Wo immer wir mit dem FC Bayern unterwegs waren, habe ich Robert Schwan über die Schulter geschaut, und der hat mir oft gesagt: ›Du wirst mein Nachfolger.‹« Uli Hoeneß war also als Bayern-Manager in spe bereits in Position gebracht, doch der seit Schwans Weggang verwaiste Posten keineswegs seine einzige Option. Vor vier Jahren hatte er seinen Bruder Dieter beraten, als dieser mit dem VfB Stuttgart verhandelte, und dabei unter anderem für die Fixierung einer festen Ablösesumme im Vertrag gesorgt. Der VfB-Präsident Gerhard »MV« Mayer-Vorfelder war damals so beeindruckt, dass er den brüderlichen Berater für später den Posten eines Managers beim schwäbischen Traditionsverein angeboten hatte.
Aber war Fußballmanager wirklich das Richtige für ihn? In München fiel Paul Breitner auf die Frage, ob er sich seinen Freund womöglich als Fußballmanager vorstellen könne, Folgendes ein: »Dafür ist das Betätigungsfeld für den Uli zu klein. Der Uli ist zu Größerem in der Lage. Das wäre sicherlich schade, wenn sich der Uli irgendwo bei einem Verein hinter den Schreibtisch hocken würde. Es wäre ein Unsinn. Ich glaube, wenn er ganz ehrlich ist, dann will er das auch gar nicht. Er wird sicherlich mal irgendwas im Bereich Management tun, das ja. Aber nicht beim FC Bayern oder bei irgendeinem anderen Verein.« Breitner hatte wie immer eine eigene Meinung, die Wirklichkeit sah aber anders aus. Während in dem äußerst schneereichen Winter der Bundesliga-Spielbetrieb durcheinander gewirbelt wurde – insgesamt gab es 46 Absagen –, köchelte die Gerüchteküche. Nach dem 21. Spieltag am 3. Februar 1979 sickerte durch, Bayern-Präsident Neudecker wolle den beim VfB Stuttgart in Diensten stehenden Dieter Hoeneß als Nachfolger von Gerd Müller und seinen Bruder Uli als neuen Bayern-Manager verpflichten. An diesem Samstag fanden nur drei Partien statt, und da auch Uli Hoeneß aufgrund der Absage der Partie Nürnberg gegen Köln unbeschäftigt war, konnte er auf dem Gebiet des Managements tätig werden. Er organisierte in Frankfurt, wo die Bayern bei der Eintracht angetreten waren, ein Treffen zwischen Neudecker und seinem vom VfB-Auswärtsspiel in Hamburg angereisten Bruder Dieter. »Sie wären der würdige Nachfolger Gerd Müllers, und wir sind sehr an Ihnen interessiert«, soll Neudecker den möglichen Neu-Bayern umworben haben.
Eine gute Woche später gab Uli Hoeneß offiziell bekannt: »Ich werde zum 1. Juli 1979 Manager bei Bayern München, vorher erfülle ich aber auf jeden Fall meinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg.« Neudecker habe ihm eine Frist von zehn Tagen gesetzt. Er kannte Neudecker gut genug, um zu wissen, dass der sein Vorhaben auch in die Tat umsetzt. Und er wusste: Wenn er jetzt nicht zugeschlagen hätte, wäre sein Traumjob besetzt gewesen. Der Konkurrent hieß Rudi Assauer, damals Manager von Werder Bremen, dem Neudecker kurz zuvor ein Angebot unterbreitet hatte. Der Bayern-Präsident entschied sich schließlich für den Ex-Bayern-Spieler, und der hielt den Zeitpunkt des Überwechselns ins neue Berufsleben für gerade richtig. Er hätte sicherlich noch zwei, drei Jahre Fußball spielen können, war er überzeugt, aber zugleich fürchtete er, später nicht noch einmal eine so gute Gelegenheit für den Einstieg in einen anderen Beruf zu erhalten. Dazu kamen ernstzunehmende Bedenken, denn eine Fortsetzung seiner Karriere wäre von großen Unwägbarkeiten begleitet und nur mit großem Risiko möglich gewesen. »Als mir die Ärzte damals erklärten, wenn ich weiterspielen würde, könnten sie mir nicht garantieren, dass ich mit 40 Jahren noch Tennis spielen und mit 50 noch beschwerdefrei spazieren gehen kann, war für mich klar: Jetzt musst du aufhören!« In dieser Situation sei dann die Anfrage von Neudecker »wie eine Erlösung« gewesen.
Was für Hoeneß eine Erlösung war, sollte sich für den FC Bayern als die beste denkbare Lösung auf dem Managerposten erweisen. Jahre nach der Entscheidung, als der Manager seine Bayern zu Seriensiegern gemacht hatte, resümierte er immer noch ein wenig ungläubig, wie schnell das alles damals gegangen war: Ein »Wahnsinnsjahr« sei das gewesen, es habe sein Leben »total verändert, und ich glaube, auch das des FC Bayern«.
Über die Hintergrund-Details seiner Verpflichtung als Bayern-Manager berichtete Uli Hoeneß nie Konkretes, er sprach da immer nur vom »Anruf Neudeckers«. Auch im Jahr 1993, als die Hoeneß-Brüder von der »SZ« zu einem Plausch über die alten Zeiten geladen waren, bestritt er irgendwelche Zusammenhänge mit dem Transfer seines Bruders Dieter. Der hingegen meinte, das Gerücht, sein Bruder Uli hätte ihm geraten, in München zu unterschreiben, damit er dort Manager werden könne, sei damals schon sehr problematisch gewesen. Gewiss sei er noch nicht offiziell Bayern-Manager gewesen, so Dieter weiter, aber natürlich habe Uli ihn »schon auch im Auftrag der Bayern« beraten. Da Rudi Assauer bis heute behauptet, der Manager-Job bei den Bayern sei zuerst ihm angeboten worden, spricht einiges für die These, dass Neudeckers Entscheidung für Uli Hoeneß vom gelungenen Abschluss des Transfers von Dieter zumindest mitmotiviert war.
In jedem Fall unzweifelhaft bleibt, dass Dieter nur deswegen zum Schnäppchenpreis von 175.000 DM vom Neckar an die Isar hatte wechseln können, weil Uli für eine entsprechende Wechselklausel im Vertrag mit dem VfB gesorgt hatte. Fest steht zudem: Der Unglücklichste bei der ganzen Angelegenheit war mit Sicherheit der VfB-Präsident Mayer-Vorfelder. »Plötzlich tauchen da die Herren Manager auf, die im deutschen Fußball kein Wesen, sondern ein Unwesen sind«, hatte er äußerst gereizt auf Uli Hoeneß’ Werben um seinen Bruder und weitere VfB-Spieler reagiert. Neben Dieter, so behauptete »MV«, habe der Bayern-Manager in spe »als Kumpel« auch zu Markus Ellmer sowie zu Karl-Heinz und Bernd Förster Kontakt gesucht »in dem Versuch, sie abzuwerben. Außerdem wollte er unseren bewährten Physiotherapeuten Francois Caneri von uns wegholen.« Auch in der Öffentlichkeit war das Gebaren des noch nicht einmal offiziell im Amt bestätigten Management-Novizen nicht gut angekommen. Im »Kicker« hatte Werner-Johannes Müller kritisch bemerkt: »Manager – die Aufgabe verlangt persönlichen Stil, eine klare Linie, muntere Geschäftstüchtigkeit reicht da nicht.«
Die Revolte der Bayern-Spieler
Uli Hoeneß’ forscher Auftakt im neuen Job war trotz aller Kritik nicht der eigentliche Aufreger dieser turbulenten Saison 1978/79. Der fand bei den Bayern statt, die unter Trainer Lorant mehr und mehr ins Trudeln geraten waren. Nach einer deprimierenden 1:7-Niederlage in Düsseldorf im Dezember war der Streit zwischen dem Trainer und den Spielern um Breitner eskaliert. Lorant hatte sich zunächst in den Krankenstand und dann für immer verabschiedet, den Job an der Seitenlinie hatte als »Interimslösung« sein Assistent Csernai übernommen. Die Ergebnisse waren jedoch auch unter dem Neuen trübe geblieben. Zwei Siege und drei Niederlagen standen zu Buche, als es am 10. März erneut eine große Blamage gab – die Bayern verloren zu Hause gegen Bielefeld mit 0:4. Die Stimmung war nun auf einem Siedepunkt. Bayern-Präsident Neudecker wollte Csernai durch einen Mann ersetzen, der endlich wieder Zucht und Ordnung in die seiner Meinung nach chaotische Truppe bringen würde: Max Merkel. Die Mannschaft war jedoch strikt dagegen. Vor allem Breitner setzte sich dafür ein, den bei den Profis beliebten Ungarn Csernai fest zu verpflichten. »Es gibt überhaupt keinen anderen Weg, wir haben ohnehin kein Geld«, erläuterte er dem Präsidenten. »Und ich habe, was die Vorbereitung auf ein Spiel, das Training an sich angeht, noch keinen Besseren erlebt. Gut, hat Neudecker gesagt, ich gebe euch zwei Spieltage, um zu beweisen, dass es funktioniert.«
Pal Csernai würde also bleiben dürfen, wenn, so die genaue Abmachung, aus den anstehenden Auswärtspartien in Braunschweig und in Mönchengladbach mindestens ein Unentschieden und ein Sieg herausspringen würden. In Braunschweig erkämpften sich die Bayern am 17. März ein 0:0. Die Spieler meinten, damit den ersten Teil des Abkommens erfüllt zu haben, da erfuhr Paul Breitner auf dem Rückweg nach München durch einen Journalisten – die Mannschaft befand sich nach einer Zwischenlandung gerade auf dem Frankfurter Flughafen –, von der soeben erfolgten Erklärung Neudeckers, Max Merkel werde ab Sonntag das Training übernehmen. »Daraufhin hab’ ich die Mannschaft zusammengetrommelt«, so Breitner, »und habe gesagt: Es geht mir nicht um den Herrn Merkel, sondern um die Zusage des Präsidenten, dass wir zwei Spieltage Zeit haben. Und jetzt hat er gelogen, das lassen wir uns nicht bieten. Der Merkel ist morgen um zehn Uhr an der Säbener Straße, und wir machen frei. Und wir treffen uns wieder am Montag um zehn Uhr, wo, das sag’ ich euch noch. Hamma uns? Kein Widerspruch.« Breitner und Kapitän Maier riefen danach Neudecker an und setzten ihn über den beschlossenen Boykott ins Bild.
Wilhelm Neudecker, gleichermaßen erbost wie ratlos und trotzig, wollte mit solch aufmüpfigen Spielern, die als »Aufrührer« und »Anarchisten« in die Vereinsführung hineinzuregieren trachteten, nichts mehr zu tun haben. »Mutti, ich trete zurück und werde nicht mehr kandidieren«, sagte er zu seiner Frau, und am Montag um neun Uhr morgens verkündete er in einer Mannschaftssitzung das Ende seiner Präsidentschaft. »Mit einem solchen Kapitän und dieser Mannschaft kann ich nicht weiter zusammenarbeiten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Auf Wiedersehen.« Für den Boulevard war die Sache ein gefundenes Fressen. »Bayern-Spieler stürzen Präsidenten«, lautete die Standard-Schlagzeile. Und Bayern-Kapitän Sepp Maier wurde live in der »Tagesschau« zugeschaltet, um zu dieser »Spielerrevolution« Stellung zu beziehen. »Wir haben weder einen Präsidenten gestürzt, noch sind wir eine Terrortruppe«, erregte er sich über die verzerrte Darstellung in den Medien. »Unser Wunsch war nicht, dass Herr Neudecker uns seinen Rücktritt erklärt, sondern wir wollten vom Herrn Neudecker ganz klare Worte hören, warum er das getan hat und warum er sich nicht noch diese Woche Zeit gelassen hat, um der Mannschaft noch einmal eine Chance zu geben.« Was danach geschehen wäre, nach dem Spiel am 24. März in Mönchengladbach, »das wäre dann die Entscheidung von Herrn Neudecker gewesen«, so Maier, »und dann hätten die Spieler gar nichts sagen können, auch ich nicht als Kapitän. Ich bin kein Anarchist, wie man mich betitelt hat, ich bin nur der Mannschaftssprecher vom FC Bayern, und es ist meine Pflicht, dass ich das, was mir die Spieler zutragen, dem Präsidenten mitteile.« Der »Revolution« folgte ein grandioser 7:1-Triumph in Mönchengladbach. »Wir haben einem gewissen Herrn gezeigt, dass es auch ohne Diktatur geht, ohne dass man die Spieler als Idioten behandelt«, triumphierte Breitner und kündigte an: »Das ist das erste Mal, dass die Mannschaft nach einem Spiel saufen geht.«
Mit der »Revolution« der Spieler war ein vorprogrammierter Konflikt zum Abschluss gekommen. Der autokratische Führungsstil des Präsidenten Neudecker passte nicht mehr zu einer Mannschaft, in der mündige und mit einem vergleichweise hohen Bildungsniveau ausgestattete Spieler das Regiment übernommen hatten. Die Zeiten, in denen ein Präsident in der Manier des Alleinherrschers unbedingten Gehorsam einfordern konnte, waren vorbei. So war der Aufstand gegen Neudecker sowohl ein Ausdruck veränderter Verhältnisse wie auch ein Anschub für einen Modernisierungs- und Professionalisierungsprozess, der nun, mit Uli Hoeneß als Initiator und Steuermann vorneweg, den gesamten Fußball in Deutschland auf einen neuen Kurs bringen sollte.
Der Beginn als Manager
Der Bayern-Manager in spe, der die revolutionären Vorgänge in München nur aus der Ferne beobachtet hatte, war am 20. März 1979 zum letzten Mal für den 1. FCN aufgelaufen. In elf Spielen für den »Club« war seine Leistung nur noch ein müder Abglanz früherer Tage gewesen. Er hatte kein Tor geschossen und für keine Torvorlage gesorgt. Seine besten Szenen, so ein Nürnberger Spieler, habe er unter der Dusche und in der Kabine gehabt, da habe er sich immer noch »wie ein Weltmeister« aufgespielt. »Uli Hoeneß spielte Fußball wie ein Automotor, den man im ersten Gang in Tourenbereiche jagt, die auf die Dauer nicht gut gehen können«, schrieb der »FAZ«-Autor Ulrich Kaiser in einer Art Nachruf. »Wenn es im Bezug auf Menschen nicht so entsetzlich klingen würde, müsste man von Materialverschleiß reden.« Der »Verschlissene« selbst sah es im Rückblick etwas freundlicher. Gut, er sei natürlich nicht richtig fit gewesen, aber: »Am Anfang, finde ich, habe ich sehr gut gespielt, die ersten paar Spiele.« Letztlich sei die Mannschaft aber einfach nicht stark genug gewesen, um den Abstieg zu verhindern.
Der »Club« lag bei seinem Abschied am 23. Spieltag auf Platz 17, hatte fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. »Zu dem Zeitpunkt«, resümierte Hoeneß, war »die Aussichtslosigkeit, den Abstieg zu verhindern, ziemlich groß. Wäre damals die große Chance noch da gewesen, den Abstieg zu verhindern, hätte ich mit Sicherheit weitergespielt bis zum Ende.« Nun also war Schluss, nach 250 Bundesligaspielen und 86 Toren, die er allesamt für den FC Bayern erzielt hatte. Und der einstige Fußballprofi entschied sich nun, vorzeitig nach München zu gehen, um sich auf seine neuen Aufgaben als Bayern-Manager vorzubereiten. Möglich geworden war diese Entwicklung nur dadurch, dass er damals in Nürnberg weitab vom Schuss und daher nicht in die Bayern-Streitereien involviert war. Es hatte geradezu etwas »Schicksalhaftes«, so Hoeneß Jahre später. Das kurze Engagement in Nürnberg, das an sich ja recht unglücklich gelaufen war, erwies sich somit im Nachhinein für seine weitere berufliche Tätigkeit geradezu als Segen. »Neudecker brauchte jemanden, der bei dem Krach, der damals bei Bayern herrschte, nicht dabei war.« Wenn er in München geblieben wäre, wäre er sicher mitten im Geschehen gewesen und niemals Manager geworden.
Bereits am 26. März tauchte Uli Hoeneß in München auf, machte das Vormittags-Training mit und schwärmte von der »absoluten Ruhe«, die nun in der postrevolutionären Bayern-Mannschaft vorherrsche. Er selbst geriet indes als Manager im Wartestand vor allem zum Anlass für Unruhe. Jetzt rächte sich, dass er schon so oft mit seiner Profitgier aufgefallen war; denn die, meinten Kritiker, könne sich leicht zum Schaden des Vereins auswirken. Zum exemplarischen Beleg für die Vorwürfe geriet der im Vorjahr abgeschlossene Vertrag mit Magirus Deutz. 1,96 Mio. DM für drei Jahre brachte der, und Hoeneß hatte davon knapp zehn Prozent, 180.000 DM, als Vermittlungsgebühr kassiert. »Dass ich für den Vertragsabschluss mit Magirus Deutz eine Vermittlungsgebühr bekommen habe, ist mein gutes Recht«, rechtfertigte er sich, »zumal ich damals ja noch Spieler und nicht Manager des Klubs war und diese Vermittlung außerhalb meiner Pflichten dem Verein gegenüber lag. Zudem muss ich richtigstellen, dass ich an den Transfersummen überhaupt nicht beteiligt bin und an dem Verkauf der Dauerkarten nur über die Summe, die über das bisherige Kontingent hinausgeht. Bei der Stadionzeitung ist es so, dass ich sie in Zukunft zum Teil mitorganisieren werde. Der FC Bayern bekommt dabei einen bestimmten Betrag, und erst an der Summe, die diesen Betrag übersteigt, bin ich beteiligt. Das ist doch eine echt leistungsbezogene Geschichte.«
Schärfster Kritiker innerhalb des Vereins war ein ehemaliger Mitspieler, der Medizinstudent Jupp Kapellmann. Er habe früher schon von Spielern Bälle signieren lassen und daran 40.000 DM verdient, warf er dem künftigen Manager vor. »An diesen Vorwürfen ist überhaupt nichts Wahres dran. Für mich ist das eine Frechheit, wie ich sie bislang noch nicht erlebt habe«, wehrte sich Hoeneß. Kapellmann drohte, dass er gehen werde, falls Hoeneß tatsächlich komme.
Hoeneß kam dann schneller als gedacht, wohl auch, um Kritiker wie Kapellmann – der dann zum Lokalrivalen 1860 wechselte – vor vollendete Tatsachen zu stellen. Am 1. Mai trat der 27-jährige Ex-Profi offiziell als jüngster Manager der Bundesliga an. »Ich bin ja kein großer Freund von Sakkos, aber an diesem Tage habe ich mir eines angezogen«, erinnerte er sich, »ein graues Sakko, dazu ein hellblaues Hemd. Dazu habe ich mir einen großen schwarzen Notizblock unter den Arm genommen und habe mir gesagt: So, nun musst du den Manager machen. Das Schwan’sche Büro war fast leer, nur der Schreibtisch und eine Konsole daneben waren da. Dann habe ich mit drei, vier Leuten zwei Stunden rumtelefoniert, und dann bin ich wieder heimgefahren.« Es ging um die Aushandlung eines Freundschaftsspiels für 20.000 DM. Mehr, so Hoeneß, habe es nicht zu tun gegeben. Oder besser ausgedrückt: Von dem »Mehr«, was es zu tun hätte geben können, hatte er zu diesem Zeitpunkt noch keine klare Vorstellung. Für den Beruf des Managers gab es damals noch keine definierten Konturen – lediglich Helmut Grasshoff in Mönchengladbach und eben Robert Schwan bei den Bayern waren bis dahin in einer Weise tätig gewesen, wie es heutige Bundesligamanager tun. Hoeneß musste sich also sein Tätigkeitsfeld erst selbst erschließen.
Der neue Kommandeur in der Bayern-Führung empfand es als großen Vorteil, eine erfolgreiche Fußballerkarriere als Erfahrungshintergrund in seinen neuen Job einbringen zu können. Der »wesentliche Unterschied« zwischen einem Manager in einem Industrieunternehmen und dem in einem Profiverein sei der, so Hoeneß, dass man als Fußballmanager »selbst gespielt haben sollte«. In dieser Feststellung lag zugleich ein Vorwurf gegen die alte Garde der Vereinsführer, die ja in der Regel nie auf höchstem Niveau gespielt hatten. Seiner Meinung nach konnte die Mechanismen des Geschäfts aber nur der voll durchschauen, der einst selbst in den großen Stadien der Welt auf dem Rasen mitgemischt hat. Als ehemaligem Klassespieler falle es ihm leicht, sich in das Denken junger Profis einzufühlen. »Ich habe in meiner Profizeit alles gesehen, jeden Trick durchschaut, ich kenne die Typen, die in diesem Geschäft mitzumischen versuchen. Mir macht keiner was vor.« Darüber hinaus sollte Hoeneß rasch bemerken, dass man es als Ex-Profi im Umgang mit Leuten, die sehr viel Geld verdienen, leichter hat, da man Vertragsgespräche mehr auf Augenhöhe führen kann: »Bei der Beurteilung von Spielern wird man eher ernst genommen.«
Der Ex-Bayern-Präsident Wilhelm Neudecker mag sich der Vorteile durchaus bewusst gewesen sein, die daraus resultieren mochten, wenn man einen intelligenten, dynamischen und ideenreichen Spieler, der eben erst seine Karriere beendet hatte, an die Schaltstelle des FC Bayern setzte. Er war mit dieser Überlegung auch nicht allein. Denn Hoeneß war nicht der einzige junge Mann, der zu dieser Zeit einen Generations- und Stilwechsel in den Führungsgremien der Vereine einleitete. »Um die dreißig Jahre alt, Cordhosen, Pulli, offener Hemdkragen. Alert, gewitzt, gerissen, zu Zeiten schlitzohrig, zwei sechsstellige Einkommen – eines aus dem Job, das andere aus dem im Profigeschäft angeschafften Vermögen –, mikrofonsicher, kamerafest und eloquent: das ist der neue Manager in der Fußballbranche«, schrieb die »Zeit« und meinte damit Typen wie Netzer in Hamburg, Thielen in Köln, Assauer in Bremen und eben Hoeneß in München. Hoeneß, so heißt es in dem Artikel weiter, treibe nun »seine dritte Karriere auf die Spitze, wie stets im Self-made-Verfahren.« Die dritte Karriere – mit der ersten war die als Profi gemeint, mit der zweiten die als Geschäftsmann, deren Abrundung er noch vor sich hatte: 1983, mit der Gründung einer Bratwurstfabrik in Nürnberg.
Im neuen Job als Manager erwies es sich als großer Vorteil, dass er finanziell bereits ausgesorgt hatte – was nicht erst mit den Bratwurst-Millionen der Fall war, sondern schon 1979 durch die Einnahmen aus Werbung, Immobilien und Wertpapieren. Sein Erfolg als Geschäftsmann biete ihm perfekte Voraussetzungen für den Job als Fußballmanager, betonte er: »Weil ich der unabhängigste Mensch im Fußball bin. Weil ich alles für den FC Bayern tue, aber nichts für mich.« Diese Unabhängigkeit sei sein »einziges Geheimnis« und zugleich sein Erfolgsrezept. Er habe es nicht nötig, sich über den FC Bayern zu bereichern, er sei vollkommen unbestechlich und komme in keinerlei Versuchung, wenn etwa, wie es in der Branche üblich sei, »Freundschaftsspiel-Partner im Ausland den Preis zu drücken versuchen, indem sie dem Manager fünfoder zehntausend Mark Provision anbieten«. Außerdem erlaube ihm die finanzielle auch eine geistige Unabhängigkeit und damit die Möglichkeit, mit einem völlig ungetrübten Selbstbewusstein als Fußballmanager aufzutreten. Denn »das Wissen, morgen sofort etwas anderes tun zu können«, spürte er, »gibt Selbstvertrauen«. Und es gibt die Freiheit, rein sachorientiert zu entscheiden.
Uli Hoeneß sei »die perfekte Symbiose aus Footballman und Businessman«, schrieb der Fußballbuch-Autor Dietrich Schulze-Marmeling. Bessere Voraussetzungen für einen Fußballmanager konnte einer tatsächlich kaum mitbringen. Und vielleicht florierte der FC Bayern unter Hoeneß auch gerade deswegen so gut, weil – anders als bei anderen Bundesligavereinen – die Zuständigkeiten für das Sportliche und das Wirtschaftliche nie getrennt, sondern stets in einer Person gebündelt blieben. All das klingt plausibel, kann aber dennoch nicht erklären, warum diese Person über so viele Jahre auf ihrem Posten aushielt. Dies führt zu dem dritten Kriterium, das Uli Hoeneß – neben den Spielererfahrungen auf höchstem Niveau und der wirtschaftlichen Unabhängigkeit – als entscheidend für eine erfolgreiche Arbeit als Fußballmanager nannte: die totale Identifikation mit dem Verein. Im Gegensatz zu seinen in flotter Folge die Vereine wechselnden Kollegen war für ihn ein Arbeitsplatzwechsel ab einem bestimmten Zeitpunkt völlig ausgeschlossen. In gewisser Weise wurde aus ihm in seinem unbedingten Engagement für den FC Bayern allmählich ein ganz neuer Mensch. Hoeneß denke auf dem Feld nur an sich, und ansonsten gehe es ihm nur ums Geld, hatte Beckenbauer während der WM 1974 seinem Mitspieler vorgehalten. Aus dem Spieler, der immerzu nur »ich« sagte und »Geld für mich«, wurde nun im neuen Job ein Mann, der immerzu nur »Bayern« sagte und »Geld für Bayern«. Und weil es immer klar blieb, dass er niemals für einen anderen Verein tätig werden würde, konnte er stets mit einer besonderen Aura der Glaubwürdigkeit auftreten – und so zum »Mister Bayern« werden.
Seine drei Kriterien für die erfolgreiche Arbeit als Fußballmanager nannte Uli Hoeneß wohl nicht zufällig. Außer ihm selbst erfüllte sie in der Bundesliga niemand – und so suggerierte er damit zugleich: Solange dieser Drei-Kriterien-Hoeneß Manager bei den Bayern ist, kann auch kein anderer Verein dauerhaft zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten werden. Er selbst freilich, erwähnte er immer wieder mal nebenbei, hätte natürlich auch was anderes machen können. In der Wirtschaft hätte er sich alles Mögliche zugetraut, und dort hätte er auch besser dotierte Stellungen finden können.
Aus reiner Liebe aber verrichtete er seine Tätigkeit beim FC Bayern denn doch nicht. Obwohl er mit seinen Geschäften genügend Geld zur Sicherung seiner Unabhängigkeit auf die Seite gebracht hatte, wollte er auf das Zubrot, das er von den Bayern erhielt, natürlich nicht verzichten. Aber was heißt da »Zubrot«? Sein Verdienst bei den Bayern war erstaunlich üppig. Als Basis gab es 10.000 DM als monatliches Grundgehalt, dazu kamen Prämien für Titel, die er in derselben Höhe wie die Spieler erhielt, und vor allem stattliche Provisionen. Von jeder Mark Werbeeinnahmen, die über 600.000 DM jährlich hinausgingen, sollte er 50 Prozent bekommen. Das schien für den Verein nicht riskant, denn damals lagen die Jahreseinnahmen in diesem Bereich bei nur etwa 300.000 DM. Dank Hoeneß stiegen die freilich rapide. »Heute haben wir Werbeeinnahmen von rund 70 Millionen Euro«, verriet er im Januar 2009 dem »Spiegel«, »da können Sie sich ausrechnen, was ich verdienen würde.« Für sein Empfinden war es schon 1980 geradezu peinlich viel. Nach einem Jahr sei er zum Präsidenten Willi O. Hoffmann gegangen und habe ihm eine freiwillige Kürzung seiner Provision vorgeschlagen: »Das geht so nicht weiter, ich kriege zu viel Geld.« Man einigte sich auf ein höheres Grundgehalt und nur noch fünf Prozent Provision. Mitte der achtziger Jahre lag sein Jahresgehalt bei etwa 300.000 DM brutto plus Erfolgsprämien. Nur wenige Jahre später, als sein Festgehalt auf über 400.000 DM gestiegen war, setzte er eine Erhöhung seiner Provision auf sechs Prozent durch. Es könne nicht sein, begründete er kühl, dass er den Fanartikel-Verkauf von null auf sechs Millionen Mark aus dem Boden stampfe und davon nicht profitiere. Später erzielte Uli Hoeneß unter der Berufsbezeichnung »Stellvertretender Vorstand der Bayern München AG« einen Jahresverdienst von angeblich rund einer Million Euro. Ein Feilschen um Provisionen, möchte man meinen, sollte sich da erübrigt haben.
Uli Hoeneß bildete nicht nur eine perfekte Symbiose aus Fußballund Wirtschaftskompetenz, sondern auch aus mittelständischer Bodenständigkeit und innovativem Geschäftssinn. Deswegen ging die Erfolgsgeschichte der Bayern nicht sprunghaft vonstatten, sondern kontinuierlich und nachhaltig. Als Hoeneß 1979 mit dem Managen anfing, hatte der FC Bayern insgesamt gerade einmal 12 Mio. DM Umsatz. Im Eiltempo machte er sich daran, den Umsatz – und dann natürlich auch den Gewinn – zu steigern. Rasch erkannte er, wie viel es tatsächlich zu tun gab: im Lizenzspielerbereich, bei den Spielertransfers und bei der Talentsuche, in der Werbung und in der Öffentlichkeitsarbeit. Wahrlich kein eintöniger Job, stellte er fest: »Das Aufgabengebiet ist so riesig, dass ich nicht in täglicher Routine ersticke.«
Auf eine Aufgabe freilich hätte er gerne verzichtet – nämlich auf die Aufgabe, die Schulden abarbeiten zu müssen, die unter Schwan aufgelaufen waren. Zu dem Zeitpunkt, als er Uli Hoeneß verpflichtete, wusste Präsident Wilhelm Neudecker wohl bereits, dass Steuernachzahlungen in Millionenhöhe auf den FC Bayern zukommen würden. »Neudecker hatte vor, mich zu verheizen«, mutmaßte Hoeneß. »Er hat gemerkt, hier geht alles den Bach runter.« Hoeneß wollte alles tun, um den FC Bayern zu retten und zu neuer Größe zu führen. Seinen Ehrgeiz und seinen unbedingten Willen zum Erfolg dokumentierte er vor laufenden Kameras am 9. Juni, als die Bayern, die am Ende dieser ereignisreichen Saison 1978/79 auf dem vierten Tabellenplatz einliefen, im letzten Saisonspiel beim bereits als neuer Meister feststehenden Hamburger SV einen 2:1-Sieg holten. Mitten in den Tumulten, die nach dem Spiel ausbrachen – HSV-Fans stürmten im Meisterschaftsrausch den Rasen und verursachten ein Gedränge, bei dem es 72 Verletzte gab –, antwortete Hoeneß auf die Reporterfrage nach seinen Erwartungen für die nächste Saison: »Wir wollen vielleicht ähnliche Feierlichkeiten haben wie der HSV.«
Die Aufgaben, die auf dem Weg dorthin bewältigt werden mussten, waren riesig. Es galt, dem Verein neue Einnahmequellen zu erschließen und für die neue Saison eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Der Job war Lust und Last zugleich. Einerseits machte es ihm enormen Spaß, seinen Ideen freien Lauf lassen und alle wichtigen Dinge selbst entscheiden zu können. Andererseits hatte er mit der ungeheuren Belastung, die auf ihn zukommen würde, nicht gerechnet. Schon nach drei Monaten fieberhafter Tätigkeit waren ihm erste Verschleißerscheinungen anzumerken. »Wenn er so weitermacht wie jetzt«, meinte ein besorgter Paul Breitner, »wird er keine dreißig.« Auch er, der seinen Freund noch wenige Monate zuvor als überqualifiziert für diesen Posten erachtet hatte, erkannte jetzt, dass die Tätigkeit eines Fußballmanagers hohe Ansprüche stellt. Manager in einem Verein zu sein, sollte Uli Hoeneß Jahre später resümieren, »ist ja mit das Höchste, was man sein kann. Der Präsident, okay«, meinte er mit Blick auf Beckenbauer, der dieses Amt im Jahr 1994 angetreten hatte, »aber der ist ja auch bei uns nicht so aktiv, wie er es in anderen Klubs vielleicht ist. Bei uns ist der Manager schon eine starke und wichtige Persönlichkeit, und auch von der Funktion her sehr wichtig. Insofern war das natürlich eine Sache, die nahe lag, denn ich wollte nicht Trainer werden. Ich wollte beim Fußball bleiben, und dann bleibt ja möglicherweise nicht viel anderes als der Manager.«
Uli Hoeneß wollte das ihm vertraute Terrain nicht verlassen. Es ist daher fraglich, ob er sich in einem reinen Wirtschaftsunternehmen wohlgefühlt hätte, wie er das immer behauptete. Der Fußball sei für ihn »auch immer ein Fluchtweg aus der Erwachsenenwelt« gewesen, gab er denn einmal sogar selbst zu. Er garantierte ihm eine Erlebniswelt, die er anderswo so nie hätte finden können. Auch wenn er nicht mehr selbst auf dem Rasen stand, sich nicht mehr nach einem Treffer von 80.000 Menschen umjubeln lassen konnte – als Manager war er ja immerhin am Spielfeldrand noch mit dabei und blieb im Zentrum des Interesses.
Und so ist Uli Hoeneß bis heute beim Fußball geblieben. Seit Freitag, den 27. November 2009, 22.04 Uhr, ist er allerdings nicht mehr in der Funktion des Managers tätig, sondern Präsident des Vereins FC Bayern München und Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG. Die Bayern waren zu diesem Zeitpunkt lediglich auf Rang sieben notiert. Man werde wieder besser werden, versprach er den Fans vor dem ohne Gegenkandidaten vollzogenen Wahlakt, und bald wieder zu Europas Spitze gehören. Es gab Applaus für den scheidenden Manager, dann ein Einspielfilmchen mit den wichtigsten Stationen seiner Karriere, die Schlusseinstellung zeigte ihn mit einem animierten, für die Bayern schlagenden Herz. Nach der Verkündung des Wahlergebnisses – er hatte 99,3 Prozent aller Stimmen der 4.490 anwesenden Bayern-Mitglieder erhalten – gab es stehende Ovationen.