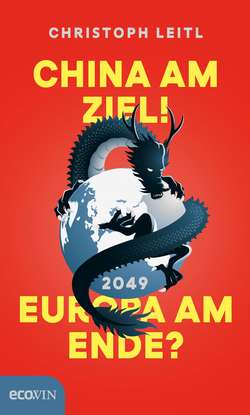Читать книгу China am Ziel! Europa am Ende? - Christoph Leitl - Страница 11
DER GOVERNANCE-BRUCH
ОглавлениеEine Studie hat kürzlich gezeigt, dass zwei Drittel unserer Welt diktatorisch oder autokratisch regiert werden und nur ein Drittel liberaldemokratisch.
Was hat dazu geführt, dass die scheinbar unaufhaltbare Verbreitung der Demokratie plötzlich ins Stocken geriet? Oder anders gefragt: Was macht die autokratischen Systeme so attraktiv, dass sie plötzlich den Trend der Zeit verkörpern?
Ist es die Unfähigkeit, in den Demokratien die Probleme der Zeit zu lösen? Die Autokraten bieten Lösungen, einfache Lösungen, zumeist verbunden mit Projektionen auf äußere Feinde.
Ist es der Mangel an großen Führungspersönlichkeiten in der Demokratie? Wie erbärmlich ist das Schauspiel der ältesten Demokratie der Welt, Großbritannien, im Zusammenhang mit dem Brexit?
Viele europäische Leader machen ihre Sache gut. Aber haben sie auch Kraft für Visionen, strahlen sie noch inneres Feuer aus, das Begeisterung entfacht? Brauchen wir gute und solide Verwalter oder Motivatoren für Zukunftsbilder der nächsten Generationen?
Populisten sind auf dem Vormarsch, und es scheint ihnen niemand etwas entgegenzusetzen. Verführerisch halten sie uns die süß duftende Giftflasche des Nationalismus entgegen.
Die Wiederkehr des nationalistischen Populismus kommt für viele überraschend. Ein Schlüssel dafür liegt in der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09. Sie brachte nicht nur ökonomische und soziale, sondern auch mentale Erschütterungen und Verwerfungen. Es war eine Vertrauenskrise: Anstelle von Vertrauen entstand Misstrauen, Misstrauen in die Politiker und Parteien, die offensichtlich mit den Veränderungen und den damit verbundenen Herausforderungen nicht fertig wurden. Aber auch Misstrauen in eine internationale Vernetzung, die man zunehmend als Abhängigkeit wahrnahm. Aus dem Wunsch nach globaler Kooperation wurde die Forderung nach nationalem Egoismus.
Die Krise war der Humus für Protestbewegungen, Globalisierungskritiker und Modernisierungsverlierer. Dazu kam das Unbehagen über die eigene verschlechterte Lage wegen der Sparmaßnahmen im Zuge der Budgetsanierungen, die der Finanzkrise folgten. Und was, wenn keine Budgetsanierung, wird nun der Coronakrise folgen? Wir kommen vom Regen in die Traufe!
Praktisch zeitgleich vergrößerte sich bedingt durch internationale Konflikte (wie etwa Syrien, Afghanistan) die Zahl der Asylbewerber und Migranten. Sie mussten nun als Sündenböcke für eigene Ängste herhalten – ein willkommenes Spiel für Populisten! Dazu kam die Furcht vor einer Islamisierung, die eben diese Populisten immer wieder in ihren Parolen weidlich ausnützten. Terroristische Anschläge in vielen Ländern Europas, die ihre Wurzeln in ungelösten internationalen Krisen politischer, sozialer und militärischer Art hatten, waren Wasser auf ihre Mühlen.
Flüchtlingswesen und Terrorismus sowie die damit verbundene Unsicherheit machten plötzlich ein Europa ohne Grenzen vom Segen zur Bedrohung. Man wollte – siehe Brexit – Entscheidungen und Kontrolle auf die nationale Ebene zurückholen.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise brachte es mit sich, dass etwa 20 Millionen Menschen in Europa ihren Job verloren und die Jugendarbeitslosigkeit zum Teil dramatisch anstieg.
Europäische Rettungsaktionen zur Sicherung der Gemeinschaftswährung Euro wurden als bloße Hilfestellung für schwächere Länder gesehen. Warum denen helfen, wo doch auch bei uns viele Menschen materielle Einbußen hinnehmen mussten?
Aber Europa hat nicht rational und souverän reagiert. Die Flüchtlingsfrage durch Zwangsquotenzuteilung lösen zu wollen, widerspricht dem Hausverstand. Integration kann man nicht verordnen, man muss dazu motivieren, Anreize setzen und deutlich machen, dass man Menschen mit Asylberechtigung nicht sich selbst überlässt, da man damit oft negative Folgen für die Gesellschaft auslöst. Eine Einbeziehung in die Arbeitswelt ist die wohl beste Möglichkeit dazu: den Betrieben eine Integrationsprämie aus den Überschüssen des Europäischen Sozialfonds zu bezahlen, sie dafür Integrationsarbeit leisten zu lassen und den betroffenen Menschen statt Arbeitslosigkeit samt Transferzahlungen Arbeit und Einkommen zu vermitteln, wäre eine Lösung. Leider hat diese Idee bisher noch keine Resonanz gefunden.
So entstand ein Paradoxon: Die Arbeit der Europäischen Union, die durch enges Zusammenstehen in der Finanz- und Wirtschaftskrise die Gemeinschaftswährung verteidigt und den rundum lauernden Spekulanten den Boden entzogen hat, hat nicht zu erhöhtem Gemeinschaftsbewusstsein, sondern vielmehr zum Rückfall in Partikularbewusstsein geführt. Die europäische Völkerfamilie hat nicht zusammengefunden, sondern ist auseinandergedriftet. Und wenn Großbritannien den Brexit als Erlösung von allem Übel und als Rückkehr zu vergangener Größe sieht, zeigt das die Irrationalitäten unserer Zeit.
Aber auch menschliche Proportionen scheinen immer mehr abhandenzukommen. Der Verlust von Augenmaß und Anstand wird immer deutlicher. Große Unternehmungen installierten schon Compliance-Abteilungen mit Hunderten von Beschäftigten, um keine Fehler zu machen, und werden zunehmend bürokratisch reguliert. Der Verlust von Eigeninitiative und Eigenverantwortung ist die Folge.
Wenn Manager zweistellige Millionenbeträge im Jahr verdienen, kann dies nicht mehr durch höhere Verantwortung oder bessere Leistung argumentiert werden. Schon gar nicht, wenn sie satte Boni erhalten, obwohl ihre Unternehmen massive Verluste eingefahren haben. So geschehen in einer großen deutschen Bank.
Gleichzeitig ist oft das Überhandnehmen der spekulativen gegenüber der realen Wirtschaft festzustellen – wer gebietet dem Einhalt?
Aufgelegte Betrügereien – Stichwort »Dieselgate« – unterminieren das Vertrauen in die Demokratie, weil sie dagegen machtlos ist, und in die soziale Marktwirtschaft, weil sie dem nicht entschieden genug entgegentritt. Wir höhlen damit unser Wertefundament aus. Und unsere Gesellschaft kippt aus dem Gleichgewicht.
Doch wer definiert, was wünschenswert ist? Wer definiert den Rahmen für internationale Konzerne und eine grenzenlose Finanzwirtschaft?
Die soziale Marktwirtschaft war ein perfektes Konzept, solange nationale Wirtschaft und nationale Politik in Verbindung waren. Freier Wettbewerb in einem sozialen Ordnungsrahmen war die Erfolgsformel in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.
Heute steht eine mehr oder minder national verbliebene Politik einer mehr oder minder global organisierten Wirtschaft gegenüber. Die Ohnmacht der Politik wird immer deutlicher sichtbar, das Vertrauen der Menschen in sie immer geringer.
Eine begrenzte Politik sieht sich mit einer entgrenzten Wirtschaft konfrontiert. Internationale Finanzhaie bedrohen Demokratie und soziale Marktwirtschaft.
Wir brauchen daher übernationale Agreements. Nicht nur bei uns in Europa, wir brauchen Lösungsplattformen weltweit. Aber die G 20, die zwanzig größten Volkswirtschaften der Welt und damit auch die politisch bedeutendsten, können sich einfach nicht dazu entschließen, Probleme gemeinsam zu lösen, die ein einzelnes Land allein nicht lösen kann. Das Klimaabkommen von Paris war ein gutes Beispiel internationaler Zusammenarbeit, bis es von einem Teilnehmer, den USA, mutwillig zerstört wurde. Einrichtungen wie die Internationale Arbeitsorganisation ILO oder die UNO können ebenfalls nicht wirklich konstruktive Beiträge leisten.
Wer steuert unseren Globus?
Ein Hoffnungsschimmer immerhin: Die G 7, die sieben größten Volkswirtschaften der Welt, haben sich auf ein gemeinsames weltweites faires Besteuerungssystem verständigt. Was daraus wird, bleibt jedoch abzuwarten. Realisten hegen keine allzu großen Hoffnungen.
Die Klimakrise, die Digitalisierung, Artificial Intelligence und dringend notwendige Rahmenbedingungen für neue Technologiefelder sowie die Abwehr finanzwirtschaftlicher Bedrohungen – diese Themen und andere Fragen sollten in internationalen Abkommen behandelt werden. Wie sehr zeigt uns die Coronakrise, dass internationale Kooperation, Information und gemeinsames Handeln missachtet und sträflich vernachlässigt worden sind. Eine vernetzte Welt ohne politische Netzsteuerung wirft sich selbst aus der Bahn.
Niemand soll sagen, das alles sei überraschend gekommen. Schon im Jahr 2015 hat Bill Gates gemeint, dass die wahrscheinlichsten Zukunftskrisen nicht von Raketen und Nuklearwaffen ausgehen, sondern von einem sich rasant über die Welt verbreitenden Virus. Er war damit nicht nur weitsichtig, sondern hat auch konkrete Vorschläge gemacht, wie dem durch Vorsorge entgegenzuwirken sei. »Bereitet euch vor auf die weltweite Epidemie!« Seine Worte verhallten. Hätten sie nicht durch die G20 aufgegriffen werden sollen?
Wir haben es in der Hand, auf die drängenden Probleme der Gegenwart eine Antwort zu geben. Wenn Europa im Kleinen zeigt, wie man mit Gemeinsamkeit erfolgreich ist, könnte dies ein Vorbild für die Welt sein und vielen Menschen Ängste nehmen. Das gilt auch für den Sicherheitsbereich. Denn religiöser Fundamentalismus, Terrorismus, atomare Bedrohung, Kündigung von Mittelstreckenraketenabkommen, Brandnester politischer Natur im Nahen Osten und vieles andere sind akute Gefahren für uns alle.
Und denken wir weiter – hinaus in den Weltraum: Wäre nicht auch hier eine globale Koordination notwendig? Mit Rahmenbedingungen, die das Weltall nicht nur zu einer Müllansammlung ausgedienter Satelliten oder zum neuen Rüstungsschauplatz machen? Die von reinen Wettläufen zu gemeinsamen Zielsetzungen führen könnten?
Noch einmal: Wer steuert unseren Globus? Wir schauen zu, während die Welt aus den Fugen gerät.