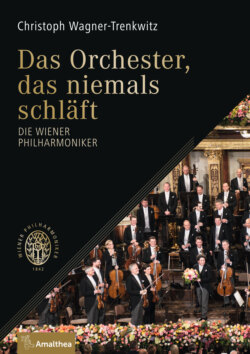Читать книгу Das Orchester, das niemals schläft - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAm 19. März 1843 nahm sich Nicolai der Neunten Beethoven an, eine Wiedergabe, die dank der 13 Proben, die für das anspruchsvolle Werk angesetzt waren, zu einer »Sternstunde«, ja gewissermaßen zu einer »zweiten Uraufführung« (Hellsberg) geriet. Drei Jahre vor der Aufführung der Neunten durch Richard Wagner in Dresden gelang den Philharmonikern der Beweis der Aufführbarkeit dieser Symphonie.
Neben den relativ raren selbst veranstalteten Philharmonischen Konzerten und dem täglichen Operndienst trat unser Orchester auch noch bei zahlreichen anderen Veranstaltungen, großteils im Kärntnertor-Theater, an. So dirigierte Hector Berlioz am 16. Dezember 1845 zum ersten und letzten Mal die Philharmoniker und urteilte, sie würden »vielleicht von anderen Orchestern erreicht, aber von keinem übertroffen«. Als der Komponist Félicien David mit seinem international gefeierten, in Wien nur mäßig erfolgreichen Orchesterwerk Die Wüste im Kärntnertor-Theater gastierte, musste sich unser Orchester von einer Zeitung ein Lob gefallen lassen, das auch einen Hauch von Tadel enthielt: Dieser »Körper« sei »alles zu leisten im Stande … wenn er nur will«. Wir müssen an einen von Vorstand Otto Strasser kolportierten Satz Wilhelm Furtwänglers denken, der ein knappes Jahrhundert später im Anschluss an ein Konzert in London meinte, »daß wir das beste Orchester der Welt seien – wenn wir wollten«.
In den 1840er-Jahren zählten Franz Liszt und Robert Schumann zu den Konzertdirigenten, während unter anderen Friedrich von Flotow, Conradin Kreutzer und Giacomo Meyerbeer persönlich ihre Opern am Kärntnertor-Theater leiteten – die Tuchfühlung mit den »Großen« der Branche herrschte für die Musiker des Wiener Orchesters also vom ersten Moment an.
Krise und Abschied
Beim achten Philharmonischen Konzert (30. März 1845) stand Beethovens Achte auf dem Programm – aber ein anderer als Nicolai am Dirigentenpult. Im Februar 1845 war der Musiker schwer erkrankt, doch das »undankbare Orchesterpersonal« (Nicolai), das schon seit Längerem kein ungetrübtes Verhältnis zu seinem gestrengen Chefdirigenten hatte, sagte das geplante Konzert nicht ab. Man betraute einen Musiker aus den eigenen Reihen mit der Leitung: Georg Hellmesberger, ein »Garant solider Mittelmäßigkeit« (Hellsberg). Bemerkenswert, wie sich Geschichte annähernd wiederholt: Als 1901 Gustav Mahler erkrankte, wurde das Konzert im März Joseph Hellmesberger, dem Enkel von Nicolais Orchesterdirektor, übertragen. Der gekränkte Mahler legte wenig später die Leitung der Konzerte zurück. Auch für Nicolai war die Ausbootung anno 1845 mit ein Grund, sein »Kind« zu verlassen. Nach zähen Kämpfen allerdings, und im vollen Bewusstsein, dass er der »Leiter des Besten, das Wien liefert«, gewesen war. Mag das Orchester seinem Gründer auch übel mitgespielt haben, so wird ihm doch bis heute mit den 1887 gegründeten, einmal jährlich stattfindenden »Nicolai-Konzerten« sowie der für besondere Verdienste um die Wiener Philharmoniker verliehenen »Nicolai-Medaille« ein ehrendes Andenken bewahrt.
Am 7. März 1847 dirigierte Nicolai sein elftes und letztes Philharmonisches Konzert mit Mozarts großer g-Moll-Symphonie, einer Meyerbeer-Ouvertüre und der Zweiten Beethoven. Vom Kärntnertor-Theater verabschiedete sich Nicolai wenig später mit dem »göttliche[n] Don Juan, mit dem ich auch vor 6 Jahren diese Stellung antrat«.
Nach Nicolai
In der Oper erlebte man zwar Sternstunden, so die Uraufführung von Flotows Martha am 25. November 1847 und (nach der revolutionsbedingten Schließung des Kärntnertor-Theaters 1848/49) die Erstaufführung von Meyerbeers Der Prophet unter der Leitung des Komponisten 1850, aber die Entwicklung des Philharmonischen Orchesters war in den auf Nicolai folgenden »elf mageren Jahren« (Hellsberg) mehr oder minder vom Stillstand betroffen.
Immerhin wirkten die Orchestermusiker unter der Bezeichnung »Gesellschaftsorchester der Musikfreunde« unter der Leitung von Joseph Hellmesberger, dem hervorragenden Geiger und Sohn Georgs, waren aber an einem »Tiefpunkt ihrer Geschichte« angelangt und auch finanziell »beinahe ausschließlich von der Oper abhängig« (Hellsberg). Dazu trug auch der ab 1853 amtierende, sehr zu willkürlichen Akten neigende Operndirektor Julius Cornet bei, der das Orchester geringschätzte und das Fehlen jeglicher Probenordnung weidlich ausnützte.
Ein Zusammenprall mit Cornet verdient es, wiedergegeben zu werden: Der Primgeiger Wilhelm Pauli wurde eines Tages von dem rabiaten Direktor auf der Bühne angetroffen und mit den Worten angeschnauzt: »Sehen Sie zu, dass Sie sich augenblicklich ins Orchester packen.« Der Angesprochene antwortete mit dem Götz-Zitat, worauf Cornet wutentbrannt auf den Regisseur Just zustürzte und rief: »Haben Sie gehört, was der freche Mensch gesagt hat?« – »Ja.« – »Was täten Sie?« – »Ich, ich täte es nicht«, sagte Just seelenruhig.
Mit dem Engagement des Opernkapellmeisters Carl Eckert begann 1853 eine Phase der Konsolidierung des philharmonischen Konzertwesens. Der Geiger Henri Vieuxtemps und die Pianistin Clara Schumann traten als Solisten auf, Liszt dirigierte das Orchester, und am 25. März 1855 (in einem Benefizkonzert für das Bürgerspital) kamen die Musiker erstmals in Berührung mit einer Schöpfung Richard Wagners, dem Vorspiel zum 3. Aufzug Lohengrin. Die Wiener Erstaufführung des kompletten Werkes fand erst im August 1858 am Kärntnertor-Theater statt.
Das Philharmonische Konzert am 1. März 1857 unter Eckert brachte mit der C-Dur-Symphonie (D 944) erstmals ein Werk Schuberts auf das Programm unseres Orchesters. Doch was eine Wiedergeburt hätte sein können, zeitigte keine positiven Folgen. Schwächen in Organisation und Werbung, vor allem aber die »zu geringe Identifikation der Musiker mit ihrem Unternehmen führten zum vorübergehenden Untergang der philharmonischen Idee« (Hellsberg); nur zehn Konzerte hatten in dem Jahrzehnt seit dem Abgang Nicolais stattgefunden.
Die »Wiedergeburt«
Immerhin war es Eckert, der ab 1858 als Operndirektor amtierte, noch gegeben, die »Wiedergeburt« der Philharmoniker zu initiieren. Am 14. Jänner 1860 zeigte das Kärntnertor-Theater Die lustigen Weiber von Windsor aus der Feder des bereits elf Jahre toten Philharmoniker-Gründers, und tags darauf bat man »um die Mittagsstunde« zum »Ersten Philharmonischen Abonnement-Concert, veranstaltet von den Orchester-Mitgliedern des k. k. Hofoperntheaters unter Leitung [von] Herrn Carl Eckert«. Der Kritiker Eduard Hanslick jubelte: »Von der ersten bis zur letzten Note ein Geist und eine Hand.« War die altbewährte Qualität wiederhergestellt, so bedeutete die Organisationsform eine radikale und für alle Zukunft taugliche Neuerung. Bislang waren die »Philharmonischen« einzeln zu bewerbende und zu verkaufende Veranstaltungen gewesen; das System des Abonnements (mit zunächst nur vier Aufführungen) schuf Vertrauen beim Publikum, das sich im engen Kärntnertor-Theater drängte, um »sein« Orchester in den Bühnenbildern der Abendvorstellung konzertieren zu sehen. Bald wurde die Zahl der Abo-Konzerte auf acht festgelegt, ab 1864 waren es neun. Diese Zahl hielt fast ein Jahrhundert: Erst 1961 wurde die Anzahl der jährlichen Konzerte mit zehn fixiert.