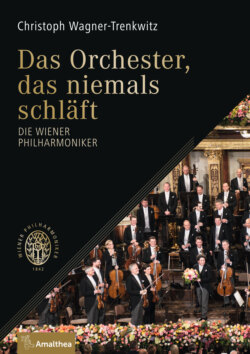Читать книгу Das Orchester, das niemals schläft - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNoch 1860 legte Eckert sein Amt aus Gesundheitsgründen zurück, Matteo Salvi wurde sein Nachfolger als Operndirektor. Den aus Sachsen stammenden, erst 25-jährigen neuen Opernkapellmeister Otto Dessoff wählte die Hauptversammlung der Philharmoniker zum Nachfolger als Orchesterchef – er blieb es segensreiche eineinhalb Jahrzehnte. »Dessoff hat die Grundmauern zu dem Gebäude gelegt, in dem spätere, vielleicht brillantere Dirigenten ein- und ausgingen«, so Herta und Kurt Blaukopf. »Man kann nicht gut der feinen Welt angehören, ohne eine Abonnementskarte zu den philharmonischen Konzerten in der Tasche zu tragen«, so gab die Zeitschrift Der Wanderer 1864 der Begeisterung für die Unternehmung Ausdruck.
Die Einführung der Abonnementkonzerte 1860 wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein als Gründungsmoment der Wiener Philharmoniker betrachtet. Erst 1942 entschloss man sich, die 100 Jahre seit der Gründung durch Otto Nicolai zu feiern. 1860 markierte übrigens auch die »Zeugung« eines Gebäudes, das für unser Orchester bis heute eine Heimat bildet: Es erfolgte die Architektenausschreibung für das neue Hofoperntheater, das neun Jahre später eröffnet wurde.
Richard Wagner und die Wiener Philharmoniker
Der wichtigste deutsche Opernkomponist, der den Philharmonikern erstmals 1861 begegnete, verdient einen ausgiebigeren Exkurs, der uns bis in die 1870er-Jahre führen wird.
Richard Wagner zu einer Zeit, als er nur mehr die Musik und nicht mehr die Politik revolutionieren wollte
Als Revolutionär hatte sich Richard Wagner exponiert und musste 1849 aus Dresden flüchten. Nun lebte er, immer noch persona non grata in Deutschland, im Schweizer Exil. Im Mai 1861 hörte Wagner erstmals das Wiener Opernorchester – und erstmals den eigenen Lohengrin. An seine Frau Minna Planer schrieb der Meister: »Zum ersten Mal in meinem mühe- und leidvollen Künstlerleben empfing ich einen vollständigen, allesversöhnenden Genuß«. Wenige Tage später folgte ein nicht minder umjubelter Fliegender Holländer, nach dem Wagner in einer Ansprache ankündigte, im Herbst nach Wien kommen zu wollen, um hier seine neue Oper einzustudieren: Tristan und Isolde. Nach 77 Proben und einer Erkrankung des Tenors Alois Ander verabschiedete man sich von dem kühnen Projekt einer Tristan-Uraufführung in Wien, der Komponist flüchtete hochverschuldet aus seiner Penzinger Villa. Das Jahrhundertwerk erblickte erst im Juni 1865 in München das Licht der Bühne.
Erwähnenswert ist eine Uraufführung am Kärntnertor-Theater, die zustande kam, ohne auf die erhoffte Resonanz zu stoßen. Im Februar 1864 gingen Jacques Offenbachs Rheinnixen in Szene, woraus der Franzose Jahre später die berühmteste Melodie in sein letztes Werk übernahm: die Barkarole in Hoffmanns Erzählungen.