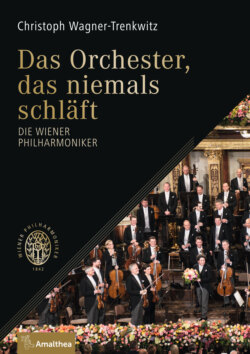Читать книгу Das Orchester, das niemals schläft - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеRichard Wagner mochte von den Opernbehörden enttäuscht gewesen sein, die für die Uraufführung seines Tristan nicht zu allen Opfern bereit gewesen waren; dem Wiener Orchester jedoch bewahrte er eine lebenslange Verbundenheit, die sich bereits in der Saison 1862/63 in mehreren epochalen »außerordentlichen« Konzerten manifestierte. Im Theater an der Wien erklangen nacheinander Ausschnitte aus dem Ring des Nibelungen und den Meistersingern von Nürnberg.
Im Mai 1872, knapp vor der Bayreuther Grundsteinlegung, gastierte der Meister wieder im Musikverein, lobte die Philharmoniker bei einer Probe als »das beste Orchester der Welt« und fügte hinzu: »Bei euch und mit euch Musik zu machen ist eine Lust!« Im Konzert am 12. Mai, das auch das Walküre-Finale beinhaltete, ergab sich ein besonderer Effekt: Als Wotan den Feuergott Loge herbeirief, brach ein lautstarkes Gewitter los.
Von Wagners Wien-Besuchen im März und Mai 1875 sind vielsagende Anekdoten überliefert. Zu einer Konzertprobe mit Bruchstücken aus Götterdämmerung kam die Hofopernsängerin Amalie Materna erschöpft von einer Probe der Goldmark’schen Königin von Saba. Als sie versuchte, sich der Probe mit halber Stimme zu entledigen, meinte Wagner: »Bitte nicht markieren! Goldmarkieren Sie in der Oper!« Beim Konzert war es abermals ausgerechnet ein jüdischer Konkurrent, der die künstlerischen Kräfte abzog. Als das frenetisch jubelnde Publikum eine Wiederholung des Trauermarsches aus Götterdämmerung erzwingen wollte, baten die Bläser den Dirigenten um Schonung, da sie abends noch Meyerbeers Afrikanerin in der Hofoper zu spielen hatten. Wagner erklärte dem Publikum die Situation und nannte das Opernwerk – ob irrtümlich oder in sarkastischer Absicht, muss dahingestellt bleiben – die »Amerikanerin«.
Am 2. März 1876 dirigierte Wagner das einzige Mal an der Hofoper – eine Benefizvorstellung seines Lohengrin. Dem Konzertmeister streute der Dichterkomponist Rosen (»Sie spielen das ja viel schöner, als ich es komponiert habe«), konnte sich als nicht geübter Kapellmeister aber auch auf einen »heimlichen« Subdirigenten verlassen, der so manchen »Schmiss« verhinderte. Niemand Geringerer als der Wagner ergebene Hofkapellmeister Hans Richter hatte an der Pauke Platz genommen und dirigierte an heiklen Stellen »mit dem Paukenschlägel, ohne daß es Wagner gewahr wurde«, wie Joseph Sulzer, Zeitzeuge in der Cellogruppe, berichtete.
Richard Wagner besuchte das Orchester nach 1876 nicht mehr, doch dieses reiste ihm nach: Ab den ersten Bayreuther Festspielen halfen über viele Jahre Musiker der Wiener Philharmoniker im Festspielorchester aus. Nicht alle waren Freunde des »Zukunftsmusikers« Wagner. Der Hofopernfagottist Wilhelm Krankenhagen etwa notierte in seine Götterdämmerung-Stimme:
Der Zukunft Musik dereinst oben
wird hoffentlich anders sein,
sonst möcht’ ich nach hiesigen Proben
nicht in den Himmel hinein.
Und Krankenhagens Parsifal-Stimme trägt die Verse:
Zwei Knaben gingen nach Bayreuth,
der eine dumm, der andre g’scheit.
Und als der Parsifal war um,
da war der G’scheite auch schon dumm.
Auch der Sekundgeiger Johann Czapauschek dürfte kein überzeugter Wagnerianer gewesen sein. Bei dem Geständnis Lohengrins im 1. Akt, »Elsa, ich liebe dich!«, notierte er in seine Stimme: »Hier empfiehlt Czapauschek Tusch in A-Dur und Ende der Oper!«
Lebende Komponisten und Denkmalpflege
Zurück in die 1860er-Jahre, in denen regelmäßig bedeutende Komponisten am Pult unseres Orchesters standen, so Max Bruch im Konzert oder Charles Gounod, der im Kärntnertor-Theater seine Oper Roméo et Juliette dirigierte. Auch konzertierte man mit gefeierten Solisten wie dem Pianisten Anton Rubinstein und dem Geiger Joseph Joachim.
1865 spielte das Opernorchester zugunsten der Errichtung eines Schubert-Denkmals (das Monument des Bildhauers Karl Kundmann ist noch heute im Wiener Stadtpark zu besichtigen), im Jahr darauf für ein Mozart-Denkmal, wobei im Großen Redoutensaal noch unveröffentlichte Kompositionen Rossinis erklangen, die der Meister zur Verfügung gestellt hatte. 1878 stellten sich die Philharmoniker schließlich in den Dienst eines weiteren Denkmalprojekts: Das Beethoven-Monument von Caspar von Zumbusch wurde 1880 an der Lothringerstraße, heute Beethoven-Platz, enthüllt, das Originalmodell der sitzenden Figur ist vis-à-vis im Wiener Konzerthaus zu sehen.
Der ab Oktober 1867 amtierende Operndirektor Franz von Dingelstedt setzte sich einerseits für die Erhöhung der immer noch mageren Orchestergagen ein, unternahm andererseits einen Versuch, die Philharmonischen Konzerte unter die Kontrolle der Hofopernverwaltung zu bringen. »Jede sich selbständig gebahrende und für ihre Privatzwecke arbeitende Körperschaft ist im Theater-Organismus eine Anomalie, die nicht geduldet, geschweige denn gehegt werden darf«, so Dingelstedt. Wenngleich mit der Vereinigung des Opern- mit dem Konzertbereich »wesentliche Diensterleichterungen verbunden« gewesen wären, »hätten die ›Philharmonische Idee‹ und damit die Philharmoniker aufgehört zu existieren« (Hellsberg). Das Orchester blockte diplomatisch ab, der neue Direktor beschloss, eine etwaige Reform »dem Zeitpunkt der Eröffnung des neuen Opernhauses« überlassen zu wollen – und dieser Moment stand unmittelbar bevor.
Das Opernhaus am Ring
Der Neubau löste keine Vorfreude aus. Die Pläne wurden verspottet, von einem »versunkenen Walfisch« und einem »Königgrätz der Baukunst« (in Anspielung auf die verheerende Niederlage der österreichischen Armee bei der Schlacht von Königgrätz 1866) war die Rede. Den beiden Architekten wurde böse nachgereimt: »Sicardsburg und van der Nüll, die haben beide keinen Styl«, und auch künstlerisch, so munkelte man, würde das neue Theater nicht entsprechen: Laut Blaukopf glaubte man genau zu wissen, »daß man im Innern des Hauses weder etwas sehen noch hören würde«.
Letztlich erwiesen sich die Unkenrufe als unbegründet, und das Wiener Publikum sollte das neue Haus bald ebenso lieb gewinnen, wie es das Kärntnertor-Theater gehabt hatte. Auf einen kapitalen Planungsfehler im Opernhaus weist Hellsberg hin: »Foyer und Garderoben für das Orchester waren vergessen worden«!
Doch gab es bereits im Vorfeld auch positive Entwicklungen: Im Herbst 1868 wurde angesichts der ungleich größeren Dimensionen des neuen Hauses und der erweiterten Ansprüche der modernen Opernliteratur eine Orchestervergrößerung bewilligt. Erstmals überschritt der Klangkörper die Grenze von 100 Musikern, 55 neue Streichinstrumente wurden angeschafft, das Streicherensemble wesentlich vergrößert. Zum ersten – aber beileibe nicht zum letzten Mal – sahen sich die Philharmoniker dem Problem gegenüber, dass zahlreiche neue Opernorchester-Mitglieder auch an die Töpfe des Konzertorchesters drängten, also den vollkommen gerechtfertigten Wunsch nach Beteiligung an den »freien« Einnahmen äußerten.
Nach wie vor fanden die »Philharmonischen« im alten Kärntnertor-Theater statt. Das Ersuchen des Orchesters an die Generalintendanz, das neue, am 25. Mai 1869 eröffnete Opernhaus für die Abhaltung der »Philharmonischen« zur Verfügung zu stellen, wurde abschlägig beschieden, da dieses Gebäude »grundsätzlich zu keiner […] Privatinteressen fördernden Vorstellung vergeben werden darf«. Dingelstedt engagierte mit Johann Herbeck einen neuen Kapellmeister und zwang das Orchester, vorübergehend mit sich selbst in Konkurrenz zu treten. Herbeck, seit 1859 Leiter der Gesellschaftskonzerte des Musikvereins, hatte die 1860 wiederbelebten Philharmoniker-Konzerte schon lange als Konkurrenz angesehen; nun leitete er ab Anfang November 1869 Konzerte im Opernhaus zugunsten des Hoftheaterpensionsfonds.
Eine Woche später dirigierte Otto Dessoff im Kärntnertor-Theater ein »Philharmonisches«, das sich zum Triumph auswuchs: »Das zahlreiche, alle Räume des Kärntnerthor-Theaters füllende Auditorium und der nach jeder Nummer laut ausbrechende Beifall sollten zweifelnde Gemüter darüber beruhigt haben, ob die Beliebtheit der Philharmonie-Konzerte durch andere, neue Konzert-Unternehmungen gefährdet sei«, meldete die Neue Freie Presse.
Als das Kärntnertor-Theater zum Abriss freigegeben wurde, schien sich die Situation wieder zuzuspitzen: Am 17. April 1870 fand mit Rossinis Wilhelm Tell die letzte Aufführung im alten Opernhaus statt, im Juni mussten die Orchestermitglieder binnen 14 Tagen ihre Instrumente abholen. Wohin mit den traditionsreichen, vom Wiener Publikum über die Maßen geschätzten Konzerten, denen das neue Opernhaus verschlossen blieb?
Die Antwort auf diese Frage führt uns in einen neuen Abschnitt der philharmonischen Geschichte.
*Die Funktion des »[Orchester-]Directors« entspricht jener eines Konzertmeisters.