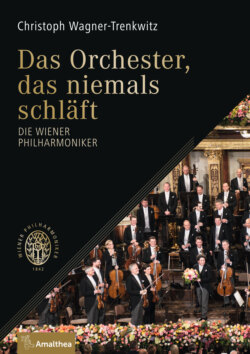Читать книгу Das Orchester, das niemals schläft - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie »Goldene Ära« …
… begann im Goldenen Saal (1870–1897)
Der Beginn des »Goldenen Zeitalters« wird für unser Orchester üblicherweise mit dem Jahr 1875, dem Amtsantritt Hans Richters als Abonnementdirigent, angesetzt. Obwohl Hellsberg diesen Standpunkt teilt, stellt er die rhetorische Frage: »Hat dieses Orchester überhaupt existiert, bevor es das Musikvereinsgebäude gab?«, um zu konstatieren, dass »die Weltgeltung der Philharmoniker in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts begann«. Der ideale Saal sorgte nämlich für »die volle Entfaltung ihres Klangpotentials« und prägte das philharmonische Musizieren nachhaltig. Die reiche Innenraumgestaltung ermöglicht die etwa zwei Sekunden dauernde Nachhallzeit und begünstigt den an tiefen Frequenzen reichen »warmen« Klang. Auch die ökonomische Stabilisierung des Unternehmens ist erwähnenswert: Innerhalb weniger Jahre, vom letzten Konzert im Kärntnertor-Theater 1870 bis zur Saison 1874/75, verdoppelten sich die Einnahmen, was uns wohl zusätzlich berechtigt, den Beginn der Goldenen Ära mit dem Einzug in den Goldenen Saal 1870 anzusetzen. Hier haben die Philharmoniker bis zum heutigen Tage – und hoffentlich auch in aller Zukunft – ihre Heimstatt gefunden.
Bereits im Herbst 1869 übersiedelte das Konservatorium in die Räumlichkeiten des neuen Baus am Karlsplatz, im Jänner öffneten die Konzertsäle. Die Idee der Gesellschaft der Musikfreunde war es zunächst, das Gesellschaftsorchester mit den Philharmonikern zu fusionieren, doch auch dieser Auflösungsplan wurde nicht in die Tat umgesetzt. Unser Orchester ließ sich nur zu dem Zugeständnis bewegen, Musiker zu den Gesellschaftskonzerten zu entsenden. Am Sonntag, dem 13. November 1870 war es dann so weit: das »1. Abonnement-Concert, veranstaltet von den Mitgliedern des k. k. Hof-Opern-Orchesters« (sie nannten sich noch immer nicht »Philharmoniker«!) fand im »Grossen Saale« statt, Werke von Weber, Beethoven und Schumann standen auf dem Programm.
Abonnementdirigent Otto Dessoff, der hauptberuflich weiterhin Dienst am Opernhaus versah, ermöglichte zu Beginn der 1870er-Jahre auch Gastspiele internationaler Dirigenten bei den »Philharmonischen«, unter anderen Hans von Bülows und Richard Wagners. Am 29. Dezember 1872 leitete Dessoff sein 100. Abonnementkonzert, und wenige Tage zuvor hatte Kaiser Franz Joseph ein »Pensions-Institut des k. k. Hofoperntheaters« genehmigt. Am 22. April 1873 fand der erste Opernball statt – allerdings nicht im Haus am Ring, sondern im Wiener Musikverein. Johann Strauß Sohn leitete zu diesem Anlass – natürlich mit der Geige in der Hand – die Uraufführung seines Walzers Wiener Blut. Schon wenige Monate später, im November 1873, dirigierte Strauß bei einem Musikvereins-Festkonzert im Rahmen der Weltausstellung An der schönen blauen Donau. Wer heute den Donauwalzer als Zugabe beim Neujahrskonzert genießt, möge daran denken, dass der Komponist selbst eine der frühen Wiedergaben dieser »heimlichen Hymne« Österreichs mit den Philharmonikern geleitet hat. Ermöglicht wurde dieses Konzert übrigens durch eine großzügige Spende der chinesischen Weltausstellungskommission – ein Jahrhundert sollte vergehen, bis die Philharmoniker China bereisten!
Am 26. Oktober 1873 leitete Anton Bruckner zum ersten und letzten Mal ein Konzert unseres Orchesters, und zwar mit der Uraufführung seiner 2. Symphonie. Fürst Johann II. von und zu Liechtenstein hatte die Mittel für ein Sonderkonzert zur Verfügung gestellt. Arthur Nikisch, vorübergehend Primgeiger des Hofopernorchesters, erinnerte sich, »wie Bruckner ans Pult trat und zu uns sagte: ›Alsdann, meine Herren, wir können probieren, so lang wir wollen, i’ hab an, der’s zahlt.« Bruckner, aufs Höchste begeistert vom Erfolg (nach jedem Symphonie-Satz applaudierte das Publikum stürmisch, was damals noch »erlaubt« war!), fragte bei der Musikervereinigung schriftlich an: »Darf ich das Werk Ihnen dedizieren?« Es gehört zu den dunklen Punkten in der Geschichte unseres Orchesters, dass sie den Komponisten, dessen Hochachtung keineswegs erwidert wurde, zwei Jahre keiner Antwort würdigten …
Parallel zu den philharmonischen Höhepunkten – so traten Franz Liszt und Johannes Brahms mit dem Orchester auf – ereigneten sich auch an der Oper historische Vorstellungen. Am 29. April 1874 wurde Giuseppe Verdis Aida erstmals aufgeführt. Bei einer Probe entlud sich die Spannung zwischen dem Dirigenten Dessoff und seinem Direktor Herbeck, der rief: »Die dritte Flöte fehlt, hören Sie das nicht, Herr Kapellmeister?« Darauf Dessoff: »Die dritte Flöte fehlt, sehen Sie das nicht, Herr Direktor?«
Weil er seine Operngage als ungenügend betrachtete, verließ Dessoff Wien 1875 nach 15 Jahren mit einer Serie von triumphalen Philharmonischen Konzerten, und auch sein Widersacher Herbeck trat, »moralisch und körperlich halb zugrunde gerichtet«, ab.
Innerhalb weniger Wochen konzertierte unser Orchester im Frühjahr 1875 unter der Leitung der beiden überragenden Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts. Nachdem Wagner drei umjubelte Konzerte gegeben hatte, erschien Giuseppe Verdi, um im Juni seine Messa da Requiem sowie Aida einzustudieren und zu leiten. Der Italiener dirigierte zwar kein »Philharmonisches«, hinterließ beim Besuch des Konservatoriums im Musikverein aber ein doppeltes, dauerhaftes Kompliment: »Bei einer solchen Schule wird Wien noch lange das erste Orchester der Welt haben.« Hellsberg resümiert die Visiten Wagners und Verdis, aber auch die Gastauftritte unter anderen von Brahms (von dem noch die Rede sein wird) und Bruckner so: »Die bestandenen Bewährungsproben als Partner großer Komponisten weckten jenes Traditionsbewußtsein, das dem Selbstverständnis der Wiener Philharmoniker eine neue Dimension verlieh.«
Ein neuer Direktor, ein neuer Chefdirigent
Am 1. Mai 1875 trat ein neuer Hofoperndirektor an: Franz Jauner zögerte nicht, den Philharmonikern die Hofoper für die Abhaltung ihrer Konzerte anzutragen. Auf dieses Angebot ist unser Orchester (mit einigen außerordentlichen Ausnahmen zu Ende des 20. Jahrhunderts) nie zurückgekommen, »die räumliche Trennung von Opernpflichten und Konzert-Unternehmertum war endgültig« (Blaukopf).
Gemeinsam mit Jauner kam auch ein 32-jähriger neuer Kapellmeister, dem weder die Oper noch ihr Orchester neu waren. Hans Richter war geborener Österreicher und ehemaliger Hornist im Wiener Orchester. 1866 hatte er seinen Posten aufgegeben, um für Richard Wagner die Meistersinger Partitur zu kopieren. Die enge Beziehung zum Meister hielt lebenslang: Richter war der Trauzeuge Richards und Cosimas, leitete 1876 in Bayreuth die Uraufführung des Ring des Nibelungen und wenig später dessen Erstaufführung an der Wiener Hofoper. 1916 starb er in Bayreuth und liegt dort auch begraben. Richter war nicht nur der führende Wagner-Dirigent seiner Zeit, er blieb auch für ein Vierteljahrhundert (mit einer kurzen Unterbrechung) Leiter der Philharmonischen Konzerte.
Als ehemaliger Kollege genoss Richter nicht den Status des abgehobenen »Pultmagiers«, sondern des primus inter pares, wie später auch Arthur Nikisch, der drei Jahre als Geiger im Orchester zugebracht hatte, oder Willi Boskovsky, der als amtierender Konzertmeister 25-mal das Neujahrskonzert leitete.
Im letzten Brief an »sein« Orchester (das er schon lange verlassen hatte, um in England eine lukrative Karriere zu machen) schrieb Hans Richter im April 1913, er müsse »dankbar anerkennen, daß ich vom Orchester gelernt habe, wie man dirigieren soll. Natürlich muß es ein Orchester sein, so vortrefflich wie die Wiener Philharmoniker; im Verkehr mit einem solchen lernt man erst, was man als Dirigent wagen kann.«
Die Entwicklung des Repertoires
In den 1840ern dominierte in der Programmgestaltung unseres Orchesters die Wiener Klassik, allen voran Beethoven, von dem 60% der gespielten Werke stammten. Weder Johann Sebastian Bach war im Repertoire jener Jahre vertreten, noch Franz Schubert, der erst 1857 mit der großen C-Dur-Symphonie »debütierte«. Seine eigenen Werke hat Otto Nicolai eher selten gespielt. Dagegen finden wir »Stars« der Komponistenszene des 19. Jahrhunderts wie Cherubini, später Meyerbeer, Goldmark oder Rubinstein, die heute fast vergessen sind.
Die »Feindschaft« der Philharmoniker gegenüber »modernen« Komponisten ist jedenfalls ein Gerücht; bei den 120 Abo-Konzerten der Ära Dessoff (1860–1875) waren 208 der 265 gespielten Werke Novitäten. Diese wurden in sogenannten »Novitätenproben« durchgespielt und dann einer Abstimmung unterzogen. Vereinzelt wurden neue Werke auch »per acclamationem«, also durch einhellige Beifallsbekundung angenommen, so 1865 die Sakuntala-Ouvertüre von Karl Goldmark. Dass andererseits Werke von Brahms und Bruckner durch den Rost fielen, mag man vom heutigen Standpunkt belächeln. In seiner ersten Komiteesitzung als Vorsitzender, am 4. Juni 1875, monierte Hans Richter, dass Hector Berlioz und Liszt zu wenig gepflegt wurden; des Ersteren Symphonie fantastique hatte 1862 erstmals aufs Programm gefunden, während Liszt im Jänner 1874 mit den Philharmonikern zum letzten Male konzertiert hatte (der gefeierte Pianist interpretierte seine Ungarische Rhapsodie und die von ihm orchestrierte Wanderer-Fantasie Schuberts). Doch der heute gültige Repertoire-Kanon war im 19. Jahrhundert, als die Werke brandneu waren, noch Gegenstand von Fehden und Feindschaften.
Der Dirigent Hans Richter dominierte die Goldene Ära.
Nehmen wir den heute unumstrittenen Peter I. Tschaikowsky als Beispiel: Erstmals erklang 1876 in einem »Philharmonischen« ein Werk von ihm, die Ouvertüre zu Romeo und Julia. Fünf Jahre später kam es zu einer bemerkenswerten, von Publikum und Kritik jedoch abgelehnten Tschaikowsky-Uraufführung: Adolf Brodzky, der vorübergehend Geiger im Wiener Philharmonischen Orchester gewesen war, dann aber die Solistenkarriere eingeschlagen hatte, hob am 4. Dezember 1881 das Violinkonzert aus der Taufe. Der bis heute hoch angesehene Kritiker Eduard Hanslick bewies nach seiner Ablehnung der Werke Wagners und Bruckners erneut seine Beschränktheit und reihte das Werk unter die »Musikstücke, die man stinken hört«. Endgültige Anerkennung errang der Russe erst postum, mit der Wiener Erstaufführung seiner 6. Symphonie (Pathétique) im März 1895.