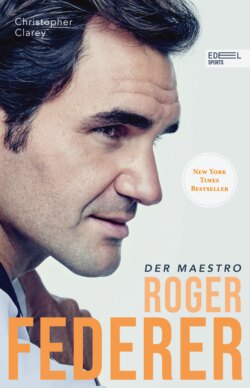Читать книгу Roger Federer - Christopher Clarey - Страница 7
Kapitel 3 ECUBLENS, SCHWEIZ
Оглавление„Arrête, Roger. Hör auf!“
Der Franzose Christophe Freyss war Trainer am nationalen Leistungszentrum von Swiss Tennis und forderte Roger Federer lautstark auf, seinen Tennisball nicht länger gegen einen Behälter zu schlagen.
„Das machte so viel Krach, wir konnten uns kaum konzentrieren“, sagte Freyss.
Der impulsive Teenager Federer war voller Energie. Er folgte der Bitte, allerdings nicht lange.
„Er hörte zwar auf, aber nach vielleicht fünf Minuten griff er sich seinen Schläger und fing wieder an“, erzählte Freyss. „Und ich rief: ‚Schluss jetzt, Roger!‘“
Federer, damals 14 Jahre alt, ging nun in Ecublens, einem Vorort von Lausanne am Genfer See, in die Schule. Auch wenn er sich hier immer noch in seiner Heimat Schweiz befand, galt er als deutschsprachiger Basler eher als Außenseiter. Weil in Lausanne Französisch gesprochen wird, hatte Federer, als er im August 1995 hier eintraf, ein Problem.
„Er konnte vielleicht bonjour, merci und au revoir sagen, aber darüber hinaus waren seine Französischkenntnisse gleich null“, sagte Yves Allegro, ein Mitschüler und früherer Kollege im Schweizer Davis-Cup-Team.
Federer wohnte bei der französischsprachigen Familie Christinet und besuchte die Sekundarschule, das Collège de la Planta, wo die Unterrichtssprache Französisch war. Eine steile Lernkurve und für Federer eine emotionale Achterbahnfahrt.
Als einer der jüngeren Schüler am nationalen Leistungszentrum trainierte Federer nachmittags, während die älteren Schüler ihre Trainingseinheit von zehn bis zwölf Uhr absolvierten. An diesem Tag hatte sein Schulunterricht schon um elf Uhr geendet, sodass Roger im Zentrum auftauchte, während die ältere Gruppe noch trainierte.
„Roger war ein nervöses Energiebündel, ich wusste das. Ich gab ihm den Auftrag, seine Hausaufgaben zu machen“, so Freyss. „Doch das war aussichtslos. Und voilà, schon fing er wieder an, den Ball zu schlagen.“
Nach zweifacher Verwarnung heckten Freyss und seine Schüler einen Plan aus. Wenn Federer ein drittes Mal zurückkommen sollte, wollten sie ihm eine Lehre erteilen.
„Ich war mir fast sicher, dass es passieren würde“, sagte Freyss. „Er konnte einfach nicht stillsitzen.“
Tatsächlich kehrte Federer zurück, und diesmal stürzten sich Freyss und die Spieler auf ihn und trugen ihn hoch zur Umkleide, wo sie so taten, als würden sie ihn in voller Montur unter die Dusche stellen.
„Wir hatten es nicht ernsthaft vor, aber er sollte es schon glauben“, sagte Freyss. „Ich stellte sogar die Dusche an. Dabei beließen wir es dann. Ich bin mir sicher, dass dieser Schreckmoment bei ihm haften blieb.“
Federer erinnerte sich tatsächlich daran. Es war eine turbulente, anstrengende Zeit für ihn.
„Ich war der kleine Deutschschweizer, den alle veräppelten“, sagte er. „Ich sehnte immer das Wochenende herbei, wenn ich wieder im Zug nach Basel sitzen konnte.“
Doch der Umzug nach Ecublens war ja freiwillig. Dafür hatte er nicht nur sein Elternhaus zurückgelassen, sondern auch seinen Coach Peter Carter, den Club Old Boys und seine Komfortzone, alles mit dem Ziel, sein Tennisspiel auf ein höheres Niveau zu bringen.
„Wir wollten, dass Roger selbst die Entscheidung traf“, erzählte mir Lynette Federer. „Unsere Rolle war ausschließlich unterstützend, und ich glaube, das war ein wichtiger Grund dafür, dass er durchhielt: Es war seine eigene Entscheidung.“
Wie Federer heute betont, bereut er nichts. Im Gegenteil. Er betrachtet die beiden Jahre, die er in Ecublens verbrachte, als wesentlich für seinen Reifungsprozess und als entscheidend für seinen späteren Erfolg: „Von heute aus betrachtet würde ich sagen, dass es vermutlich die beiden einflussreichsten Jahre meines Lebens waren.“
Wenn er jüngeren Spielern einen Rat gibt, empfiehlt er unter anderem, die eigene Stadt eine Zeit lang zu verlassen, um Selbstvertrauen zu entwickeln – dieser Aspekt ist in einem von hartem Wettbewerb geprägten Individualsport ganz wesentlich. Sich selbst zu vertrauen kann hier ebenso wichtig sein, wie seiner Vorhand zu vertrauen.
Anders als viele andere große Tennisspieler musste Federer bestimmte Hürden nicht nehmen. Er musste nicht wie Maria Sharapova im Alter von sechs Jahren einen Ozean überqueren, um dem fragwürdigen Ehrgeiz ihres Vaters in den Tennisakademien von Florida nachzukommen. Auch musste er nicht unter Kriegsbedingungen nach Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten suchen, wie etwa Novak Djokovic.
Betrachtet man Ecublens durch die Linse von Federers Mittelklasse-Existenz, dann war es trotzdem zumindest unbequem für ihn. Selbst auferlegt und minderschwer, aber dennoch unbequem. Doch Ecublens hatte großen Anteil an seiner Entwicklung, sowohl in persönlicher als auch in spielerischer Hinsicht.
„Zu Hause war ich der Favorit, der Champion, aber in Ecublens war ich umgeben von Champions, und damit konnte ich nur schwer umgehen“, sagte er. „Meine Gastfamilie war sehr nett, aber es war eben nicht meine eigene Familie. Nach drei Monaten war ich wirklich unsicher, ob ich bleiben sollte. Aber ich zog es durch, und das war richtig.“
Mehr als 20 Jahre später sind das Leistungszentrum in Ecublens und der kleine Club, an den es angebunden war, längst Geschichte. Wo sich früher acht Tennisplätze, die winzige Sporthalle und die angrenzende Laufbahn befanden, stehen heute Mietshäuser.
Es ist nicht der einzige Eckpunkt in Federers Karriere, der verschwunden ist. Der Ciba-Club, sein erster Spielort in Basel, wurde durch eine Seniorenresidenz und einen öffentlichen Park ersetzt. Federer veröffentlicht oft Videobotschaften, und kurz vor dem Abriss 2012 schickte er anlässlich der Abschiedsfeier eine Botschaft an die Clubmitglieder von Ciba, in der er seine Erinnerungen an frühere Wettkämpfe und Grillfeste schildert.
Seine Gefühle gegenüber Ecublens waren zwar ambivalent, trotzdem wog der Verlust schwer. „Dieser Ort hat in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt.“
Anderen, die dort trainierten, ging es ebenso.
„Nichts ist geblieben, es bricht mir das Herz“, sagte Manuela Maleeva, die als weiblicher Topstar Platz drei der Weltrangliste erreichte.
„Es fällt mir jedes Mal schwer“, sagte auch Allegro. „Ich komme da vielleicht einmal jährlich vorbei und fahre bewusst hin, es gehörte doch zu unserer Jugend. Es schmerzt immer noch zu sehen, dass das Tenniszentrum nicht mehr da ist.“
In Ecublens deutet heute zwar nichts mehr darauf hin, doch die Jahre hier hatten großen Einfluss auf Federer.
Da ist zunächst sein fließendes Französisch. Die Sprache hat seinen Blick geweitet, sein soziales Netzwerk vergrößert und allgemein seine Attraktivität gesteigert, sowohl international als auch in seiner polyglotten Heimat.
„Ich glaube, dass es für die französischsprachige Schweiz wirklich wichtig ist und dort auch geschätzt wird, denn viele Deutschschweizer sprechen nicht gut Französisch“, erzählte mir die schottischstämmige Schweizer Autorin Margaret Oertig-Davidson. „Die Menschen in der deutschsprachigen Schweiz lernen meist viel besser Englisch als Französisch zu sprechen, deshalb ist man sehr dankbar dafür, dass Roger ein Französisch spricht, das nicht hässlich klingt.“
Das Erbe von Ecublens manifestiert sich auch in den vielen Freundschaften, die Federer mit Spielern wie Allegro, Lorenzo Manta, Ivo Heuberger, Alexandre Strambini und Severin Lüthi geschlossen hat. Letzterer wurde lange unterschätzt, gehörte aber später zum inneren Kreis Federers und zu seinem Trainerstab.
In Ecublens entwickelte Federer seine Vorliebe für Hallentennis. Auf den vier Hallenplätzen in Ecublens, die in den kühleren Monaten vornehmlich genutzt wurden, sprang der Ball niedrig auf, und sie waren schnell. „Blitzschnell“, sagte Federer.
Ecublens legte auch den Grundstein für die tiefe Verbindung Federers mit einem viel älteren Mann, der nie Wettkampftennis spielte, aber wesentlich, vielleicht sogar entscheidend für Federers langanhaltenden Erfolg verantwortlich war.
Pierre Paganini ist Federers Konditionstrainer. Er traf Federer 1995 in Ecublens und stieß 2000 zu seinem Betreuerstab, was ihn zu dem mit Abstand langjährigsten Teammitglied macht.
Er half Federer, bis weit in seine Karriere hinein verletzungsfrei zu bleiben und sich seine Schnelligkeit und Wendigkeit durch ein innovatives Sportprogramm zu bewahren. Dabei ist der frühere Zehnkämpfer Paganini, der die Übungen und das Lauftraining gern gemeinsam mit seinen Sportlern durchführt, weit mehr als ein cleverer und topfitter Antreiber. Er ist Federers Feedbackgeber, gelegentlicher spiritueller Lotse und letzte Instanz, wenn es um Terminpläne geht – jemand, der dezent, aber mit Überzeugung für Hingabe und Mäßigung wirbt.
Von Beginn an betrachtete Paganini Federers Gesundheit und Entwicklung mit langfristiger Perspektive, er besaß das Selbstvertrauen und die Glaubwürdigkeit, um ihm bei der Umsetzung zu helfen.
Seine Hauptbotschaft lautete von Anfang an: Es braucht harte und beständige Arbeit, aber ebenso Erholung und Abstand, wenn Federer dauerhaft in einer Sportart bestehen wollte, die von monotonen Rhythmen und Mustern geprägt ist. Gesunde Beine sind ein Muss, ein klarer Kopf ebenso.
„Paganini ist die wichtigste Person in Federers Karriere“, sagte Günter Bresnik, ein altgedienter österreichischer Coach.
Das ist eine kühne Behauptung, aber Bresnik ist nicht der Einzige, der Paganini für so einflussreich hält.
„Aus meiner Sicht ist Mirka die Nummer eins und Pierre die Nummer zwei“, meinte Allegro. „Bei wichtigen Entscheidungen war Pierre dabei, denn ich glaube, dass er immer das große Ganze sah. Roger vertraut ihm blind.“
Stan Wawrinka, der andere Schweizer Starspieler, der mehr als ein Jahrzehnt mit Paganini trainierte, hat einmal geäußert, dass er ihm mehr verdanke als irgendeinem anderen in seiner Karriere.
Federer zögert, sich öffentlich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ihn haben so viele Menschen beeinflusst, und er ist zu diplomatisch, um den einen über die anderen zu stellen. Klar ist jedoch, dass Paganini zu seiner engeren oder vielmehr engsten Auswahl gehört.
„Wenn ich heute hier stehe, dann hat Pierre auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu beigetragen“, merkte Federer in seiner späten Karriere mir gegenüber an.
Es ist eine enge Arbeitsbeziehung, die sich mit der Zeit nicht verbraucht hat, sondern ergiebiger geworden ist.
„Bei ihm macht das Konditionstraining so viel Spaß, wie ein Konditionstraining überhaupt machen kann“, so Federer. „Ich folge einfach seinem Rhythmus. Was er sagt, tue ich, denn ich vertraue ihm. Manche fragen mich, ob ich mich ärztlich untersuchen lasse und so. Brauche ich nicht, denn ich arbeite mit Pierre, er weiß und erkennt, ob ich mich gut bewege oder nicht, ob ich langsam oder schnell bin und so weiter. Ihm gehört ein großer Teil dieses Erfolgs, und ich bin froh, dass ich ihn damals angerufen habe.“
Bresnik gehört zu den Vordenkern des Tennis, er ist seit mehr als 30 Jahren Trainer. Er kennt Federer seit Mitte der 90er-Jahre und traf auf Paganini schon, als er noch den Schweizer Spieler Jakob Hlasek trainierte.
Bresnik lud Paganini eines Tages nach Wien ein, wo er ihn um eine Einschätzung seines jungen Starschülers Dominic Thiem bat. Fand er Thiem schnell und fit genug, um auf der Tour zu bestehen?
Die Antwort lautete: Ja. Thiem entwickelte sich in der Folge zu einem Grand-Slam-Champion, der sowohl Federer mehrmals schlug als auch die anderen beiden der „Großen Drei“, Nadal und Novak Djokovic.
Bresnik bewundert Paganinis Hingabe und Intuition – und auch seine Diskretion, denn viele Spieler, so auch Federer, reagieren gereizt, wenn man sie nach ihren Methoden befragt.
„Paganini ist ein heller Kopf, der kein Bedürfnis hat, sich zu exponieren“, so Bresnik. „Er hält sich immer im Hintergrund. Federer steht in der ersten Reihe, aber der Kopf dahinter war in den letzten rund 20 Jahren Paganini.“
Auch Federer schätzt Diskretion – schließlich ist er Schweizer.
Mit seiner Drahtgestellbrille wirkt Paganini äußerlich eher wie ein Gelehrter. Er stammt auch nicht aus einer Sportlerfamilie; beide Eltern waren Musiker und Pädagogen. Trotz des Namens besteht keine Verwandtschaft mit dem italienischen Virtuosen Niccolò Paganini, der im 19. Jahrhundert als „Teufelsgeiger“ bekannt war, denn um so vollendet spielen zu können, musste er wohl seine Seele verkauft haben.
Pierre Paganini, 1957 in Zürich geboren, spielte in seiner Jugend ebenfalls Geige, war aber von Kindesbeinen an vor allem sportbegeistert. Er spielte Fußball und nahm an Leichtathletik-Wettkämpfen teil. Besonders angetan hatte es ihm der Zehnkampf, ein echter Ausdauertest aus zehn Disziplinen und damit die arbeitsintensivste aller Sportarten überhaupt.
Doch Paganini merkte früh, dass er vor allem hinter den Kulissen wirken wollte. Als er 1966 die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgte, interessierte ihn weniger das Geschehen auf dem Platz als vielmehr, was die Spieler wohl abseits des Platzes taten.
„Ich war acht Jahre alt und wollte unbedingt wissen, was in der Umkleide passierte, was der Trainer wohl zu den Spielern sagte, wenn die Kameras nicht dabei waren“, erklärte er 2011 in einem Interview mit der Schweizer Tageszeitung 24 Heures. „Schon in dem Alter faszinierte mich die unsichtbare Seite des Ganzen. In meinem Job arbeiten wir oft ohne Publikum, und das schätze ich sehr.“
Er wusste lange vorher, dass er Konditionstrainer werden wollte, doch da er die Arbeitsmarktchancen nicht beurteilen konnte, ging er auf Nummer sicher: Er machte einen Abschluss als Diplomkaufmann und besuchte eine Zeit lang eine Schweizer Hotelfachschule. Schließlich folgte er seiner inneren Stimme und absolvierte eine Trainerausbildung an der Eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen, der einzigen Schweizer Hochschule ausschließlich für den Bereich Sport. Sein Lehrmeister war Jean-Pierre Egger, ein ehemaliger Schweizer Kugelstoßer, der als Trainer Werner Günthör und Valerie Adams zu Weltmeistertiteln und Olympiamedaillen im Kugelstoßen verhalf, aber auch in anderen Sportarten aktiv war, darunter Ringen, Segeln und Ski alpin. Im Jahr 2020 wurde Egger bei der Verleihung der nationalen Sportauszeichnungen zum besten Schweizer Trainer der letzten 70 Jahre gekürt. Egger zeigte Paganini, wie wichtig es ist, Konditionsübungen auf die spezifischen Bedürfnisse eines Sports abzustimmen.
Paganini erhielt 1985 sein Diplom und hatte eigentlich vor, Fußballer zu coachen. Stattdessen bot man ihm eine Stelle am Tennis-Leistungszentrum in Ecublens an, obwohl er selbst kein Tennis spielte. Zu Beginn hatte er nur einen Teilzeitjob, weshalb er zusätzlich als Lehrer an einer nahegelegenen Schule arbeitete. Mit der Zeit drang er in den inneren Kreis der Schweizer Tenniswelt vor.
Zwei der ersten Spieler, die von seinen Fähigkeiten profitierten, waren Marc Rosset und Manuela Maleeva. Rosset war ein schlaksiger, zwei Meter großer Turnierspieler mit Sinn für Ironie und einer komplexen, bisweilen widersprüchlichen Persönlichkeit. Als Federer die Bühne betrat, war er der beste Schweizer Spieler, doch Bewegung gehörte nicht zu seinen ureigenen Stärken.
„Als ich Pierre zum ersten Mal sah, kam er vom Zehnkampf und wusste nichts vom Tennis. Er begann, selbst zu spielen, um die Feinheiten zu begreifen“, erzählte Rosset.
Laut Bresnik denkt Paganini nicht gern an diese frühen Jahre.
„Er erzählte mir einmal, dass man ihn für das, was er den Tennissportlern vor 25 Jahren in seiner Ahnungslosigkeit angetan habe, eigentlich mit einer Geldstrafe belegen müsste“, so Bresnik lachend. „Mit seinem heutigen Wissen sei ihm das peinlich. Aber er hört nie auf zu lernen und passt sich den Spielern an.“
Man vergleiche etwa Federer und Wawrinka. Federer ist mittelgroß, beweglich, reaktionsschnell und angriffsfreudig. Wawrinka hat einen breiten Brustkorb und trägt den Spitznamen „der Diesel“ – weil er eben eine Weile braucht, um seine Spitzengeschwindigkeit zu erreichen. Er besitzt Bärenkräfte und große Ausdauer.
„Die Tatsache, dass Pierre gleichzeitig mit Federer und Wawrinka arbeitet, die von ganz unterschiedlicher Statur und völlig verschiedene Spieler- und Sportlertypen sind, zeigt, dass er die physischen Bedürfnisse von Tennisspielern versteht wie kein anderer“, sagte Bresnik. „Was auch immer der Mann sagt, ich würde es annehmen. Andere Trainer tappen da lange im Dunkeln herum.“
Dass Paganini die Tenniswelt anfangs gar nicht kannte, war in mancher Hinsicht sogar vorteilhaft. Wie einem Reisenden, der Neuland betritt, fielen ihm Ungereimtheiten auf, die ein „Einheimischer“ nicht bemerkt. Er brachte seine Erfahrungen aus der Leichtathletik ein, beließ es aber nicht dabei. Auf der Grundlage seiner Arbeit mit Egger konzentrierte er sich auf die Entwicklung tennisspezifischer Konditionsübungen. Das beinhaltete viel Arbeit auf dem Platz statt im Fitnessraum; klar war auch, dass schwere Gewichte und Langstreckenlauf wenig nützten.
„Im Tennis muss man stark, schnell, koordiniert und belastbar sein, und dafür braucht man spezielle Übungen“, erklärte mir Paganini. „Aber man sollte auch nie vergessen, dass man diese Fertigkeiten dann auf dem Tennisplatz einsetzt, nicht auf der Straße und nicht in einem Schwimmbecken. Deshalb muss man immer eine Verbindung zwischen der Geschwindigkeit und der Art und Weise, wie der Sportler sie auf dem Platz einsetzt, herstellen. In neun von zehn Fällen liegt das Tempo in den ersten drei Schritten, und dann schlägt man den Ball. Deshalb muss man darauf hintrainieren, bei den ersten drei Schritten besonders stark zu sein.“
Da sich Grand-Slam-Partien im Einzel oft über mehr als drei Stunden hinziehen, geht es darum, auch noch im fünften Satz bei den ersten drei Schritten stark zu sein. Gefordert ist also das, was Paganini als „explosive Ausdauer“ bezeichnet. Das mag zunächst widersprüchlich klingen, ist es aber nicht. In jedem Fall ist es für einen Konditionstrainer eine Herausforderung.
„In der Leichtathletik läuft jemand, der Ausdauer hat, Marathon, während die explosiven Typen Sprint laufen“, sagte Paganini. „Aber im Tennis braucht man sowohl Ausdauer als auch explosive Kraft, und das sind entgegengesetzte Fähigkeiten. Deshalb ist Tennis so faszinierend, und deswegen halte ich es auch für viel schwieriger, als die meisten denken.“
Im Tennis muss man gelegentlich längere Strecken zurücklegen: wenn man einem Stoppball hinterherjagt, vom Netz zurückweicht, um einen Lob zu erreichen, oder von einer Ecke der Grundlinie zur anderen eilt, um mit ausgestrecktem Körper einen Passierball zu schlagen.
Doch die Grundlinie eines Einzelfelds misst nur 27 Fuß oder 8,23 Meter, und die Entfernung zwischen Netz und Grundlinie beträgt nur 39 Fuß oder 11,89 Meter. Selbst wenn ein Spieler weit hinter der Grundlinie steht und von dort zum Netz läuft, wird er nicht mehr als 16 Meter in gerader Linie zurücklegen.
„Im Tennis sprintet man nicht wie ein 100-Meter-Läufer“, sagte Paganini. „Man ist drei Stunden oder auch länger beschäftigt, immer wieder. Das ist sehr hart, aber man hat 25 oder auch 90 Sekunden Erholungszeit. Beim Spiel sollte man immer daran denken. Es geht nicht darum, einen Geschwindigkeitsrekord zu brechen. Du musst über längere Zeit hinweg wiederholt schnell sein. Bei einem fünfstündigen Spiel läuft man keine 40 Kilometer, höchstens sechs.“ Das Spiel besteht also aus kurzen Bewegungsausbrüchen, deswegen trainiert Paganini schwerpunktmäßig den Ausbruch.
Oft verlangt er von seinen Sportlern, gleichzeitig eine komplexe Aufgabe auszuführen, die Augen-Hand-Koordination erfordert.
So gibt er etwa intensive Beinarbeit vor, während sie gleichzeitig einen Medizinball fangen und werfen, im Anschluss dieselbe Beinarbeit, während sie Bälle schlagen.
Paganini legt auch gern nummerierte Stäbe in die Ecken eines Spielfelds. Der Spieler steht anfangs in der Mitte und hält einen Medizinball. Wenn Paganini ihm eine Zahl zuruft, muss der Spieler zum betreffenden Stab rennen und den Medizinball hochhalten.
Es geht ihm dabei um geistige wie auch physische Beweglichkeit. Er testet die Fähigkeit der Spieler, ihre Technik in Drucksituationen aufrechtzuerhalten, indem er sie schnelle und intensive Cardio-Einheiten ausführen lässt, teils auf einem Heimtrainer, unmittelbar gefolgt von Schlagübungen in der Version zwei gegen eins, bei denen der Spieler alles geben muss.
Zu seinen bevorzugten Methoden gehört auch Intervalltraining, eine klassische Übung für Läufer, doch in kürzeren Intervallen als üblich: bis zu 30 Sekunden, in denen sich der Spieler intensiv anstrengt, gefolgt von maximal 30 Sekunden Pause. Ziel ist, die Schnelligkeit des Spielers zu steigern, nicht nur seine maximale Sauerstoffaufnahme, das traditionelle Ausdauermaß.
„Aus meiner Sicht ist Pierre der weltbeste Konditionstrainer im Tennis. Er ist der Erste, der hochspezifische Übungen entwickelt hat, bis hin zur detaillierten Beinarbeit“, sagte Rosset. „Selbst ich bewegte mich trotz meiner Größe ziemlich gut, hatte kaum Verletzungen, und auch unter all den anderen Spielern, die Paganini trainiert hat, gab es relativ wenige Verletzungen.“
Das ist eine sehr beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass gerade explosionsartige Bewegungen mit einem erhöhten Verletzungsrisiko einhergehen. Doch Paganini umschiffte die Klippen erstaunlich gut, auch wenn sich am Ende sowohl Federer als auch Wawrinka in ihren Dreißigern Knieoperationen unterziehen mussten.
Rosset, seit Langem im Ruhestand, aber noch immer als Sportkommentator unterwegs, sieht Konditionstrainer heute oft mit ihren Spielern arbeiten, live bei Turnieren oder in Social-Media-Videos.
„Krass“, sagte Rosset. „Das sind fast dieselben Dinge, die ich vor 25 Jahren mit Pierre gemacht habe. Natürlich hat sich das eine oder andere verbessert, aber sehr viele Konditionstrainer wurden von Pierre beeinflusst. Seine Erfolge sprechen für sich. Wenn mich morgen jemand bittet, ihn zu coachen, dann sage ich ihm, weißt du was, mach mal vier Monate mit Paganini, und dann unterhalten wir uns noch mal.“
Manuela Maleeva ist die älteste von drei Schwestern aus Bulgarien, die bei ihrer Mutter Yulia Berberian Tennis lernten. Alle drei – Manuela, Katerina und Magdalena – stiegen in die Top 10 auf, obwohl sie über nur begrenzte Mittel verfügten und in Bulgarien, das sich nach dem Ende des Kommunismus im politischen Umbruch befand, auf etliche Hürden stießen.
Die Maleevas waren außerhalb Bulgariens kaum bekannt, ihre Geschichte gehört zu den Erfolgs-Storys im Tennis, zeitlich noch vor den Williams-Schwestern.
„Wissen Sie, wären wir Amerikanerinnen, wären wir Stars“, sagte Yulia einmal dem Magazin New Yorker. Und sie hatte recht.
Eine von Yulias Töchtern wurde Schweizerin. Manuela heiratete 1987 mit 20 Jahren den Tennistrainer François Fragnière und begann in Ecublens zu trainieren, wo sie auf Paganini traf.
„Ich bin tatsächlich der erste Tennisprofi, dem er aus beruflichen Gründen folgte“, erzählte mir Manuela. „Er hat mich an meine Grenzen gebracht, aber ohne dass ich ihn dafür hasste. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Trainern.“
Manuela und Fragnière, sowohl ihr Ehemann als auch ihr Trainer, war bewusst, dass sie an ihrer physischen Kondition arbeiten musste, um gegen Spielerinnen wie Steffi Graf, Martina Navratilova oder Gabriela Sabatini bestehen zu können, die in den späten 1980er-Jahren das Damentennis beherrschten.
Paganini wollte zuerst ihre aktuelle Kondition feststellen.
„Das einzige Mal, das ich Lust hatte, ihn zu ohrfeigen, war wohl bei unserem ersten gemeinsamen Lauf“, erzählte Manuela lachend. „Er wollte meine Kondition sehen und herausfinden, wo er bei mir ansetzen musste. Also gingen wir auf dem Clubgelände joggen.“
Bald steuerten Maleeva und Paganini den nahegelegenen Wald an, um dort weiterzulaufen. Maleeva ging es schlecht, sie hatte schon ein längeres Ausdauertraining hinter sich und war dem Erbrechen nahe. Paganini war in deutlich besserer Verfassung: Er lief ein paar Meter vor ihr her – rückwärts, um sie beim Sprechen ansehen zu können.
„Ich dachte mir: ‚Das gibt’s doch nicht, mir hängt die Zunge aus dem Hals und der Typ läuft rückwärts und redet mit mir‘“, sagte Maleeva. „Das werde ich nie vergessen.“
Sie vergab ihm. Und arbeitete dann weitere sieben Jahre mit Paganini bis zu ihrem Rücktritt 1994, kurz nachdem sie ihr letztes WTA-Turnier im japanischen Osaka gewonnen hatte. Sie war damals noch immer in der Top 10.
„Ich habe solche Fortschritte unter ihm gemacht“, sagte sie. „Früher hatte ich im dritten Satz oft Krämpfe, und das beunruhigte mich. Nachdem ich bei Pierre angefangen hatte, verbesserte sich meine Kondition so weit, dass ich das Gefühl hatte, fünf Stunden ohne Angst auf dem Platz verbringen zu können.“
Bei Manuelas Abschied arbeitete Paganini in Ecublens längst mit Magdalena Maleeva, die den Spitznamen Maggie trägt und acht Jahre jünger als Manuela ist.
„Pierre war eine gute Beinarbeit sehr wichtig“, sagte Magdalena. „Man musste genau darauf achten, wie man auftrat.“
Manuela Maleeva kam mit 15 Jahren zum Profitennis und trat kurz vor ihrem 27. Geburtstag zurück. Magdalena, deren Profikarriere im Alter von 14 Jahren begann, schied mit 30 aus. Beide Schwestern hatten das Gefühl, eine lange Karriere hinter sich gebracht zu haben. Doch beide erinnern sich, dass Paganini einmal sagte, in Zukunft würden Tour-Spieler und -Spielerinnen noch viel länger dabeibleiben.
„Das sagte damals wirklich niemand“, erzählte Magdalena. „Die meisten waren vom Gegenteil überzeugt: Tennis ist ein sehr harter, körperlich sehr belastender Sport; die Spieler haben keine Saisonpause, und die Verletzungen nehmen eher zu.“
Paganini glaubte, dass tennisspezifisches Training, intelligente Terminplanung, verbesserte Reha-Maßnahmen und bessere, größere Betreuungsteams zu längeren Karrieren führen würden. Seine Vision erwies sich als zutreffend, wie die große Zahl an Spielerinnen und Spielern belegt, die mit weit über 30 immer noch spielen und sogar ihr Ranking verbessern.
„Pierre hält nichts von dem Klischee, wonach man als Sportler nach seinem 30. Geburtstag automatisch abbaut“, sagte Magdalena. „Er ist überzeugt, dass man mit dem richtigen Training sehr lange spielen kann.“
Magdalena kam mit 17 Jahren zu Paganini und blieb bis zu ihrem Rücktritt 2005 bei ihm – ganz typisch für viele, die mit ihm arbeiten. Die Sportler bleiben ihm oft lange treu.
Natürlich stellt aber der eine oder andere Konditionstrainer-Kollege bei Paganini auch Schwächen fest.
Paul Dorochenko, der später für den Schweizerischen Tennisverband mit Federer und anderen Junioren arbeitete, muss kurz überlegen, wenn er Paganini beschreiben soll. Schließlich entscheidet er sich für das Wort „ungewöhnlich“.
Zum einen habe es Paganini nie für nötig befunden, den Führerschein zu machen, und sich stattdessen auf Züge, Taxis, Fahrdienste und seine zweite Frau Isabelle verlassen, die Auto fährt.
„Ich würde sagen, Pierre hat ziemlich starre Vorstellungen. Er ist wenig flexibel und nicht sehr zugänglich“, so Dorochenko. „Er ist stark introvertiert. Aber ich denke, es gelingt ihm sehr gut, Stärke und Koordination bei seinen Spielern zu verbessern. Wenn du eine Trainingseinheit mit Pierre machst, dann versteht er es, deine Aufmerksamkeit zu halten, und lässt nicht locker. Darin ist er ein Meister. Er ist eher praktisch als konzeptuell veranlagt.“
Doch Paganinis Vermögen, die Aufmerksamkeit seiner Spieler zu halten und sich auch ihre Loyalität zu sichern, beruht auf seiner Kreativität und dem Talent, hoch individualisierte Programme zu entwickeln – das spricht wohl kaum für mangelnde Flexibilität.
Ein Spieler wie Federer, der sehr auf Abwechslung setzt, hätte sicher nicht mehr als 20 Jahre Routine mitgemacht.
Obwohl Paganini das Rampenlicht scheut und von Natur aus zurückhaltend ist, empfinden Federer und andere den Austausch mit ihm als unkompliziert.
„Sie können sich den Einfluss, den er als Konditionstrainer auf mich hatte, vorstellen, aber offen gestanden ist er auch so etwas wie mein Mentor, denn wir reden neben der Arbeit natürlich viel“, sagte Federer einmal. „Man muss immer 45 Minuten dazurechnen, in denen wir einfach über alles sprechen.“
Wer Gelegenheit zu einem der seltenen Interviews mit Paganini hat, wird schnell in ein tiefer gehendes Gespräch gezogen. Er ist mitreißend, spricht in langen Absätzen und liebt Metaphern. 2012 und 2017 unterhielten wir uns länger, beide Male auf Französisch, wie beim Training mit Federer.
Ich fragte Paganini, ob die gängige Meinung zutreffe, wonach Federers Knochenaufbau und seine natürlichen, anmutigen Bewegungen entscheidend dazu beitrügen, unverletzt zu bleiben.
„Ich höre das immer wieder“, antwortete Paganini. „Es ist eine Sache, ein Potenzial zu haben, aber eine andere, es in 70 Partien pro Jahr auszuspielen. Das ist Rogers Ziel: in jedem Match und in jeder Trainingseinheit konstant zu bleiben. Ich glaube, dass wir die ganze Arbeit, die Roger leistet, unterschätzen. Wir unterschätzen seine Leistung, denn wenn wir ihn spielen sehen, dann sehen wir den Künstler, der sich ausdrückt. Wir vergessen beinahe, dass er dafür arbeiten muss wie ein Balletttänzer. Man sieht die Schönheit, übersieht aber die Arbeit, die dahintersteckt. Und man muss verdammt hart arbeiten, um ein so schöner Tänzer zu werden.“
Es braucht eben Zeit, sich die nötigen Muskeln und das Muskelgedächtnis anzueignen, um den letzten Schliff und die perfekte Körperhaltung auszubilden. Federer hat Jahrzehnte im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit verbracht und steht für ein Tennis, das wunderbar leicht wirkt.
Nur ein sehr kleines Publikum erinnert sich noch daran, wie frustriert er anfangs war.
Magdalena Maleeva erzählte mir von ihrem ersten Eindruck von Federer in Ecublens; da war er 14.
„Damals war er ein kleiner Junge, und ich fand, dass er sich mächtig aufregte“, sagte sie. „Er warf ständig seinen Schläger durch die Gegend.“
Maleeva, die sechs Jahre älter ist und sich schon in die Top 10 der WTA eingeklinkt hatte, gewann einmal einen Übungssatz gegen Federer.
„Er wirkte damals auf mich wie ein verwöhnter Junge, er wurde oft so wütend“, sagte sie. „Aber ich vermute, es ging ihm einfach nicht gut.“
Auch Freyss, Leiter des Leistungszentrums in Ecublens und technischer Direktor des Schweizerischen Herrentennis, konnte Federers Kummer nachvollziehen. Er war selbst Akademieschüler gewesen, im Internat des Leistungszentrums des Französischen Tennisverbands in Nizza in den 1970er-Jahren, zusammen mit dem späteren French-Open-Sieger Yannick Noah.
Freyss ging dann auf Tour und schaffte den Einzug in die Top 100. Bei den Grand-Slam-Turnieren kam er nicht weit, besiegte aber immerhin vier frühere beziehungsweise spätere Champions: Arthur Ashe, Andres Gomez, Manuel Orantes und Ivan Lendl.
Als Coach wusste Freyss später genau, wie viel Opferbereitschaft und Selbstdisziplin der Erfolg abverlangt. Wie andere erkannte auch Freyss Federers Potenzial: die schnelle Vorhand, die flinken Beine, die angeborene Fähigkeit, vorauszudenken. Eigentlich war es nicht seine Art, junge Talente anzupreisen, aber Freyss erwähnte doch gegenüber seinem Mentor und Vorgänger in Ecublens, Georges Deniau, dass Federer ungewöhnlich begabt sei. Er riet auch seinem Freund Regis Brunet, einem Tennismanager bei IMG, Federer im Auge zu behalten, und Brunet gelang es später als Erstem, ihn zu verpflichten.
Bei alledem trat Federers innerer Kampf deutlich zutage.
„Emotional stand Roger an einem Abgrund“, so Freyss. „Zunächst einmal ist es nie einfach, Teenager zu sein, und für Roger war es kein einfacher Schritt, seine Familie zu verlassen und nach Ecublens zu gehen. Er musste Französisch lernen und eine französischsprachige Schule besuchen, was auch schwierig war. Und dann noch das Tennis. In vielerlei Hinsicht war es für ihn eine wirklich schwere Zeit. Ich war nicht nachsichtig mit ihm, das ist nicht meine Art. Ich behandelte ihn wie alle anderen. Mir war egal, wer in einer bestimmten Altersgruppe die Nummer eins war. Ich gönnte meinen jungen Spielern keine Erholungspausen. Ich wollte aus ihnen gute Tennisspieler machen und steckte mein Herzblut in diese Aufgabe.“
Freyss arbeitete nicht täglich mit Federer. Diese Aufgabe fiel Alexis Bernard zu, einem jungen Schweizer, der die jüngeren Spieler trainierte. Freyss beaufsichtigte das Ganze und arbeitete mit Federer öfter an dessen Technik, Taktik und Einstellung.
„Ich weiß nicht, ob ich bei ihm alles richtig gemacht habe“, sagte Freyss. „Doch ganz sicher habe ich ihm vermittelt, dass wir bei inakzeptablem Verhalten keine Kompromisse eingingen. Wir gerieten manchmal aneinander, aber er akzeptierte das und schluckte es. Er musste viel schlucken, und ich glaube kaum, dass ihm das Spaß machte.“
Federer mag gesellig und einfühlsam sein, aber der Umgang mit ihm war damals sicher nicht leicht, und Freyss hatte keine Lust, sich zurückzunehmen.
„Konflikte liebte er überhaupt nicht“, erzählte Freyss. „Er wollte spielen und sich auf diese Weise ausdrücken. Ich sagte oft: ‚Roger, schau mich an. Ich muss wissen, ob du verstehst, was ich dir zu erklären versuche. Du läufst durch die Gegend. Du schlägst den Ball. Du lässt den Ball zwischen deinen Beinen hüpfen. Hör auf damit.‘ Selbst das fiel ihm schwer. Seine Gefühle und Energie übermannten ihn. Er musste spielen, sich bewegen. Das Spiel steht für ihn über allem.“
Paganini erinnerte sich, dass Federer am Anfang mancher Trainingseinheiten seine aufgestaute Energie entlud, indem er immer wieder schrie.
„Er war der Jüngste, und ich erinnere mich, dass ich ihn beobachtete und dachte, wie spontan er war“, erzählte mir Paganini. „Innerhalb von wenigen Minuten konnte sich sein Lachen in Tränen verwandeln.“
Federer war nicht die einzige künftige Nummer eins, die Mühe hatte, ihre Emotionen und eigenen Erwartungen zu zügeln. Im September 1996 nahm Federer als 15-Jähriger für die Schweiz am World Youth Cup, der Juniorenweltmeisterschaft, in Zürich teil. Der Gegner des Schweizer Teams am Eröffnungstag war Australien, was bedeutete, dass Federer auf Lleyton Hewitt traf.
Der australische Kapitän war Darren Cahill, Peter Lundgren, ein ehemaliger Top-25-Spieler aus Schweden, führte das Schweizer Team an, und Peter Carter war ebenfalls anwesend.
„Roger und Lleyton hatten noch nie gegeneinander gespielt, beide wussten um den Ruf des jeweils anderen, da war viel Druck auf der Leitung“, erinnerte sich Cahill. „Schon ab dem ersten Spiel ging es zur Sache. Sie versuchten sich gegenseitig zu beeindrucken: durch Verunsicherung, Herumwedeln mit dem Schläger, Diskutieren mit dem Schiedsrichter, was auch immer. Ich wusste nicht, wie mir geschah, denn ich hatte Lleyton noch nie richtig bei einem Match beobachtet, ihm jedenfalls noch nie von der Tribüne aus zugesehen. Und das hier glich einem Match zwischen McEnroe und Connors – zwei 15-Jährige, die sich beharkten. Am Ende des Matches waren beide quasi in Tränen aufgelöst. Ich glaube, Lleyton pfefferte am Schluss seinen Schläger in den Zaun.“
Federer gewann den Tiebreak im dritten Satz und erinnerte sich, dass Hewitt so fest auf die Saiten eindrosch, dass seine Hand zu bluten begann. Cahill verließ den Platz benommen und verärgert – nicht weil Hewitt verloren hatte, sondern weil sich die beiden jungen Kontrahenten so benommen hatten. Er ging auf Carter zu, und der lächelte. Nicht wegen Federers Sieg, sondern weil er an die Zukunft dachte.
„Mann, die beiden werden eines Tages großartig sein“, sagte Carter.
„Diese beiden Jungs brauchen einen anständigen Tritt in den Hintern. So kann man sich doch nicht benehmen“, antwortete Cahill.
Carter lächelte immer noch. „Gut, darum kannst du dich ja kümmern“, sagte er. „Aber sie werden mal ganz besondere Spieler.“
Es war die erste von vielen Begegnungen zwischen Federer und Hewitt. Die nachfolgenden liefen zwar nicht mehr ganz so temperamentvoll ab wie diese, doch der Startschuss für ihre Rivalität war gefallen, und die erwies sich als entscheidend für ihre langen Karrieren.
In Zürich war Cahill mehr von Federers Spiel beeindruckt, als das noch in Basel der Fall gewesen war. Federers Rückhand war stärker geworden, wenngleich er weiterhin diesen großen Schritt machte.
„Er verschlug oder verpasste den Ball längst nicht mehr so oft“, sagte Cahill. „Er hatte einfach eine unglaubliche Augen-Hand-Koordination. Am Ende kam dabei der Schlag heraus, den er heute hat. An kleineren Schritten hat er gearbeitet, aber ab und zu macht er einen Riesensatz mit dem rechten Bein auf seine Rückhandseite und schlägt eine Rückhand durch die Mitte, und man fragt sich, woher er diese Kraft nimmt und wie man sowas überhaupt schafft.“
Damals in Ecublens war Federers Technik ein häufig diskutiertes Thema im Trainerstab.
Dank Kacovsky und Carter zeigte er starke Grundfähigkeiten, aber manches bereitete Sorge. Die Vorhand gehörte nicht dazu.
„Es war magisch, wie er sich auf den Schlag vorbereitete, den Schlägerkopf absenkte und dann mit seinem Handgelenk beschleunigte“, sagte Freyss. „So ist er. Das ist angeboren. Wir mussten nur ein wenig am Abschluss arbeiten. Wir wollten ihn dazu bringen, dass er ein klein wenig länger Ballkontakt mit den Saiten hält.“
Auf der Rückhand musste sich Federer noch die Kunst aneignen, den Topspin Drive zu spielen.
„Das war unsere große Baustelle“, so Freyss.
Manchmal warf Freyss ihm die Bälle mit der Hand zu, und wenn ihm das Ergebnis gefiel, hörte er auf, und Federer sollte sich den Pfad merken, den er gerade mit dem Schläger in der Luft gezeichnet hatte.
Nach Freyss’ Ansicht war Federer während des Schlags nicht stabil genug: Beim Abschluss zog er die linke Schulter zu früh nach vorn. „Um Stetigkeit zu erreichen, ist es sehr wichtig, die Schultern länger parallel zu halten“, sagte Freyss. „Es gab ein paar Trainingseinheiten, bei denen der Ball mal hierhin, mal dorthin sprang.“
Das zweite Ziel für eine verbesserte Rückhand war, den Ball weiter vorne anzunehmen. Doch auch der einhändige Rückhand-Slice, eine weitere Stärke Federers im Verlauf seiner Karriere, benötigte Feinabstimmung.
„Beim Slice ging sein Kopf ein wenig nach hinten“, sagte Freyss. „Das mussten wir also ändern.“
Die Prioritäten beim Aufschlag lagen darin, die Schulterrotation zu erhöhen und den Ballwurf stetiger zu machen. Wichtig war, die Absicht zu verschleiern, indem man verschiedene Aufschläge von der gleichen Wurfposition ausführt.
„Sampras konnte all seine unterschiedlichen Aufschläge mit dem gleichen Ballwurf ausführen. Im Laufe der Zeit versucht man dann, solche Dinge einzubauen, aber gleichzeitig auch eigene Sachen auszuprobieren“, verriet mir Federer. „Ich experimentierte laufend mit meinem Aufschlag, versuchte einen für einen Kick-Aufschlag geworfenen Ball in eine andere Richtung zu schlagen oder einen Kick-Aufschlag nach einem geraden Wurf auszuführen. Und ich stellte fest, dass ich das tatsächlich alles konnte.“
Paganini koordinierte auch Unterbringung und Schule der Spieler. Federers Gastfamilie bestand aus den Eltern Cornelia und Jean-François Christinet und ihren drei Kindern. Federer lebte unter der Woche bei den Christinets und fuhr für das Wochenende und die Ferien mit dem Zug nach Basel zu seinen Eltern und seiner Schwester.
„Wenn er gewann, dann wegen der Cornflakes“, sagte Cornelia Christinet 1999 in einem Interview mit der Schweizer Zeitschrift L’Illustré. „Er aß sie schüsselweise, von morgens bis abends. Fleisch oder Fisch mochte er nicht, nur Pasta.“
Auch das Aufstehen war nicht seine Sache. „Manchmal hörte er den Wecker nicht, und ich musste ihn aus dem Bett jagen“, berichtete Cornelia Christinet. „Aber dann brauchte er nur fünf Minuten. Ich kenne niemanden, der sich so schnell fertig macht.“
Die Schulaufgaben stellten die größte Herausforderung dar, wenigstens lernte er schnell Französisch – nicht zuletzt, weil er ins kalte Wasser sprang und sich nicht groß darum scherte, ob er beim Sprechen Grammatikfehler machte. Er führte seinen Kampf nicht allein. Sven Swinnen, ein weiterer Deutschschweizer, musste wie er Französisch erst lernen und hatte als Klassenkamerad denselben Unterricht und dieselben Lehrer wie Federer. Swinnen war ebenfalls ein vielversprechender Spieler, er besiegte Federer anfangs oft und erhielt später ein Tennisstipendium an der University of Oregon.
„Anfangs hatten wir es beide schwer in Ecublens“, erzählte mir Swinnen. „Aufgrund der Sprache waren wir beide Außenseiter. Die allgemeine Stimmung war: ‚Was macht ihr eigentlich hier?‘ Aber es half uns auch. Wir lernten eine Sprache, was natürlich positiv war und Roger sicher später geholfen hat. Seine Mehrsprachigkeit trug zu seiner Popularität bei.“
Philippe Vacheron, einer ihrer Lehrer am Collège de la Planta, erinnert sich gut an Federer und spielte sogar einmal mit ihm.
„Er hatte so eine wilde Seite an sich, die ich Instinkt nennen würde“, sagte Vacheron in einem Interview mit der Schweizer Tageszeitung Le Temps. „Er konnte aus dem Nichts heraus in die Klasse hineinrufen: ‚Monsieur Vacheron! Was bedeutet das?‘ Andere Kollegen hätten das nicht hingenommen, aber ich fand es irgendwie liebenswert. Sein Deutschschweizer Klassenkamerad Sven hielt sich an die Regeln, Roger sprach aus, was er dachte. Er neigte zu heftigen Reaktionen, war aber nie respektlos. Er konnte auch ziemlich empfindlich sein, wenn er Schwierigkeiten hatte. Er war dann frustriert, weil er etwas nicht verstand, und litt gleichzeitig darunter, so weit weg von zu Hause zu sein. Selbst wenn aus ihm kein Champion geworden wäre, würde ich mich an ihn erinnern. Von allen Spielern, die unsere Schule besuchten, war er der Einzige, bei dem ich mir sagte, dass er seinen Weg konsequent zu Ende gehen muss. Alles war möglich, Erfolg oder Scheitern. Aber er hatte Talent.“
Daran bestand kein Zweifel, und in seinem zweiten Jahr in Ecublens begannen sich seine Turnierergebnisse zu verbessern. Er war ausgeglichener und selbstsicherer und hatte sein Spiel um neue Elemente erweitert.
Allegro erinnerte sich, dass alle Teilnehmer des Programms einen Fragebogen ausfüllen und ihre Tennisziele nennen mussten. Allegro schrieb, er hoffe, unter die besten 100 Spieler der Welt zu kommen. „Roger war der Einzige von uns, der schrieb, er wolle die Nummer eins werden“, sagte Allegro. „Ich bin mir nicht sicher, ob er selbst daran glaubte, aber alle sollten es wissen.“
Wenn ein junger Spieler an die Tennisspitze gelangen möchte, kann eine Menge schiefgehen. Freyss, der so viele Talente trainiert und gegen sie gespielt hat, schätzte Federers Erfolgschancen positiv ein, als dieser mit 16 Jahren Ecublens verließ. Federers Spiel beurteilte er als besonders vielversprechend, weil es solide und flüssig war.
„Wenn er spielte, konnte ich nichts erkennen, was ihn aufhalten würde“, sagte Freyss. „Er konnte zwei Meter hinter der Grundlinie stehen oder auch mitten im Spielfeld, und nichts hielt ihn davon ab, einen Gang hochzuschalten. Aus meiner Sicht waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt.“
Nachdem er Federer zwei Jahre lang genau beobachtet hatte, erkannte er aber doch eine Hürde.
„Das Einzige, was ihm in die Quere kommen könnte, war sein Kopf, seine Nerven“, sagte Freyss. „Und am Ende sagte ich zu ihm: ‚Roger, du kannst die größten Trophäen der Welt hochhalten, aber versuche nicht gegen dich selbst zu kämpfen, denn dann wird alles nur komplizierter.‘“