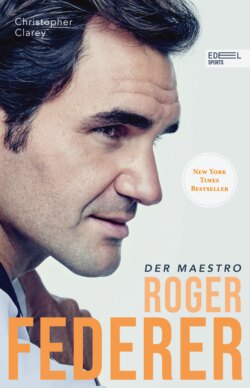Читать книгу Roger Federer - Christopher Clarey - Страница 8
Kapitel 4 BIEL/BIENNE, SCHWEIZ
ОглавлениеBei einem gemeinsamen Mittagessen in den Alpen ließ Roger Federer mir gegenüber seinen eigenen Namen fallen.
Er nannte eine Reihe von Orten, die ihm in der Schweiz am meisten bedeuteten und die ich besuchen sollte: natürlich Basel, Ecublens, Zürich und den See, Lenzerheide mit den spektakulären Bergen und Skiabfahrten, im nahen Valbella hatte er zusammen mit seiner Frau Mirka ein traumhaftes Haus gebaut.
Dann erwähnte er Biel.
„Da wurde jetzt eine Straße nach mir benannt“, sagte er nüchtern. „Die Roger-Federer-Allee.“
Als ich nach einer malerischen Zugfahrt dort eintraf, erwies sich diese Straße nicht ganz als das, was die meisten von uns erwartet hätten. Das gerade Stück Teerstraße befand sich in einem modernen Stadtteil, der an ein Gewerbegebiet aus dem späten 20. Jahrhundert erinnert.
Es ist nicht leicht, überhaupt auf eine Schweizer Karte zu gelangen. Die Obrigkeit sieht es nicht gern, wenn öffentliche Plätze oder Straßen nach noch lebenden Schweizerinnen oder Schweizern benannt werden. Den berühmtesten lebenden Schweizer Sportler Roger Federer hielt man für würdig genug, dass für ihn eine Ausnahme gemacht wurde. Er selbst machte sich allerdings nicht stark dafür. Die wenig anregende Kulisse ist in gewisser Weise dann doch sehr passend: Die Straße verläuft neben dem nationalen Leistungszentrum des Schweizerischen Tennisverbands. Federer verbrachte dort nach dessen Eröffnung mehrere prägende Jahre.
„Mein Erwachsenenleben begann praktisch in Biel“, sagte Federer.
Genau genommen stehen zwei Namen auf dem Straßenschild: Roger-Federer-Allee und Allée Roger Federer. Biel ist zweisprachig und bildet eine Brücke zwischen der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz.
Biel ist der deutsche Stadtname, Bienne der französische, und seit 2005 heißt die Stadt offiziell Biel/Bienne. Ihre Website www.biel-bienne.ch spiegelt diese Zweisprachigkeit ebenso wider wie Federer, der die Stadt „Biel“ nennt, wenn er Deutsch oder Englisch spricht, aber „Bienne“, wenn er Französisch spricht.
Die Zweisprachigkeit ist einer der Gründe, die den Schweizerischen Tennisverband dazu bewogen, sein Leistungszentrum im September 1997 von Ecublens nach Biel/Bienne zu verlegen.
„Ein politisch äußerst korrekter Standort“, bemerkte der Niederländer Sven Groeneveld dazu, der 1997 mit der Leitung des Trainingsprogramms betraut wurde.
Im Gegensatz zum französischsprachigen Ecublens war es in Biel/Bienne möglich, junge Talente überwiegend in Schulen zu schicken, die in ihrer ersten Sprache unterrichteten.
Federer, der mittlerweile fließend Französisch sprach, war zu allem bereit, was sein neues Trainingszentrum ihm vorsetzen würde. Um Hausaufgaben musste er sich nicht mehr kümmern. Mit 16 Jahren hatte er seine Pflichtschulzeit absolviert, und er traf die Entscheidung, sich jetzt ganz auf die Profikarriere zu konzentrieren.
Das war ein mutiger Schritt in einer so konservativen, bildungsorientierten Gesellschaft wie der Schweiz, wo eine Sportkarriere selbst in den späten 1990er-Jahren kaum als seriöser Berufsweg betrachtet wurde.
„Die Denkweisen haben sich verändert, aber die Schweiz ist trotzdem nicht das, was ich als echtes Sportlerland bezeichnen würde“, sagte Marc Rosset, seinerzeit der beste Schweizer Tennisspieler. „Das ist nicht mit den USA, Australien oder Italien vergleichbar. Manchmal haben es Sportler in der Schweiz wirklich schwer.“
Rosset erinnerte sich, wie er 1988 mit 18 Jahren die Schweizer Jugendmeisterschaften gewann und dann mitgeteilt bekam, dass der Schweizerische Tennisverband nicht vorhatte, ihn nach Florida zum Orange Bowl zu entsenden, einem der weltweit wichtigsten Juniorenwettbewerbe.
„Ich sagte: ‚Warum denn nicht?‘ Normalerweise spielt jeder, der mit 18 Jahren Schweizer Meister wird, beim Orange Bowl“, erinnerte sich Rosset. „Aber sie sagten: ‚Du bist nicht gut genug, das hat keinen Sinn.‘“
Rosset, verletzt, aber entschlossen, forderte den Verband auf, ihn trotzdem anzumelden – seine Familie würde die Reise bezahlen. Er machte das Beste daraus und gewann als erster Schweizer den U18-Wettbewerb beim Orange Bowl (Federer war der zweite).
„So läuft es in der Schweiz oft“, sagte Rosset. „Was sie mit mir gemacht haben, war nicht gerade nett, in gewisser Weise hat es mich aber auch gestärkt. Ich dachte mir: ‚Okay, ihr wollt mich also nicht. Ich werd’s euch zeigen.‘“
Kurz nach seiner Entscheidung, die Schule zu verlassen, suchte Federer seinen alten Zahnarzt in Basel auf. Die beiden unterhielten sich.
„Er fuhrwerkte in meinem Mund herum und sagte: ‚Na, was machst du denn jetzt‘“, erinnerte sich Federer. „Und ich so: ‚Ich spiele Tennis.‘ Und er fragte: ‚Okay, und sonst?‘ Und ich so: ‚Das war’s.‘ Und er schaute mich mit großen Augen an: ‚Das ist alles? Nur Tennis?!‘“
Federer wechselte den Zahnarzt.
„Ich ging nie wieder zu ihm, er verstand überhaupt nicht, was ich hier versuchte“, erzählte mir Federer. „Ich verfolgte einen Traum. Ich griff nach den Sternen. Und er war skeptisch. Mit solchen Menschen möchte ich mich nicht umgeben.“
Beim Aufbau seiner eigenen beruflichen und privaten Netzwerke behielt Federer diese Herangehensweise bei. Er suchte die positive Energie und Menschen, die ihn aufbauten. Das birgt natürlich immer die Gefahr, Leute anzulocken, die einem erzählen, was man gerne hören möchte, und nicht das, was man hören sollte. Gerade wenn es sich um eigene Angestellte handelt. Profispieler haben fast immer ein Gefolge, das manchmal beschönigend als „Team“ bezeichnet wird. An Schmeichlern herrscht kein Mangel.
Nach Aussage derer, die im Laufe der Jahre eng mit Federer zusammengearbeitet haben, lernte Federer Diskussionen mit dem Team und konstruktive Kritik mit der Zeit schätzen. Doch mit 16 sehnte er sich nach Menschen, die ihm vertrauten und ihm auf die Schulter klopften.
„Ich wollte hören: ‚Das ist fantastisch, Roger, ein großartiger Plan‘“, sagte er. „Ich glaube, dass man jungen Menschen wirklich helfen kann, wenn man ihnen sagt: ‚In Ordnung, nichts wie ran! Egal welchen Weg du gehst, ich werde dich unterstützen.‘ Aber natürlich muss man auch realistisch sein. Wenn du nicht gut genug bist, musst du irgendwann erkennen, dass es okay ist aufzuhören. Manche treiben es zu weit, und dann trifft es sie wie ein Schlag.“
Die einflussreichsten Stimmen der Vernunft waren in dieser Zeit die seiner Eltern. Zwar erkannten sie das Talent ihres Sohnes und rechneten ihm die Leidenschaft hoch an, mit der er sich dem Tennis widmete. Doch die Federers waren sich sehr bewusst, dass zahllose aussichtsreiche Junioren die Weltspitze nicht erreichen. Sie wollten einen Plan B.
Robert Federer erklärte Roger, sie würden ihn bei der Finanzierung seiner Karriere unterstützen, doch wenn er mit 20 noch nicht die Top 100 erreicht habe, müsse er auf die Schulbank zurückkehren und einen Abschluss machen.
„Damit hatte ich kein Problem, das Versprechen konnte ich ihm geben“, erzählte mir Federer. „Ich rechnete mir gute Chancen aus, auch realistisch gesehen.“
In Biel/Bienne, kaum mehr als eine Fahrstunde südlich von Basel, begann die Uhr zu ticken. Wie so oft auf dem Platz und abseits davon war Federers Timing ausgezeichnet.
Das neue „Haus des Tennis“ gehörte dem Schweizerischen Tennisverband, anders als das Zentrum in Ecublens, wo der Verband nur Anlagen gemietet und in einem privaten Club Platzgeld bezahlt hatte. Der Umzug ermöglichte dem Verband auch, seine Aktivitäten zusammenzuführen; erstmals befanden sich nun die Trainings- und Verwaltungseinheiten am selben Ort.
Das Schweizer Tennis hatte eine neue Stufe genommen. Einige Monate zuvor hatte Martina Hingis ihren Ruf als eines der größten Wunderkinder des Sports gefestigt, indem sie mit 16 Jahren die Spitze der Damen-Weltrangliste erreichte. Damit war sie die jüngste Nummer eins der Geschichte. Die Saison 1997 wurde ihre beste: Sie gewann die Australian Open, Wimbledon sowie die US Open und verpasste den Grand Slam nur, weil sie im Finale der French Open an einer anderen jugendlichen Spielerin scheiterte: der Kroatin Iva Majoli.
Hingis’ uneingeschränkter Triumph währte nur kurz (dann hoben die Williams-Schwestern das Spiel auf ein noch höheres Niveau). Mit ihrer geschliffenen Technik und ihrem hervorragenden Platzgefühl war sie auf jedem Belag gefährlich. Sie war listig und selbstbewusst, was ihre fehlende Kraft ausglich. Sie erhielt den Spitznamen „Swiss Miss“. In journalistischen Kreisen wurde sie auch „Chucky“ genannt, nach der grinsenden Mörderpuppe, die ihre Besitzer terrorisiert.
Hingis’ Grinsen war in der Tat mysteriös: Je nach Situation konnte es Erfüllung oder Bedrohung bedeuten. Doch ihr Tennistalent war unübersehbar, und wie Federer hatte sie internationale Wurzeln. Ihre Eltern stammten aus dem slowakischen Teil der früheren Tschechoslowakei. Hingis wurde clever gecoacht von ihrer Mutter Melanie Molitor. Sie ist der lebende Beweis dafür, dass man in jungem Alter sowohl große Träume haben als auch groß herauskommen kann.
Federer, ein sensibler 16-Jähriger voller Ehrgeiz und nervlicher Anspannung, war einmal Balljunge für Hingis in Basel gewesen. Er beobachtete sie aufmerksam und ließ sich von ihr inspirieren, auch wenn Herren- und Damen-Tour sehr unterschiedliche Gefilde waren und sind.
„Man kann das mit einem Bergsteiger vergleichen, der eine Wand anstarrt und sich fragt: ‚Kann man das schaffen?‘“, sagte Heinz Günthardt, ein früherer Wimbledon-Champion bei den Junioren und der beste Schweizer Spieler der 1980er-Jahre. „Und dann erklimmt jemand sie plötzlich. Da will man es doch unbedingt auch versuchen. Und selbst wenn man es beim zweiten, dritten oder vierten Mal nicht schafft, weiß man doch, es ist möglich, denn einer Person ist es gelungen. In meiner Zeit hätte es mir zweifellos geholfen, wenn mir da jemand gezeigt hätte, dass es geht.“
Günthardt erreichte in Wimbledon und bei den US Open das Viertelfinale im Einzel, bekannt wurde er aber wohl am ehesten als Trainer von Steffi Graf. Er galt als Topspieler in einer Zeit, in der es schon ein Erfolg war, wenn ein Schweizer überhaupt an einem Grand-Slam-Turnier teilnahm. Ans Gewinnen dachte niemand.
Federer legte an sich selbst eine höhere Messlatte an, und im Gefolge von Hingis taten das auch andere.
„Ich spürte, dass es möglich war, nach den Sternen zu greifen, und zum Glück gab es in diesem Land Martina und andere großartige Sportlerinnen und Sportler“, erzählte mir Federer. „Wir müssen hier wohl noch etwas an uns arbeiten, um wie in Amerika daran zu glauben, dass alles möglich ist. Manchmal habe ich den Eindruck, als könnten wir nicht an uns glauben, weil man uns einredet, Schule, Job, Sicherheit sei alles, worauf es ankomme. Das hält uns davon ab, aufs Ganze zu gehen und zu sagen: ‚Riskieren wir doch etwas, packen wir’s an, folgen wir mal zwei oder drei Jahre lang unseren Träumen und schauen, was passiert.‘ Mit halben Sachen kommt man nicht weiter. Wenn jemand in China oder Russland oder Amerika oder Argentinien oder wo auch immer fünf Stunden täglich trainiert und du nur zwei, wie soll das gehen? Dann ist es doch unrealistisch, der Größte und Beste zu werden. Mit Träumen allein kommt man nicht in die Top 250 oder in die Nähe eines Wimbledon-Siegs.“
Federer hatte Glück, dass das gut ausgerüstete Zentrum in Biel für ihn im richtigen Moment eröffnete. Es stellte ihm zu einem sehr günstigen Preis eine solide Trainingsbasis und einen ebensolchen Beraterstab zur Verfügung. Der Verband trug einen Großteil der Kosten.
Seine Eltern gaben zu diesem Zeitpunkt rund 30.000 Schweizer Franken (etwa 27.500 Euro) pro Jahr für seinen Traum aus – eine beachtliche Summe, aber kein Vermögen, jedenfalls verglichen mit dem, was andere Tennisfamilien in Ländern ohne staatliche oder verbandsseitige Unterstützung aufbringen.
In Biel war Federer von neuen, aber auch von sehr vertrauten Einflüssen umgeben. Eine der neuen Stimmen war Groeneveld, ein hochgewachsener, gutaussehender junger Niederländer, der als Trainer schon Mary Pierce zum Titel bei den Australian Open 1995 und Michael Stich ins Finale der French Open 1996 geführt hatte, später auch Ana Ivanovic und Maria Sharapova zu Grand-Slam-Titeln.
Groeneveld war von Stephane Oberer angeheuert worden, dem langjährigen Trainer von Rosset, der auch Kapitän des Schweizer Davis-Cup-Teams war und das neue Leistungszentrum leitete.
Ein weiterer Neuer in Biel war Peter Lundgren, ein gutmütiger Schwede, der einst auf Platz 25 der Weltrangliste gestanden und es dann als Coach geschafft hatte, den widerspenstigen und hochtalentierten Chilenen Marcelo Ríos in die Top 10 zu führen.
Lundgren erzählte mir, dass sein Entschluss, die Stelle anzutreten, nicht zuletzt wegen Federer fiel.
„Mein Manager rief mich an und sagte: ‚Es gibt da einen Job in der Schweiz. Sie möchten, dass du dich um diesen jungen, aussichtsreichen Spieler Roger Federer kümmerst‘“, erzählte Lundgren. „Es war eine schwierige Entscheidung. Meine Familie lebte in Schweden. Wir hatten gerade eine Tochter bekommen, deshalb zog ich erst allein runter. Anfangs war es nicht leicht.“
Man hatte sich nicht um eine Unterkunft für ihn gekümmert. Groeneveld war sein Freund, ansonsten stellte die Sprachbarriere oft eine Herausforderung dar.
„Als ich ankam, hatte ich dieses komische Gefühl im Bauch“, sagte Lundgren. „Das werde ich nie vergessen. Ich dachte: ‚Ob das die richtige Entscheidung war?‘“
Der Schweizerische Tennisverband stellte bald einen weiteren Peter ein: Peter Carter, den man aus Basel und vom Tennisclub Old Boys mit der Aussicht wegköderte, wieder auf Federer zu treffen. Carter hatte sich mittlerweile in Basel gut eingerichtet, weshalb auch ihm die Entscheidung schwerfiel.
„Peter zögerte, Basel zu verlassen, aber ich erzählte ihm von meinen Plänen, ihn maßgeblich mit Rogers Entwicklung zu betrauen“, sagte Groeneveld.
Während Lundgren sich zunächst auf ältere Spieler wie Ivo Heuberger konzentrierte, die schon auf dem Sprung in die Profikarriere waren, richtete Carter sein Augenmerk auf jüngere Spieler im Übergang. Zu dieser Gruppe gehörten Federer, Allegro, Michael Lammer und Marco Chiudinelli, Federers Freund aus Jugendtagen.
Es war eine vielversprechende Gruppe, und obwohl nur Federer es zu Weltruhm brachte, erzielten auch die anderen einige beachtliche Erfolge als Tennisprofis. Das galt auch für Michel Kratochvil, der ebenfalls in Biel trainierte.
Sie alle trieben sich gegenseitig in dieser prägenden Phase an – nicht selten ein Schlüssel zum Erfolg im Tennis, denn auf sich allein gestellt kann ein Spieler nicht zu Höchstleistungen auflaufen. Ob an der Bollettieri Tennis Academy in Bradenton, Florida in den 1980er-Jahren, auf den Sandplätzen von Barcelona in den 1990ern oder in den Moskauer Clubs in den Nullerjahren: Wo immer es gelang, talentierte Jugendliche Tag für Tag zusammenzubringen, um ihre Grenzen und emotionale Belastungsfähigkeit auszutesten, hat sich dies als Erfolgsformel erwiesen.
Keiner wusste das besser als Lundgren. Er gehörte zur schwedischen Tennisgeneration, die auf Björn Borg folgte. Dieses langhaarige Teenageridol mit dem Pokerface war ein Serien-Champion. Borg war der Inbegriff des kühlen Blonden aus dem Norden, obwohl er in seiner Jugend ein feuriges Temperament hatte (klingt bekannt, oder?). Er war einer der ersten Superstars der Open-Ära.
Der 1965 geborene Lundgren entstammt derselben schwedischen Generation wie Mats Wilander und Stefan Edberg, die beide Platz eins der Weltrangliste erreichten und zu der auch Anders Järryd, Joakim Nyström, Mikael Pernfors, Henrik Sundström, Jonas Svensson und Kent Carlsson gehörten, alles Spieler, die es in die Top 10 schafften (Järryd war außerdem die Nummer eins im Doppel).
Bei den French Open im Jahr 1987, als Borg schon nicht mehr Profispieler war, wies das 128 Spieler zählende Teilnehmerfeld im Herreneinzel allein 18 Schweden auf – erstaunlich für ein Land mit nur neun Millionen Einwohnern, langen Wintern und wenigen Hallenplätzen.
„Ich stand auf Platz 25 der Weltrangliste und gleichzeitig in Schweden nur auf Platz 7“, sagte Lundgren. „Das sagt viel.“
Die in Biel versammelten Schweizer kamen an die kollektiven Erfolge der Schweden nicht heran, aber auch sie erlebten, dass man gemeinsam stark ist.
„Unser Teamgeist war sehr wichtig“, erzählte mir Michael Lammer. „Wir hatten großartige Trainer. Die Atmosphäre war entspannt. Uns jüngere Spieler hat stark beeinflusst, dass wir täglich den Schweizer Topspielern aus verschiedenen Generationen zusehen konnten. Ich glaube, das hat uns sehr motiviert.“
Federer wohnte jetzt nicht mehr bei einer Gastfamilie. Mit dem Segen und der finanziellen Unterstützung seiner Eltern bezog der 16-Jährige eine kleine Wohnung, die sein drei Jahre älterer Freund Allegro angemietet hatte und in der Nähe des Leistungszentrums lag.
Die erste Herausforderung war, pünktlich zum Training zu erscheinen und sein Zimmer sauber zu halten.
„Nicht seine Stärke“, sagte Allegro lachend. „Er spielte viel auf seiner PlayStation.“
Mit Allegro, dem späteren Juniorentrainer des Verbands, sprach ich 2019 bei einem Mittagessen im Leistungszentrum, gut 20 Jahre nachdem Federer und er dort anfingen.
Er wies auf einen der sechs Sandplätze, die man durch das Panoramafenster des Restaurants Topspin sieht.
„Roger und ich waren die Ersten, die hier trainierten“, sagte Allegro. „Am 15. August 1997 standen wir zusammen mit Peter Lundgren auf diesem Platz.“
Seit Federers Zeiten hat sich im Haus des Tennis viel verändert. Mittlerweile sind ein vierstöckiges Bürogebäude und ein Wohnheim hinzugekommen, von den Balkonen blickt man auf die Sandplätze gleich darunter. Es gibt eine 2017 fertiggestellte Tribüne mit Platz für 2500 Zuschauer, die bei Veranstaltungen wie dem Swiss Davis Cup oder dem King Cup zum Einsatz kommt.
Federers Erfolge haben diese Erweiterungen mit ermöglicht, und obwohl er nur noch selten vor Ort ist, ist er doch überall präsent. Große Fotos von ihm zieren die Wände, auch Fotos von dem späteren Schweizer Grand-Slam-Gewinner Stan Wawrinka.
An der Außenwand der Tennishalle klebt ein Foto in der Größe einer Reklametafel, das Federer, Wawrinka und die anderen Mitglieder des siegriechen Davis-Cup-Teams von 2014 zeigt. Es ist von der Roger-Federer-Allee aus zu sehen.
Nur eine weitere Straße ist noch nach ihm benannt – und zwar in Halle, wo er das Rasenturnier mehr als ein Jahrzehnt lang dominierte.
„Es ist eine sehr kleine Straße, kaum hundert Meter lang“, sagte Federer 2016 bei der Einweihungsfeier in Biel. „Aber Deutschland ist nicht die Schweiz. Hier eine Straße zu haben, bewegt mich viel mehr. Ich hoffe, dass hier immer eine Menge los sein wird, mit vielen jungen Spielern, die genau wissen, dass sie hier nicht im Urlaub sind, und die nicht vor großen Träumen zurückschrecken. Die nicht nur Profis werden wollen – dazu genügt ja schon ein einziger ATP-Punkt –, sondern die davon träumen, Wimbledon oder den Davis Cup zu gewinnen. Oder vielleicht auch, dass eine Straße nach ihnen benannt wird.“
Kaum zwei Wochen nach Allegros und Federers Ankunft in Biel waren sie nicht mehr nur Hausgenossen und Trainingspartner, sondern auch Rivalen: als Teilnehmer in mehreren Schweizer SatelliteTurnieren, der niedrigsten Stufe im Profitennis.
In jenen Jahren waren Satellite-Turniere oft so etwas wie ein Tenniszirkus im Kleinformat – drei Turniere in Folge, die im Verlauf von drei Wochen ausgespielt wurden, gefolgt von einem „Masters“-Wettkampf für die Topspieler.
Die erste Etappe dieses Satellite-Turniers, das vom 23. August bis zum 21. September dauerte, trug sich in Biel auf einem Sandplatz in einem kleinen Club zu. Federer errang seinen ersten Sieg als Profispieler, als er in der ersten Runde mit 7:5, 7:5 gegen Igor Tchelychev gewann, einen Russen, der mit seinen 20 Jahren schon in den Top 400 angekommen war.
„Tchelychev war ein hochgewachsener Typ, athletisch und ein echter Russe, weißt du“, sagte Allegro. „Er hatte eine tiefe Stimme. Dass Roger dieses Spiel gewann, legte die Grundlage für sein gesamtes Satellite-Turnier, er begann richtig gut zu spielen.“
Federer gewann zwei weitere Spiele in Biel, bevor er im Halbfinale Agustin Garizzio unterlag, einem 27-jährigen in der Schweiz lebenden Argentinier, der in den lokalen Turnieren Angst und Schrecken verbreitete, vor allem auf Sand. Sein höchstes ATP-Ranking erreichte er 1998 mit Platz 171.
Garizzio war an Nummer eins gesetzt und schlug Federer eine Woche später erneut, als sie beim zweiten Turnier der Satellite-Serie in Nyon in Runde zwei wieder aufeinandertrafen. Dennoch war er von dem Jugendlichen tief beeindruckt. Beide Matches waren über drei Sätze gegangen, und in beiden Fällen musste sich Garizzio nach dem Verlust des ersten Satzes wieder fangen.
„In Nyon ging ich mitten im Match zu einem Freund, der uns zusah, und sagte: ‚Dieser Junge – sobald er das Spiel mit seiner Rückhand bestimmen kann, wird er die Nummer eins sein‘“, erzählte Garizzio der Schweizer Zeitung Le Matin Dimanche. „Ich spielte da gegen einen Jungspund auf der anderen Netzseite, der ein Tänzchen aufführte.“
Beim dritten Satellite-Turnier der Serie, ausgetragen in Noës, erreichte Federer das Halbfinale. Einer seiner Gegner war Joel Spicher, ein junger Schweizer, den Federer in der zweiten Runde in drei Sätzen mit 6:3, 0:6, 6:4 schlug.
„Das Spiel wurde durch einen oder zwei Punkte im dritten Satz entschieden“, berichtete Spicher Le Monde Dimanche. „Seine Fähigkeit, bei wichtigen Punkten unglaubliche Risiken einzugehen, machte mich sprachlos. Er schlug Bälle, die ich für schwer einschätzbar hielt, mit einer Erfolgsquote, die mich wahnsinnig machte.“
Spicher blieb im Laufe der Jahre nicht der Einzige, der zu dieser Erkenntnis kam.
Federer qualifizierte sich für das Masters, das Endturnier der Serie, das in Bossonnens nahe Lausanne stattfand. Auch Allegro qualifizierte sich, und die beiden Hausgenossen pendelten täglich von Biel aus mit Peter Lundgren in dessen blauem Peugeot 306.
„Wir tauften den Wagen ‚Blaue Flamme‘, weil der Motor so schwach war“, sagte Allegro. „Wir lachten uns darüber ziemlich kaputt.“
Nachdem Allegro und Federer ihr Auftaktmatch gewonnen hatten, standen sie sich im Viertelfinale gegenüber. Sie spielten sich gemeinsam ein und betraten dann den Platz, um gegeneinander anzutreten. Es gab keine Ballkinder. Allegro und Federer mussten ihre Linienrichterentscheidungen selbst treffen, und das Spiel endete in einem ordentlichen Gerangel, das Allegro mit 7:6, 4:6, 6:3 gewann.
Allegro erinnerte sich, dass Federer zu Beginn des dritten Satzes etwas ins Auge geriet und er deshalb allmählich seinen Rhythmus und auch seine Beherrschung verlor.
„Am Ende des Spiels weinte Roger ziemlich heftig“, sagte Allegro. „Er weinte 20 Minuten lang, dann war es vorbei. Abends aßen wir wieder zusammen.“
Das Publikum bestand bei diesem Spiel wohl nur aus Lundgren, Federers Vater Robert und dem Turnierschiedsrichter Claudio Grether.
„Claudio war ein erfahrener Schiedsrichter“, sagte Allegro. „Und nach dem Match kam er zu mir und sagte: ‚Bravo, Herr Allegro, aber das war heute das letzte Mal, dass Sie Federer geschlagen haben.‘ Und wissen Sie was? Er hatte recht.“
Von da an musste sich Allegro mit dem einen oder anderen Sieg bei Trainingsmatches begnügen.
„Tatsächlich habe ich Roger sogar geschlagen, als er die weltweite Nummer eins war“, sagte Allegro. „Manchmal war das gar nicht schwer, aber für offizielle Matches galten andere Regeln.“
Die Qualifikation für das Masters in Bossonnens war in mehrerlei Hinsicht eine Belohnung. Vor allem sicherte es ATP-Ranglistenpunkte.
Für jeden Spieler ist die Erfahrung, die ersten dieser Punkte zu verbuchen, ein besonderer Moment. „Wie der Kauf deines ersten Autos“, sagte mir einmal der US-Tennisstar Jim Courier.
Federers 16. Geburtstag lag erst wenige Wochen zurück, er besaß noch keinen Führerschein, aber am Montag, dem 22. September, hatte er seine ersten Weltranglistenpunkte: zwölf, um genau zu sein.
Damit lag er in der ATP-Rangliste auf Platz 803, gleichauf mit Daniel Fiala aus Tschechien, Clement N’Goran von der Elfenbeinküste und Talal Ouahabi aus Marokko.
Federer erinnerte sich, wie er die ATP-Website aufrief und dort seinen Namen fand.
„Ein Meilenstein“, so Federer viele Jahre später in einem Gespräch mit mir über jene ersten Weltranglistenpunkte. „Genauso wie die Top 100, die Top 10 oder die Nummer eins zu erreichen. Das sind die Highlights, auf die man sich freut.“
Doch nur wenigen ist es natürlich gegeben, alle diese Meilensteine zu erreichen. Weder Fiala noch N’Goran oder Ouahabi kamen auch nur auf Platz 250 der Rangliste. Federer hingegen stand am Beginn eines außergewöhnlichen Aufstiegs.
Aber als in jener Woche die ATP-Rangliste veröffentlicht wurde, war er nicht der einzige junge Newcomer, der sich auf Seite 9 wiederfand: Platz 808 belegte Lleyton Hewitt, ein weiterer künftiger Weltranglistenerster und US-Open- sowie Wimbledon-Champion.
Hewitt erwarb seine ersten Punkte mit 15 Jahren, ebenso wie einige Jahre später Rafael Nadal. Zu denen, die wie Federer ihre ersten Punkte ebenfalls mit 16 Jahren erspielten, gehören Novak Djokovic, Andy Murray und Stan Wawrinka.
Schon vor jenem Satellite-Turnier war Lundgren klar, dass er gut daran getan hatte, nach Biel zu kommen.
„Als ich Roger zum ersten Mal sah, dachte ich zu mir: ‚Dieser Junge wird mal ein Superstar, keine Frage‘“, sagte Lundgren. „Das war mir völlig klar, denn ich hatte vorher schon mit Ríos gearbeitet, der ein ähnliches Talent hatte – allerdings eine andere Persönlichkeit.“
Als ich darüber lachte, fiel Lundgren lachend ein.
„Ich versuche, mich diplomatisch auszudrücken“, sagte er.
Es sei nebenbei erwähnt, dass Lundgren Federer aus ihrer ersten gemeinsamen Trainingseinheit warf, weil er sich schlecht benahm – allerdings nicht ohne zuvor seine geschmeidige, explosive Vorhand zu bewundern.
„Okay, er war faul, aber seine Vorhand war einfach unglaublich“, sagte Lundgren. „Und ich war mir sicher, dass diese Vorhand richtig gigantisch werden würde, wenn er einmal älter und stärker war.“
Von anderen Elementen des Tennisspiels, das der 16-jährige Federer zeigte, war Lundgren weniger beeindruckt.
„Physisch war er schwach“, sagte Lundgren. „Und seine Rückhand hatte einen schönen Schwung, aber da war keine Beinarbeit, gar nichts.“
Bevor er die Stelle beim Schweizerischen Tennisverband annahm, hatte er an einem Trainingslager des Verbands teilgenommen und auch einen eingehenden Blick auf Federer geworfen. Er erkannte schnell dessen Potenzial, wie auch die Herausforderungen.
„Ich sah, wie stur er war, auch wie verspielt – ungeheuer verspielt“, verriet mir Groeneveld.
Mit diesem Adjektiv wurde der junge Federer oft beschrieben, und man hört es auch heute noch von Menschen, die ihn gut kennen oder erlebt haben, wie er sich hinter einer Tür versteckte, um sie zu erschrecken.
Doch was genau verstand Groeneveld unter „verspielt“?
„Es war eine wettbewerbsorientierte Verspieltheit“, sagte er. „Er empfand alles als Spiel, ob auf oder neben dem Platz oder im Gespräch. Selbst wenn man sich heute ganz zwanglos mit ihm unterhält, ist da immer ein Wettbewerbselement, ob in Form eines Witzes oder einer ernsthaften Bemerkung. Wegen seiner Verspieltheit fiel es ihm damals schwer, konzentriert und wirklich bei einer Sache zu bleiben. Er brauchte viel Abwechslung, und wenn er die nicht bekam, verwandelte er sich umgehend in einen Quälgeist.“
Die Lösung? Abwechslung für alle.
„Ich behaupte nicht, dass Roger unsere gesamte Gruppe steuerte, aber weil alle im selben Leistungszentrum trainierten, konnte Roger eben zum Störenfried werden“, sagte Groeneveld. „Deshalb mussten wir der gesamten Gruppe viel Abwechslung bieten.“
Das bedeutete, dass „PC“ und „PL“, wie Peter Carter und Peter Lundgren bald genannt wurden, sich oft für kreative und schnell wechselnde Übungen entschieden und ihre Schützlinge zum Crosstraining in verschiedenen Sportarten schickten.
Sie ergänzten den Lehrplan um Squash, Badminton, Fußball, Tischtennis und Floorball, um immer wieder neue Elemente zu bieten, und vor allem, um den jungen Federer mit dem Kopf bei der Stange zu halten.
Groeneveld besitzt noch ein Polaroidfoto aus jenen Tagen, das während einer Trainingseinheit entstand und auf dem Federer enttäuscht aussieht. Federer schrieb unter das Foto: „Ich habe keine Lust.“
„Er langweilte sich oft“, sagte Groeneveld. „Ihm war dann eher danach, auf der PlayStation zu spielen oder etwas anderes zu tun. Und wenn ihm langweilig war oder er keine Lust hatte, tat man gut daran, ihn nicht auf den Platz zu zwingen, denn dann verdarb er allen den Tag. Trotzdem war er ein guter Junge, man konnte ihm nicht wirklich böse sein.“
Man konnte ihn aber sanktionieren. In diesem ersten Jahr in Biel wurde die Mahnung ausgesprochen, die neue, maßgeschneiderte Ausstattung der Hallenplätze nicht zu beschädigen, darunter ein schwerer und teurer lärmhemmender Vorhang mit den Namen der Sponsoren des Schweizerischen Tennisverbands.
Alles ging so lange gut, bis Federer nach einer frustrierenden halben Trainingsstunde seinen Schläger wegwarf und zu seiner Überraschung und Bestürzung mit ansehen musste, wie der Schläger den Vorhang durchschnitt und gegen die Begrenzungswand schepperte. In dem Objekt, das in Federers Augen viel robuster ausgesehen hatte, klaffte nun ein Spalt.
„Er ging da durch wie ein heißes Messer durch ein Stück Butter“, erinnerte sich Federer.
Sein erster Gedanke war: „Was für eine miese Qualität, dieser Vorhang.“ Sein zweiter, dass er jetzt ein großes Problem hatte.
Federer ging zu seinem Stuhl, nahm sich seine Ausrüstung und verließ die Halle, während Lundgren den Kopf schüttelte und ihn an die Abmachung erinnerte.
„Ich dachte, dass man mich rausschmeißen würde, denn wir waren ja gewarnt worden“, sagte Federer.
Groeneveld war wenig geneigt, einen jungen Spieler zu beurlauben oder zu verjagen, aber er hielt viel von Konsequenzen. Federer war als Nachteule und Langschläfer bekannt und wurde nun dazu verdonnert, in jenem Winter eine Woche lang frühmorgens die Hallen und Sportanlagen, einschließlich der Toiletten, zu reinigen.
Diese Episode wurde ein wesentlicher Teil der Federer-Erzählung: Er erfuhr hier liebevolle Strenge, die ihm klarmachte, dass Regeln auch für junge Tennisgenies gelten, jedenfalls in der Schweiz.
„So war ich als Teenager, ich musste ständig die Grenzen ausloten“, sagte Federer fast 20 Jahre später in Biel. „Dasselbe machen heute meine Kinder mit mir. Es ist nur logisch.“
Fairerweise muss man Federers Verhalten etwas relativieren. Abseits des Platzes war er kein Teufelsbraten, und auf dem Platz verhielt er sich auch nicht schlimmer als viele andere in seinem Alter, die ein Spiel perfekt beherrschen wollen, das sich nicht perfekt beherrschen lässt. Viele seiner Ausbrüche richteten sich in erster Linie gegen sich selbst, auch wenn sie nach einem Punktverlust oft so interpretiert werden konnten, als würde er das Können seines Gegners in Abrede stellen.
Lammer, der Federer seit Kindheitstagen kennt und gegen ihn gespielt hat, bestätigte zwar die mangelnde Beherrschung, er ist aber auch davon überzeugt, dass dieses Thema durch Federers Erfolg überhöht wurde.
„Natürlich hat er sich im Verlauf seiner Karriere enorm entwickelt, aber viele junge Kerle, die talentiert und von ihrem Sport begeistert sind und etwas erreichen wollen, sind doch ebenso emotional“, sagte er. „Sie können auch keine Niederlage oder die Gründe dafür akzeptieren. Roger hat vielleicht seine Schläger weggeworfen, aber das taten andere auch. Er war wirklich nicht der Schlimmste von allen, überhaupt nicht. Wer behauptet, dass er ständig ausrastete, übertreibt.“
Doch die Sorge bestand zweifelsohne, bei Federer selbst, seiner Familie und auch bei seinen Trainern. Groeneveld zufolge kamen Carter, Lundgren und Federers Eltern zu dem Schluss, dass Federer von einem Sport- oder Leistungspsychologen profitieren würde.
„Es schien allen das Beste zu sein, wenn es jemand wäre, der nicht zu alt war, aus seiner Heimatregion stammte und eine große Leidenschaft mit Roger teilte, nämlich Fußball“, sagte Groeneveld. „Es sollte möglichst viele Dinge geben, mit denen er sich identifizieren konnte.“
Die Suche führte 1998 nach Basel und zu Christian Marcolli. Der 25-Jährige war mehrere Jahre lang Schweizer Profifußballer gewesen – unter anderem drei Jahre bei Federers Lieblingsverein FC Basel –, bevor seine Spielerlaufbahn nach mehreren Knieverletzungen und Operationen schon mit Anfang 20 endete. Da musste er seine „gesamte Lebensplanung überdenken“, so Marcolli.
Er begann sich für Leistungspsychologie zu interessieren, ein vergleichsweise neues Fachgebiet in der Schweiz, obwohl die Psychologie dort bekanntlich stark verwurzelt ist (man denke an Namen wie Carl Jung und Jean Piaget).
Marcolli befand sich gerade in seinem Masterstudium an der Universität Basel, als er begann, Federer zu unterstützen. Später promovierte er in Angewandter Psychologie an der Universität Zürich.
„Unter den Spielern des FC Basel bin ich der einzige Promovierte, in 190 Jahren“, sagte Marcolli lachend, als wir 2021 via Zoom miteinander sprachen.
Später arbeitete er mit zahlreichen prominenten Sportlern, darunter dem Torhüter der Schweizer Fußballnationalmannschaft Yann Sommer und den beiden Skirennfahrerinnen und Olympiasiegerinnen Dominique und Michelle Gisin.
Federer und Carter erfuhren durch einen Zeitungsartikel von Marcollis beruflicher Neuorientierung. Federer kannte ihn aus seiner Zeit als Spieler.
So wurde er einer von Marcollis ersten Kunden. Laut Groeneveld ging es darum, Federer ein paar Werkzeuge an die Hand zu geben, um seine Verhaltensmuster zu ändern und Emotionen zu steuern, insbesondere wenn ein Spiel eng zu werden drohte.
Ganz neu war der Ansatz sicher nicht. Schon knapp 25 Jahre zuvor, im Jahr 1974, war Timothy Gallweys Buch Tennis – Das innere Spiel erschienen, das heute ein Klassiker ist. Es zeigt auf, wie die persönlichen Ressourcen optimal genutzt werden können.
Als Ivan Lendl in den 1980er-Jahren auf dem Weg zur Weltspitze war, arbeitete er mit dem US-amerikanischen Sportpsychologen Alexis Castorri, den er eines Abends in einem Denny’s-Restaurant in Boca Raton, Florida getroffen hatte. Lendl war niedergeschlagen, denn er hatte gegen Edberg verloren. Mithilfe von Castorri eignete er sich Techniken an, die damals sehr fortschrittlich waren: Auch während eines Matches nutzte er Visualisierungen und führte Selbstgespräche, um seine Konzentrationsfähigkeit zu steigern und Flow anzuregen („Ivan Lendl ergreift sein Handtuch. Ivan Lendl wischt sich über das Gesicht. Ivan Lendl hält den Ball in einer Hand und bereitet sich auf den Aufschlag vor …“)
Marcolli ist ein charismatischer Gesprächspartner und guter Erzähler, selbst in seiner Zweit-(oder Dritt-)Sprache Englisch. Ich fragte ihn, was Tennis aus leistungspsychologischer Sicht von anderen Sportarten unterscheide.
„In psychischer Hinsicht ist es vermutlich die schwerste Sportart, vielleicht zusammen mit Golf“, antwortete er. „Wenn man selbstsicher ist, ist jede Sportart einfach. Ist man es nicht, dann ist Tennis ein sehr einsamer Sport. Denn so ein Spiel ist nicht schnell vorbei. Beim Skifahren dauert das Rennen eine Minute, und schon kann man nach Hause gehen, aber wenn man die Nettospieldauer betrachtet, ist Tennis brutal.“
Schwierig ist auch, dass während eines Spiels offiziell kein Coaching erlaubt ist, auch wenn es oft versteckt abläuft.
„In anderen Sportarten können die Trainer eine Auszeit einfordern oder Anweisungen hineinrufen“, sagte Marcolli. „Natürlich findet beim Tennis großartige Teamarbeit statt, bei der Vorbereitung, Strategie und so weiter, aber während des Matches ist man auf sich allein gestellt.“
Es gibt außerdem viel mehr Zeiten, in denen ein Spieler inaktiv ist, als aktiv. Es dauert vielleicht fünf bis zehn Sekunden, einen Punkt auszuspielen, aber zwischen zwei Punkten vergehen 20 oder 25 Sekunden. In einem Match, das über fünf Sätze geht, kommt da eine Menge Zeit zusammen, um dunklen Gedanken nachzuhängen.
„Die Unterbrechungen sind hilfreich, wenn man sie zu nutzen weiß“, so Marcolli. „Sie bieten einem riesige Chancen. Ich würde sogar behaupten, dass man in den Inaktivitätsphasen das Spiel für sich entscheiden kann.“
Marcolli legt sein Hauptaugenmerk auf die Intentionalität zwischen Punkten: Um sich maximal konzentrieren zu können, sollen die Spieler ihren Atemrhythmus und ihre Blickrichtung steuern.
„Ich schaue immer darauf, was du mit deinen Augen machst“, sagte er. „Und dann gibt es für mich noch ein wesentliches Element: Bist du mit dir selbst im Reinen? Steht dein Lebensentwurf im Wesentlichen, sodass du deinen Moment hier mit ganzem Herzen genießen kannst? Oder wärst du lieber irgendwo anders, um ein Problem zu lösen?“
Es ist Federer hoch anzurechnen, dass er schon in recht jungem Alter bereit war, an seinen mentalen Schwächen zu arbeiten. Er hat davon profitiert. Zu Beginn seiner Zusammenarbeit mit Marcolli war er noch keine 17 Jahre alt.
Als Teenager war es Marcolli selbst schwergefallen, seine Emotionen unter Wettbewerbsbedingungen zu steuern. „Ich musste erst lernen, auch unter Druck anständig zu bleiben“, schrieb er in seinem 2015 veröffentlichten Buch More Life, Please! The Performance Pathway to a Better You. „Mit 17 ging ich mit dem Kopf durch die Wand, wenn es schwierig wurde. Ich zeigte die nötige Spielleidenschaft, setzte sie aber nicht kontrolliert ein.“
Genau dies erkannte er auch bei Federer.
„Roger hatte immer einen Siegeswillen“, erklärte Marcolli einmal der französischen Sportzeitung L’Équipe. „An einem bestimmten Punkt seiner Laufbahn beschloss er, diese Energie konstruktiv zu nutzen und so sein Potenzial voll auszuschöpfen. Darauf lag der Schwerpunkt unserer Arbeit.“
Ihre Zusammenarbeit dauerte rund zwei Jahre. Danach waren Federers Probleme sicher nicht vollständig gelöst, aber er eignete sich bei Marcolli Techniken an, mit denen er sich weiter steigerte.
„Das war ein Schlüssel zum Erfolg“, sagte Lynette Federer 2005 gegenüber L’Équipe. „Ich glaube, dass er diese Techniken auch heute noch auf dem Platz einsetzt. Ich habe noch nie mit ihm darüber gesprochen. Es ist seine Welt, nicht meine, aber für mich ist es offensichtlich.“
Groeneveld stimmte dem zu. „Das Verhältnis war wirklich intensiv, fast wie eine enge Freundschaft, wie zu einem Bruder, den er nicht hatte“, sagte er über Federers Beziehung zu Marcolli. „Er ging darin auf.“
Federer selbst hat sich öffentlich niemals so weitgehend geäußert und Marcolli im Laufe der Jahre nur selten erwähnt. In einem unserer frühen Interviews bestätigte er allerdings, von ihm profitiert zu haben.
Lundgren bemerkte jedenfalls eine Veränderung: „Natürlich half es ihm. Es liegt auch im Ermessen des Spielers, das Angebot anzunehmen. Entweder glaubt man an die Botschaft oder nicht. Bei Roger kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie ihm wirklich gefiel, aber er ließ sich darauf ein. Es ist nicht leicht, sich so etwas anzuhören, vor allem wenn man so jung ist und eine solche Persönlichkeit besitzt, wie er sie hat oder hatte. Es war schwer für ihn.“
Die Entscheidung, einen Leistungspsychologen aufzusuchen, wurde damals noch häufig als Zeichen von Schwäche aufgefasst. Es passte auch nicht zu dem knallharten Individualismus, für den sich Federer entschieden hatte. Immer wieder bestritt er längere Phasen ganz ohne formalen Trainer oder Manager.
Groeneveld erzählte: „Wir stellten halt fest, dass wir als Trainer nicht das bieten konnten, was Roger brauchte. Seine Eltern konnten es auch nicht. Hier war unabhängiger Rat gefragt, einfach jemand, der ihm zur Seite stand.“
Im Sport und im Tennis hat seitdem eine bemerkenswerte Entwicklung stattgefunden. Heute beschäftigt eine Spielerin wie die French-Open-Gewinnerin von 2020, Iga Swiatek, eine hauptamtliche Sportpsychologin: Daria Abramowicz sitzt mit in ihrer Spielerbox.
Marcolli hat zusammen mit den Gisin-Schwestern, zwei seiner anderen Starkunden, mehrere Bücher geschrieben. Doch auf Wunsch von Federer haben weder Marcolli noch er öffentlich detailliert über ihre gemeinsame Arbeit gesprochen.
„Wir einigten uns relativ früh darauf“, erzählte mir Marcolli.
Fest steht – aus dem erfolgreichen Nachwuchstalent Federer wurde bald ein überragender Spieler.
Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keinen größeren Titel gewonnen. Nicht Les Petits As, das renommierte U14-Turnier im französischen Tarbes, wo er 1995 im Achtelfinale ausschied. Nicht die Europameisterschaft der Junioren, wo er 1997 im Halbfinale des U16-Wettbewerbs unterlag.
Doch im zweiten Halbjahr 1998 begann sein Stern zu leuchten. Nachdem er im Januar im Halbfinale der Junioren bei den Australian Open ausgeschieden war und im Juni in der ersten Runde des Juniorenwettbewerbs der French Open eine enttäuschende Niederlage einstecken musste, traf er mit neuem Selbstbewusstsein und in gelassenerer Verfassung in Wimbledon ein, um dort erstmalig bei den Junioren mitzuspielen.
Sein Spiel und sein Aufschlag auf Rasen waren bestechend, auf dem Weg ins Finale gab er nicht einen einzigen Satz ab. Dort traf er auf Irakli Labadze, einen talentierten, aber unsteten linkshändigen Georgier.
Das Finale wurde auf Platz Nummer 2 ausgespielt, den es heute nicht mehr gibt. Er trug den Spitznamen „Friedhof“, denn hier hatten zahlreiche Topspieler gegen schwächer eingeschätzte Konkurrenten verloren, etwa John McEnroe gegen Tim Gullikson 1979.
Federer, der kurz vor seinem 17. Geburtstag stand, legte an diesem sonnigen Tag ein halsbrecherisches Tempo vor. Er ließ zwischen den Punkten kaum Zeit verstreichen und wirbelte durch nahezu sämtliche seiner Aufschlagsspiele. Den ersten Satz gewann er in nur 22 Minuten mit 6:4, nachdem er seinen letzten Aufschlag in knapp einer Minute zu Null durchgebracht hatte.
Sein braunes Haar war damals kurz, und er trug kein Stirnband. Das Outfit – gesponsert von Nike, wo er bereits unter Vertrag war – war weit geschnitten und ähnelte der Kleidung, die eines seiner Tennisidole, Pete Sampras, im selben Jahr trug.
Beim Aufschlag streckte Federer bisweilen die Zunge aus dem Mundwinkel heraus, wie eines seiner anderen Idole, der NBA-Star Michael Jordan. Federer hatte eine weitere Angewohnheit, die er später ablegen würde: Zwischen Punkten ließ er den Ball mit einer schnellen Schlägerbewegung durch seine Beine am Boden aufprallen und fing ihn hinter seinem Körper ein, um ihn anschließend auf gleichem Wege zurückzubefördern. Es war ein auffälliger, schneller Trick, typisch für Federer, der sich nicht nur aufs Match konzentrierte, sondern eben auch mit dem Ball spielte. Hätte er ihn während seiner Profikarriere beibehalten, wäre er wohl eins seiner Markenzeichen geworden. So blieb es eine Jugendlaune.
Bemerkenswert war auch, dass Federer im Finale nicht Serve-and-Volley spielte, zu jener Zeit immer noch die Standardspielweise seiner Vorbilder auf Rasen. Federer und Labadze hätten genauso gut auf einem Hartplatz spielen können. Hier ließ sich erahnen, wie Wimbledon künftig gewonnen werden würde.
Federers laterale Geschwindigkeit war schon damals außergewöhnlich. Damit konnte er Labadze überraschen, indem er Ballwechsel verlängerte oder sie mit einer kurzen Handgelenksbewegung bei gestrecktem Arm beendete. Und dennoch stand er aufrechter in der Beinarbeit als später in seiner Glanzzeit. Sein Splitstep zwischen Schlägen war kleiner, seine Flexibilität weniger sichtbar, seine Richtungswechsel weniger präzise.
Auch sein Aufschlag, hier bereits eine seiner Hauptwaffen, unterschied sich von seinem späteren. Er bewegte sich schneller, sodass von der Einleitung bis zum Ballkontakt fast eine Sekunde weniger verstrich als im Wimbledon-Finale 2019 gegen Djokovic. Federers Gewicht ruhte nicht ganz so lang auf seinem vorderen Fuß, er holte nicht so tief und so weit hinter dem Körper aus, beugte das Knie nicht so tief und sprang dem Ball nicht mit so explosiver Kraft entgegen.
Wie zu erwarten spielte er oft eine Rückhand als Slice, doch wer sich dieses Spiel nach über 20 Jahren ansieht, stellt überrascht fest, dass er schon damals in Drucksituationen die Rückhand immer wieder gerade oder mit Topspin spielte.
Sein einziges Break im Eröffnungssatz gelang mithilfe eines klassischen Federer-Musters: Sein Chip-Return, mit der Rückhand ausgeführt, landete kurz hinter dem Netz, was Labadze dazu zwang, ans Netz vorzurücken und einen wenig überzeugenden Annäherungsschlag aus einer gebeugten Position auszuführen. Federer ergriff die selbst herbeigeführte Gelegenheit und schlug einen Winner mit einem Rückhand-Passierball.
Auch andere Schnörkel mit künftigem Wiedererkennungswert waren zu sehen, darunter der telegenste Schlag des Tages, ein Vorhand-Topspin-Lob-Winner aus der Defensive heraus, der kurz vor der Grundlinie landete.
Wie schade, dass nur wenige zugegen waren, um das zu genießen. Im Publikum saßen gerade einmal 200 Fans, und ein Zuschauer mittleren Alters hatte sich gar auf der Tribüne ausgestreckt, mit den nackten Füßen auf der Lehne eines angrenzenden Sitzes. Das entsprach nicht gerade dem Bild, das wir uns vom eleganten All England Club machen, und bot einen traurigen Kontrast zu dem ausverkauften Haus nebenan im Centre Court, wo Sampras sich einen Fünfsatzsieg gegen Goran Ivanisevic erkämpfte und damit Borgs Rekord einstellte, der ebenfalls fünf Wimbledon-Titel im Einzel errungen hatte.
Trotz seiner Flatterhaftigkeit hatte Federer seine Launen gegen Labadze weitgehend im Griff. Er zupfte oft an seinen Saiten herum – eine klassische Methode, um Ablenkungen auszuschalten –, verließ seine Blase aber gelegentlich auch, um zu gestikulieren oder auf Schweizerdeutsch vor sich hinzumurmeln.
Nur einmal drohte kurz ein Zusammenbruch: Es stand 1:1 im zweiten Satz bei Aufschlag Labadze und Einstand, als Federer eine Rückhand von Labadze verpasste, seinen Schläger wegwarf und sich selbst beschimpfte. Er lag mit einem Satz in Führung und hatte das Spiel unter Kontrolle. Warum also diese negative Haltung und riskieren, in die altbekannte Falle zu tappen?
Doch statt seinen Vorsprung und seinen Rhythmus zu verspielen, gelang es Federer, sich zu beherrschen. Es war Labadze und nicht Federer, der später eine Verwarnung erhielt, nachdem er im fünften Spiel des zweiten Satzes, in dem er schließlich einen Break kassierte, seinen Schläger weggeworfen hatte.
Der Titel war in Reichweite, und Federer schnappte ihn sich. Er gewann mit 6:4, 6:4, ohne einen einzigen Breakball gegen sich zu haben.
Trotz dieser beeindruckenden Leistung blieben manche Beobachter skeptisch. Es ahnte allerdings auch kaum jemand, wie sich das Rasentennis entwickeln würde.
„Ist Federer ein zukünftiger Wimbledon-Sieger?“, fragte Guy Hodgson von der britischen Tageszeitung Independent. „Vermutlich nicht, es sei denn, es gelingt ihm, seine Taktik zu variieren. Er ist auf Sand aufgewachsen, und das merkt man. Ans Netz geht er nur alle Jubeljahre einmal.“
Wie dem auch sei: Federer hatte gerade einmal 50 Minuten gebraucht, um das wichtigste Match seiner jungen Laufbahn für sich zu entscheiden. In der Rückschau war es vielleicht am überraschendsten, dass auf dem Platz keine Tränen flossen. Stattdessen hob er beide Arme, grinste breit und zeigte später erneut ein zufriedenes Lächeln, als er in der Royal Box auf dem Centre Court seinen Pokal aus den Händen der Herzogin von Kent empfing.
Der BBC-Kommentator Bill Threlfall beobachtete die Szene und teilte seinen Zuschauern voller Überzeugung mit: „Den werden wir wiedersehen.“
Eine zweifellos weitsichtige, aber auch riskante Prognose. Längst nicht jedem Sieger eines Grand-Slam-Juniorenwettbewerbs gelingt es, zu den ganz Großen aufzuschließen. Bis 2020 hat Wimbledon 69 verschiedene Sieger im Junioreneinzel hervorgebracht. Nur wenige davon errangen später einen Grand-Slam-Titel im Einzel und nur vier gewannen Wimbledon: Borg, Pat Cash, Stefan Edberg und Federer, der einzige Wimbledon-Juniorensieger der letzten 35 Jahre, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte.
Die Chancen stehen also wirklich nicht gut. In diesem Sport herrscht ein brutaler Wettbewerb, und ganz oben ist die Luft verdammt dünn. Zudem nehmen viele der hoffnungsvollsten Talente die Juniorenwettbewerbe nicht sonderlich ernst.
Federer, der 1998 zusammen mit Olivier Rochus auch das Juniorendoppel in Wimbledon gewann, trat seine Rückreise in die Schweiz zweifellos mit gestiegenem Ansehen und Selbstvertrauen an.
Er verließ London, ohne mit Sampras und den anderen Siegern am offiziellen Champions-Dinner von Wimbledon teilzunehmen – was er später dann bereute –, um sofort die nächste Herausforderung in Angriff zu nehmen.
Diese wartete in dem vornehmen Schweizer Skiort Gstaad, wo er zur rechten Zeit eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hatte – sein Einstand auf der ATP-Tour. Nach dem Rasen und den klimatischen Bedingungen in Wimbledon, das auf Meereshöhe liegt, war das ein schneller Wechsel zurück auf Sand und ins Hochgebirge. In der ersten Runde traf Federer am 7. Juli auf den argentinischen Veteran Lucas Arnold Ker.
Arnold Ker, Platz 88 der Weltrangliste, hatte es nur mit Glück in die Hauptrunde geschafft, weil sich der deutsche Star Tommy Haas mit einer Lebensmittelvergiftung aus dem Turnier zurückgezogen hatte.
„Man sagte mir, dass ich gegen einen Schweizer Junioren spielen würde“, berichtete Arnold Ker der argentinischen Zeitung La Nación 20 Jahre später. „Viel mehr Glück konnte man nicht haben. In der Schweiz gab es Marc Rosset, und das war’s im Grunde. Wenn die Wildcard ein Spanier gewesen wäre, hätte ich gesagt: ‚Okay, pass mal lieber auf‘, aber ein Schweizer verursachte mir keine Kopfschmerzen.“
Arnold Ker, ein starker Doppelspieler mit gutem Volley, machte sich Federers schwächere Seite zunutze: Er spielte Kick-Aufschläge hoch auf seine Rückhand und agierte unter den schnellen alpinen Bedingungen erfolgreich am Netz. Nach einer Stunde und 20 Minuten hatte Ker das Match mit 6:4, 6:4 gewonnen.
„Das Match war eng, aber als es vorbei war, kam mir nicht der Gedanke in den Sinn: ‚Dieser Junior wird ein ganz Großer‘“, sagte Arnold Ker. „Ich hätte nie gedacht, dass er mal eine Legende werden würde.“
Federer hatte sich darauf gefreut, gegen Haas zu spielen. Der Topspieler wurde später einer seiner engsten Freunde. Doch das Match gegen Arnold Ker fand immerhin auf dem zweitgrößten Showplatz statt und wurde von den Schweizer Fans und Medien sehr beachtet.
Der Brite David Law war in jenem Jahr als PR-Berater der ATP-Tour in Gstaad damit beauftragt, Federer beim Umgang mit der Presse zu unterstützen.
Für Law, der heute Moderator des Tennis Podcast ist, wie für Federer war es eine Premiere, aber Law erkannte schnell, dass Federers Debüt die Hauptstory der Woche war.
„Kaum war er angekommen, wollten sie eine Pressekonferenz mit ihm machen“, erinnerte sich Law. „Ich traf mich daher vor Turnierbeginn mit ihm, um eine Strategie zu schmieden, und ich weiß noch, wie völlig ahnungslos er war. Er wusste überhaupt nicht, wer ich war oder was meine Aufgabe war. Er fand es lustig, dass man sich so für ihn interessierte. Das gefiel mir sofort an ihm: die Verspieltheit, die Tatsache, dass er alles nicht so ernst nahm. Er war davon nicht gestresst.“
Bald sprach Federer mit den Reportern abwechselnd auf Schweizerdeutsch und Französisch – so wie auch in den folgenden Jahrzehnten.
„Alles war sehr ungezwungen“, sagte Law. „Er täuschte nichts vor, schauspielerte nicht, war niemals peinlich. Anders als viele andere Teenager wirkte er gar nicht wie einer.“
Das stellte auch Marc Rosset fest, als er den 16-jährigen Federer einlud, mit ihm in Genf zu trainieren.
Rosset, damals 27 Jahre alt, hatte mit einem nervösen Jungspieler gerechnet, bereit, durch Wände zu gehen, um den Älteren zu beeindrucken – so wie Rosset selbst, als der französische Star Henri Leconte ihn in seiner Jugend als Sparringspartner rekrutiert hatte.
„Roger war sehr entspannt, sehr gelassen, beinahe ungezwungen“, sagte mir Rosset. „Ich glaube, da spielte ein wenig der südafrikanische Einfluss hinein, den er von seiner Mutter mitbekommen hatte. Es war nichts Schweizerisches daran. Was mich damals wie heute an Roger fasziniert, ist, dass er es schafft, im Hier und Jetzt zu leben. Er hat ein großes Talent, Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Er lebt einen Moment, kostet ihn voll aus, genießt ihn, beendet ihn und geht dann zum nächsten über. Deshalb hat man den Eindruck, dass ihm Dinge ganz natürlich zufliegen. Das ist ein Talent, und wenn ich ehrlich bin, fasziniert mich diese Eigenschaft bis heute noch mehr als sein Tennis.“
Marcolli glaubt, dass auch Vertrauen eine große Rolle spielt. „Man kann trainieren, im Augenblick zu leben, dafür gibt es Techniken“, sagte er. „Aber die zweite Komponente ist das Vertrauen, dass sich das Leben in die richtige Richtung entwickelt, die Leute um einen herum einen guten Job machen und man sich um nichts sorgen muss. Und ich glaube, dass Roger es immer geschafft hat, sich mit Leuten zu umgeben, denen er vertrauen konnte. Es dauert eine Weile, bis man sich dieses Vertrauen verdient hat, aber wenn es da ist, wird nichts hinterfragt. ‚Bist du dir da sicher? Ist das die richtige Technik?‘ Solche Fragen kamen nie.“
Federer war in mancherlei Hinsicht trotzdem noch Teenager. Kurz nach dem Spiel in Gstaad stieß er als Trainingspartner zu Rosset und dem Schweizer Davis-Cup-Team, die sich auf ihr baldiges Match gegen Spanien in La Corogne vorbereiteten. Es war sein erstes Zusammentreffen mit dem Kader und auch eine Belohnung für seinen Sieg bei den Junioren in Wimbledon.
Rosset, der genau wusste, dass Federer das Potenzial hatte, dem Team jahrelang anzugehören, arrangierte, dass er in einem angrenzenden Zimmer mit Verbindungstür untergebracht wurde.
„Ich wollte ihn unter meine Fittiche nehmen, ihm das Gefühl geben, dass er Teil des Kaders ist“, sagte Rosset.
Rosset hatte seine PlayStation mitgebracht, die Federer natürlich magisch anzog. Bald wusste man kaum noch, wem das Zimmer gehörte.
„Einmal ging ich zum Training“, sagte Rosset, „und als ich zurückkam, spielte er wieder in meinem Zimmer, und ich sagte: ‚Entschuldige bitte, kannst du mich für eine Weile in Ruhe lassen?‘ Und Roger erwachte aus seinem Trancezustand: ‚Oh, sorry‘, und ging ins Nebenzimmer. Er konnte sich völlig selbst vergessen, aber das Ganze war auch cool und lustig. Nach dieser Woche war er für mich immer so etwas wie ein kleiner Bruder.“
Im August 1998 traf der französische Konditionstrainer und Physiotherapeut Paul Dorochenko in Biel ein. Wie viele andere im Haus des Tennis hatte ihn der Job in der Schweiz nicht zuletzt deshalb gereizt, weil er mit Federer arbeiten konnte.
Dorochenko kam in Algerien zur Welt, als das Land noch zu Frankreich gehörte. Er war 44 und hatte bereits verschiedene Topspieler betreut, darunter Rosset. Zuletzt hatte er in Spanien gearbeitet und war mit dem zweifachen French-Open-Sieger Sergi Bruguera und dessen Vater und Trainer Lluis auf Tour gewesen.
Dorochenko hat eine starke Persönlichkeit, zudem ist er wissenschaftsaffin. Seit einiger Zeit nutzt er Erkenntnisse aus der Neuromotorik, um Sportler dabei zu unterstützen, eingefahrene Techniken zu verändern.
Dank seiner Arbeit mit den Brugueras in den 1990er-Jahren war er mit den Bedingungen des Profisports bestens vertraut.
Federer musste noch an sich arbeiten, und zwar ernsthaft.
„Man muss es so klar sagen“, berichtete Dorochenko. „Emotional war Roger instabil. Er konnte Niederlagen nicht akzeptieren, und im Training war er nur mittelmäßig. Er war kein guter Arbeiter. Die meiste Zeit alberte er herum. In konditioneller Hinsicht verlangte ich viel von ihm – ich ließ ihn eine Stunde joggen, was offen gestanden überhaupt keinen Nutzen für Tennis hat. Aber mental war es hilfreich, es härtete ihn ab.“
Wie auch andere Trainer in Biel fand Dorochenko Wege, um Federer beschäftigt und bei Laune zu halten.
„Wir engagierten jemanden von einer Zirkusschule, der den Spielern Jonglieren beibringen sollte“, sagte Dorochenko. „Federer war spontan und sehr begabt, aber er war unstet. Manchmal musste ich ihn suchen gehen, weil er vergessen hatte, zum Konditionstraining zu erscheinen. Es war nervig, und seine Wohnung war eine Katastrophe. Das war unvorstellbar. Wenn ich morgens da reinging, konnte ich nicht erkennen, ob er überhaupt da war oder nicht. So chaotisch sah es dort aus.“
Unterdessen konzentrierten sich Peter Carter und die anderen Trainer in Biel auf die langfristige Ausrichtung von Federers Tennisspiel: Sie feilten an seiner Technik und seiner Spielweise, damit er seine Begabungen voll einsetzen konnte.
Für Federers geringe Fehlertoleranz bei seinen Grundlinienschlägen entwickelte Groeneveld folgende Idee: Er spann 90 Zentimeter über dem Netz ein Seil und forderte Federer auf, den Ball im Spiel zu halten, ihn dabei aber stets über das Seil hinweg zu spielen. Dazu bedurfte es eines massiven Topspins, und obwohl Federer verstand, worum es ging, führte er die Übung in typischer Manier weiter und fand eine Möglichkeit, starken Spin und Geschwindigkeit zu vereinen. Die Vorhand, die er mit voller Wucht zu schlagen lernte, erhielt in Amerika den Spitznamen „Cliffhanger“.
„Ein Ball mit so viel Topspin, dass es aussah, als würde er ins Aus gehen, aber in letzter Sekunde traf er auf der Grundlinie auf“, sagte Groeneveld. „Wir sprechen zwar immer von der Geschwindigkeit von Nadals Schlägerkopf, aber Roger hat diesen unglaublich schnellen Arm. Rafa hat sie hauptsächlich wegen seines Schlägers entwickelt, und die Technik bezieht sich auf den Schläger. Roger benutzte lange einen traditionellen Schlägerrahmen und hätte niemals ohne Verletzung diese Ballrotation durchgehalten, die man für den Cliffhanger benötigt.“
Federer verwendete damals einen Wilson Pro Staff Original mit einem 85 Quadratzoll messenden Schlägerkopf, den gleichen Schläger, den auch zwei seiner Idole einsetzten: Sampras und Edberg. Mit seinen zwölf Unzen (340 g) war er vergleichsweise schwer, mit schmalem Rahmen und kleinem Kopf, wodurch er einen unsauberen Treffpunkt kaum verzieh.
Doch Federer liebte bei diesem Schläger das Gefühl, wenn das Timing stimmte. Der „Sweetspot“ verdiente seinen Namen, und Federer hatte schließlich nicht vor, lange, zermürbende Kriege von der Grundlinie aus zu führen. Er wollte von überall angreifen und die Punkte relativ schnell ausspielen.
Dorochenko sprach oft mit Peter Carter über Federers Spiel. Ein Thema, das Dorochenko interessiert, ist Lateralität, die Dominanz einer Gehirnhälfte bei der Steuerung von Körperfunktionen. Einen besonderen Schwerpunkt legt er auf Augendominanz und ihre Auswirkungen auf den Spieler.
Dorochenko stellte fest, dass der rechtshändige Federer eine linksseitige Augendominanz hat. Das bedeutet, dass sein linkes Auge Informationen schneller und zuverlässiger weiterleitet als sein rechtes. Die Augendominanz eines Menschen geht typischerweise mit einer gleichseitigen dominanten Hand einher. Federer hat eine Kreuzdominanz, die nur bei etwa 30 Prozent aller Menschen vorliegt.
Aus Dorochenkos Sicht bedeutete das, Federers natürlichster Schlag war die Vorhand, denn mit eingedrehten Schultern konnte sein linkes Führungsauge dem Ball aus einer günstigeren Position folgen.
Dorochenko, ein starker Club-Spieler in Frankreich, erinnerte sich, wie er an den Wochenenden im Bieler Leistungszentrum gegen Federer spielte und das Spiel für beide Seiten interessant gestaltete, indem er Federer zwang, mit der linken Hand zu spielen.
„Ich habe viel mit ihm an seiner linken Hand gearbeitet. Dabei verbessert sich die Gesamtkoordination, und das Gehirn arbeitet symmetrischer“, sagte Dorochenko. „Federer war ein kreativer Typ, er arbeitete nicht sehr konzentriert und hatte viele Hochs und Tiefs. Manchmal zertrümmerte er einen Schläger oder vergab mutwillig ein Match. Mental gesehen war er überhaupt nicht gut, und so sagten wir uns, okay, dann bauen wir für Federer eben ein Tennis, das zu ihm passt, und Peter Carter war der oberste Bauherr. Ich weiß nicht, ob Federer merkte, was alles für ihn getan wurde, aber am Ende entwickelte er so eine maßgeschneiderte Technik. Federer wurde nicht in eine Form gepresst; es wurde eine Form so gestaltet, dass Federer hineinpasste.“
Ein vorhandzentriertes Angriffstennis erforderte eine ausgezeichnete Beweglichkeit und kräftige Beine, um die Rückhand wo immer möglich zu umlaufen und den Ball ins gegnerische Feld zu treiben. Da Federer nun seine späten Teenagerjahre erreicht hatte, schaute man auch auf seine Ernährung und seine Kraft. Als Dorochenko den Schweizerischen Tennisverband im Frühjahr 2000 verließ, um zu Brugueras Team zurückzukehren, konnte Federer beim Bankdrücken trotz seines unscheinbaren Körperbaus mehr als 100 Kilogramm stemmen.
Für einen jungen Tennisspieler hatte er außerdem einen ordentlichen Sauerstoffaufnahme-Maximalwert (VO2max), damit würde er künftig auch in Fünfsatzspielen bestehen können.
„Manche begingen den Fehler, ihn für zerbrechlich zu halten“, sagte Dorochenko. „Dabei war er stark, sehr stark, und hatte damals ein VO2max von 62, was für einen Angriffsspieler ein hohes aerobes Niveau darstellt. Um einen Vergleich zu geben: Marc Rosset lag bei 50. Ein guter Radfahrer hat 75 oder 80. Bruguera, ein Grundlinienspieler, hatte 72. Federer lag über dem Niveau eines typischen Angriffsspielers. Wir wussten also, dass er ein langes Match gut überstehen würde, und Sie können selbst sehen, wie viele Fünfsatzspiele er im Laufe seiner Karriere gewann. Nie kippte er um.“
Federers auffälligstes Merkmal für Dorochenko war, wie dynamisch und schnellfüßig er war. Beim Sprungkrafttraining mit seinen repetitiven, explosiven Übungen wie dem Box Jump zeigte er hervorragende Leistungen: „Er brach alle Rekorde. Wenn andere in 30 Sekunden vielleicht 55 Sprünge schafften, machte er 70. Er war ein wirklich bemerkenswerter Athlet, aber da seine mentale Seite instabil war und seine Rückhand oft versagte, fand Peter Carter, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, die Ballwechsel zu verkürzen. Es kommt darauf an, die Anzahl von Schlägen zu finden, die am besten zu einem passt. Für jemanden wie Bruguera lag dieses Optimum bei elf Schlägen oder mehr. Bei Federer waren es drei, vier oder fünf Schläge.“
Das mag nach einer einfachen Formel klingen. Federer, dem gerne mal die Sicherung durchbrannte und der über zahlreiche taktische Optionen verfügte, brauchte aber mehr Zeit als andere in seiner Altersgruppe, um zu lernen, wie er die besten Schläge auswählen und beständige Erfolge erzielen konnte.
Peter Carter verstand das genau und verteidigte Federer in den Besprechungen des Schweizerischen Tennisverbands oft gegen jene, denen seine Fortschritte zu langsam gingen und die darauf hinwiesen, dass die Topspieler im Tennis typischerweise vor ihrem 20. Geburtstag einen Grand-Slam-Titel gewonnen hatten (siehe Sampras, Borg, McEnroe und andere). Doch Carter bestand darauf, dass für Federer ein anderer Zeitplan galt und er sich nicht auf zwei oder drei Hauptschläge, sondern auf alle Schläge konzentrierte.
Andre Agassi, einer der besten und intuitivsten Spieler der Neuzeit, spürte das auch. Binnen Jahresfrist hatte er sich in die Top 10 zurückgekämpft und traf nun, im Oktober 1998, in der ersten Runde der Swiss Indoors in Basel auf Federer. Es war die Woche, nachdem sich Federer für das Hauptfeld des ATP-Turniers in Toulouse qualifiziert und zwei Runden gegen etablierte Tour-Spieler gewonnen hatte – den Franzosen Guillaume Raoux und den Australier Richard Fromberg –, bevor er dem Niederländer Jan Siemerink unterlag.
Agassi, der erste Top-10-Gegner Federers überhaupt, schlug ihn 6:3, 6:2. Nach dem Match, das in mancherlei Hinsicht wie ein Routinesieg ausgesehen hatte, ging Agassis Trainer Brad Gilbert zur Umkleide.
„Andre sagte so etwas wie: ‚Verdammt, dieser Federer-Junge hat ganz schön was drauf, das dauert nicht mehr lang und er wird richtig gut sein‘“, sagte Gilbert.
In der nächsten Runde schlug Agassi Federers 22-jährigen Landsmann Ivo Heuberger mit 6:2, 6:2. David Law, der das Turnier für die ATP betreute, begleitete Agassi zu seiner Pressekonferenz. Er fragte ihn, wer wohl gewinnen würde, wenn die beiden Schweizer Federer und Heuberger aufeinanderträfen.
„Agassi sagte: ‚Na ja, wenn sie heute gegeneinander spielen würden, wäre Heuberger der Sieger‘“, verriet mir Law. „‚Aber Karriere machen wird Federer.‘“
Bevor es zu der außergewöhnlichen Karriere kam, wie sie sich Agassi damals sicher nicht vorstellte, standen noch zahlreiche Lernerfahrungen an – wie jene in Küblis, einem malerischen Schweizer Bergdorf nahe der österreichischen Grenze.
Es war die Woche nach dem Basler Turnier, und obwohl Federer sich nach wie vor im eigenen Land befand, war er hier in einer anderen Welt und tat sich schwer mit der Umgewöhnung. Statt gegen einen Weltstar wie Agassi auf der Haupttour anzutreten, traf er in der ersten Runde auf Armando Brunold, einen kaum bekannten 21-jährigen Schweizer, der Platz 768 der Weltrangliste belegte – das Ganze bei einem Satellitenturnier in einem Ort mit weniger als 1000 Einwohnern. Der Druck lastete ausschließlich auf Federer.
Peter Lundgren war einer der wenigen Zuschauer. Er schäumte, als er mit ansehen musste, wie Federer das Match praktisch vergab, nachdem er den Tiebreak im Eröffnungssatz verloren hatte, indem er reihenweise Grundlinienschläge in den Sand setzte.
„Er schmierte ab, und ich wurde darüber beinahe verrückt“, sagte Lundgren.
Der Turnierschiedsrichter Claudio Grether kam auf ihn zu. Es war derselbe Offizielle, der Monate zuvor Allegro mit auf den Weg gegeben hatte, dass er Federer kein weiteres Mal schlagen werde. Diesmal informierte er Lundgren, dass er Federer wegen Untätigkeit verwarnen werde.
„Ich sagte: ‚Nur zu! Tun Sie das!‘“, sagte Lundgren.
Grether kehrte auf den Platz zurück und machte seine Androhung wahr. Der einsichtige, aber immer noch angeschlagene Federer verlor anschließend in zwei Sätzen.
Laut Lundgren, der einen besorgten Anruf von Federers Eltern entgegennehmen musste, erhielt Federer eine Strafe von 100 US-Dollar – Peanuts im Vergleich zu dem Preisgeld von über 100 Millionen US-Dollar, das er später verdienen sollte. Doch auf dieser Stufe waren 100 US-Dollar mehr als das Startgeld des Erstrunden-Verlierers. In erster Linie aber war es peinlich, und es wurde in der Schweiz aufmerksam registriert. Das führte zu einigen kritischen Schlagzeilen und Berichten in denselben Medien, die gerade erst über Federers Lauf in Toulouse und sein Duell gegen Agassi in Basel geschrieben hatten.
Lundgren und Carter machten Federer klar, dass sie nicht länger mit ihm reisen würden, wenn er beim nächsten Turnier wieder solche Mätzchen machte.
Federer gewann zwei der nächsten drei Turniere der Satellite-Serie; im dritten erreichte er das Finale. Dabei schlug er seinen Hausgenossen und Doppelpartner Allegro zweimal.
„Das ist typisch für Roger“, schmunzelte Lundgren. „Er wurde quasi in die Ecke gedrängt, und dann gewann er das Satellite-Turnier.“
Man ist schnell verleitet, solche Momente als Dreh- und Angelpunkt für den Menschen und Spieler Federer, wie wir ihn heute kennen, zu werten. Aus einer Launenhaftigkeit heraus den Vorhang des Übungsplatzes aufgetrennt? Im Morgengrauen die Plätze und Toiletten reinigen.
Durch Untätigkeit einem Turnier und dem Sport mangelnden Respekt erwiesen? Die Strafe und Gegenreaktion entgegennehmen.
Solcherart sind die Zäsuren im Leben. Dazu gehörte auch, dass Robert Federer seinen launischen Sohn in Basel stehen und alleine nach Hause fahren ließ oder – eine Aktion, die in anderen Ländern wohl Kopfschütteln auslösen würde – den Wagen anhielt und das Gesicht des jungen Roger mit Schnee zur Abkühlung einseifte, weil sich sein Sohn nach einem Turnier in Tiraden erging.
Federer hätte sich vermutlich ganz anders entwickelt, wenn man ihm in seiner Jugend keine Grenzen gesetzt hätte.
Natürlich, es wurden ihm immer wieder Zugeständnisse gemacht, um ihn bei der Stange zu halten. Sicherlich war er ein wenig weltfremd. Für jemanden, der schon als Teenager von Nike unter Vertrag genommen wird und immer wieder hört, dass er das Zeug zur Nummer eins hat, ist das wohl nicht ungewöhnlich.
„Man erzählte mir das ständig“, sagte Federer.
Doch Federer wurde eben auch in seine Schranken gewiesen, nicht nur auf schweizerische Art, sondern dank seiner Trainer auch auf australische und schwedische Art. Und Federer fing die Signale auf.
Gleichmacherei hat im Tennis allerdings ihre Grenzen. Aus jedem Einzelwettbewerb kann nur ein Spieler als Sieger hervorgehen, und nur ein Junge beendet das Jahr als Junior mit dem weltweit höchsten Ranking.
Federer gelang das 1998 nach dem Gewinn des Orange Bowl, obwohl er zuvor beinahe in der ersten Runde gegen den Letten Raimonds Sproga ausgeschieden wäre.
Das hatte nicht nur mit Sprogas brillantem Spiel zu tun. Vor dem Turnier war Federer seilgesprungen und hatte sich dabei ziemlich stark den Fuß verstaucht.
„Wie üblich hatte er herumgealbert“, sagte Dorochenko. „Innerhalb von Sekunden wurde sein Knöchel so dick wie eine Kartoffel. Ich behandelte ihn also drei Tage lang, und in der Auftaktrunde spielte er praktisch nur auf einem Bein, aber er gewann trotzdem. Danach wurde es jeden Tag besser.“
Zum Glück, denn in der zweiten Runde musste Federer den Österreicher Jürgen Melzer schlagen, bevor er im Halbfinale auf den Argentinier David Nalbandian traf. Dieser hatte Federer einige Monate zuvor im Juniorenfinale der US Open besiegt, doch diesmal behielt Federer die Oberhand und schlug anschließend im Finale einen weiteren talentierten Argentinier, Guillermo Coria.
Es war ein beachtlicher Lauf, der einige Jahre später noch beeindruckender wirkte, als Melzer Platz acht der ATP-Weltrangliste erreichte und Coria bis auf Platz drei kletterte sowie mehrfach in einem Grand-Slam-Finale stand.
Doch Federer stach aus dieser außergewöhnlichen Gruppe heraus und eroberte den Spitzenplatz bei den Junioren, nachdem Andy Roddick, ein weiterer seiner späteren Gegner im Profiwettbewerb, den Franzosen Julien Jeanpierre im letzten ITF-Turnier des Jahres in Mexiko geschlagen hatte und damit dessen Hoffnungen auf Platz eins begrub.
Zu diesem Zeitpunkt war Federer schon in die Schweiz zurückgekehrt. Seine Karriere als Nachwuchsspieler war beendet, und er stand kurz vor Beginn seiner Profilaufbahn. Coria, der sich schon mit 27 Jahren aus dem Profitennis verabschiedete, war noch Jahre später über den Verlauf dieser Karriere erstaunt.
„Ich sage ganz ehrlich, dass ich mir niemals hätte vorstellen können, dass Federer zu der Persönlichkeit heranreift, die er heute ist“, stellte Coria 2019 in der argentinischen Radiosendung Cambio de Lado fest. „Die Arbeit, die sein Stab geleistet hat, vor allem hinsichtlich seiner mentalen Verfassung, verdient den Nobelpreis. Er war verrückt. Er hörte Heavy Metal über Kopfhörer mit voller Lautstärke. Er ließ sich die Haare blond färben. Er hatte nichts mit dem Menschen zu tun, der er später wurde.“
Wer erinnert sich schon gern daran, wie man in der Jugend ausgesehen hat? Das gilt zweifellos auch für Federer. Er hatte Akne. Sein Modebewusstsein war mehr als unterentwickelt, und beim Orange Bowl hatte er sich tatsächlich die Haare wasserstoffblond gefärbt. Von seinem Vater hatte er zudem eine markante Nase geerbt. Wie sich Dorochenko erinnert, sagte er in jenen frühen Jahren: „Ja klar ist sie groß, aber wenn ich erst mal Nummer eins bin, wird das niemandem mehr auffallen.“
20 Jahre später postete Federer auf Instagram ein Foto von sich aus diesen Tagen, mit den Hashtags #teen und #premirka (Vor-Mirka) und dem Satz: „Als Erinnerung für alle, dass die besten Tage immer vor uns liegen.“
Federer bemühte sich immer sehr, sich selbst anzunehmen und an sich zu arbeiten, mit Carter, mit Marcolli oder auch allein. Es war in der Tat ein Langzeitprojekt. Bis heute wurde es nicht mit einem Nobelpreis gekrönt, aber Federer fand zur inneren Ruhe.
„Wenn ich Roger heute sehe, sage ich ihm immer: ‚Was du auf dem Platz tust, ist außergewöhnlich, aber deine Lebenseinstellung ist für mich einfach unglaublich‘“, so Marcolli. „Wo immer man auch hinkommt, überall hat man Luxus auf Fünf-Sterne-Niveau oder höher, Menschen, die einen erkennen und einem irgendwas bringen, was man noch nicht mal bestellt hat, und dann geht man auf den Platz und dem Spiel ist all das völlig egal. Das Spiel kümmert sich nicht darum, wo man geschlafen hat, was man getan hat oder wie viele Menschen man getroffen hat. Es ist ganz rein, und Roger schafft es seit über 20 Jahren, auf den Platz zu treten und bescheiden und mit der inneren Verbundenheit zu spielen, die es braucht, um immer wieder zu gewinnen. Seine Herangehensweise an die Arbeit – und es ist wirklich Arbeit –, diese Würde, diese Konzentration: In dieser Hinsicht ist er für mich ein Vorbild.“