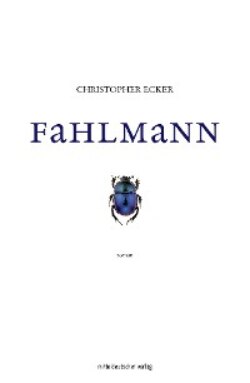Читать книгу Fahlmann - Christopher Ecker - Страница 10
Оглавление1Zumindest für einen Brief endete damals die postale Odyssee in (wenn schon klugscheißen, dann richtig!) Ithaka, dem Briefkasten der Familie Fahlmann: Sehr geehrter Herr Fahlmann, ich fürchte, wir sind der falsche Verlag für Ihre Erzählungen. Wir haben nichts Vergleichbares im Programm, und Ihnen wäre mit einer Veröffentlichung letztlich nur ein Bärendienst erwiesen. Mit der Bitte um Nachsicht, Ihre unleserliche Unterschrift. Ich warf die Rätselbotschaften, zu denen ich die Absage zerfetzt hatte – leichbar, Bärend, chsi – in die Mülltonne und machte mich auf den Weg zur Uni.
Da es immer unwahrscheinlicher schien, jemals vom Schreiben leben zu können, hatte ich vor einigen Semestern beschlossen, mein Studium so rasch wie möglich zu beenden. Die Betonung liegt hierbei auf «möglich», denn der Umstand, dass ich an zwei Tagen der Woche nicht zur Uni konnte, weil ich Särge von hier nach dort schleppte, wirkte sich nicht gerade vorteilhaft auf die Geschwindigkeit aus, mit der ich mich auf die Magisterprüfung zubewegte, eine hinterhältige Rätselfragen ausheckende Eissphinx, die drohend am intellektuellen Horizont aufragte; schwarze Wolken verhüllten ihr imbeziles Antlitz.
Bei unseren zufälligen Begegnungen im Hausflur wollte Mutter oft wissen, wie lange ich noch zu studieren gedächte. Ich beruhigte sie stets mit vagen Hinweisen auf die nahende Prüfung und stolperte geschäftig zur fragensicheren Wohnung hinauf. Mutter hatte ihr Studium genossen. Sie würde nie verstehen, wie sehr mich die Inkompetenz meiner Professoren ängstigte, die ihren vermutlich verhängnisvollsten Niederschlag in der ausgelassenen Willkür der Prüfungsfragen finden würde. Aber was war schon von Schlafmützen zu erwarten, die ihre langweiligen Vorlesungen aus überholten Nachschlagewerken zusammenkopierten! Weitaus unangenehmer als die Professoren waren jedoch die Kommilitonen, ungern lesende, sich am Hochdeutsch die Zunge brechende, Deutsch auf Lehramt studierende Kretins. Später würden sie Jens unterrichten, keinen Deut fähiger als die Lehrer, die mich während der Gymnasialzeit geplagt hatten: In jedem Kafkatext fanden sie den Herrn Papa, und der Vaterkonflikt prangte ehrfurchtgebietend an der Tafel, bis ihn das nicht weniger törichte Geformel des Mathematiklehrers umnebelte: a = p : (f + el). Bei Trakl musste regelmäßig das großnasige Schwesterchen herhalten, bei Benn waren es die Nazis und die arme Else. Der Ich-Erzähler wurde dummdreist mit dem wehrlosen Schriftsteller gleichgesetzt, und was nicht im Lehrerhandbuch steht, ist natürlich falsch. «Hallo! Bitte mal aufpassen! Das kommt in der Arbeit dran! Hört mir mal kurz zu – auch ihr da hinten in der letzten Reihe! Trochäus hat zuerst die – Moment mal, nein, das ist ein Jambus, Fah-re mit der Ei-sen-bahn, nein, verflixt noch eins, irgendwie ist das beides.» Und während man in mehrstündigen Kursarbeiten die alleridiotischsten Fragen beantwortete, raschelte der überforderte Dussel am Lehrerpult legasthenisch mit der Tageszeitung. Das alles war mir nicht erspart geblieben; das alles würde Jens nicht erspart bleiben.
Bereits in der Grundschule tyrannisierten sie ihn mit ihren wahnhaften Primitivallüren und ihrer Spannerneugierde. So hatte er einmal als Hausaufgabe für den Sachkundeunterricht seine Eltern «in Ausübung ihres Berufs» (was für mich wie «in flagranti» klang) malen müssen. Susanne setzte er auf einen Gabelstapler und ließ sie gesichtsbreit grinsend und busenlos an einem Regal mit Waschmitteln vorbeidüsen, deren bunte Packungen «Omo», «Dash» und «Weißer Riese» schrien. Mit mir hatte es Jens leider nicht so einfach, und das Bild, das er uns schließlich präsentierte, zeigte mich untätig am Küchenfenster, eine lange, traurige Bohnenstange neben einem Kaffeebecher, der auf dem frei im Raum schwebenden Strich der Fensterbank stand (die Entdeckung der Zentralperspektive stand Jens noch bevor). «Am Fenster!», stöhnte ich, nachdem wir ihn spielen geschickt hatten. Ich legte beide Bilder nebeneinander auf den Wohnzimmertisch. «Er weiß nicht, was ich mache!» – «Woher soll er das denn wissen?» – «Er muss doch wissen, dass ich schreibe!» – «Vielleicht hält er das für keine richtige Arbeit. Die Väter seiner Freunde …» – «Jaja! Schon verstanden! Die sind natürlich Baggerfahrer, Polizisten, Tierärzte, Dompteure oder Was-weiß-ich! Alles gut zu malen. Aber mit mir hat er den oberschwarzen Peter gezogen.» – «Ich werd mal mit ihm sprechen. Er kann dich ja an der Uni malen.» – Und so saß ich einige Tage später hinter einer Schulbank, die an eine aufrecht stehende Schnellhefterklammer erinnerte. Meine Arme lagen brav auf dem Tischstrich, und in der rechten Hand hielt ich ein phänomenal großes Schreibgerät. Ich sah sehr aufmerksam aus. In Wahrheit hat mich die krampfhafte Akademisierung von Literatur nie interessiert.
Meiner Meinung nach ticken Leute nicht mehr richtig, die das Vorkommen von «und» oder «Huhn» in Goethes Liebeslyrik untersuchen oder umfangreiche Monographien über Neufundländer im Romanwerk Fontanes vorlegen. Auch wenn es ausnahmsweise mal nicht um unds, Hühner oder den blöden Rollo ging, waren die Vorlesungen und Seminare, die ich besuchte, ein lästiges, zeitraubendes Ärgernis, das einem nichts vermittelte, was man sich nicht mit Hilfe eines quergelesenen Fachbuchs binnen weniger Minuten angeeignet hätte. Doch, um nun im Ton versöhnlicher und eine Spur sachlicher zu werden, in diesem Sommersemester besuchte ich meine Seminare (Thomas Manns Romane, Hausarbeit; De Saussure und die Folgen, Sitzschein) mit bewundernswerter Regelmäßigkeit, denn der Weg zur Bushaltestelle führte an der Bäckerei Gallinger vorbei.
Ich räusperte mich, bestellte eine beklommene Schnecke, hielt dem selbstsicheren, fast abschätzigen Blick tapfer stand, murmelte: «Das ist alles!» und malte mir dabei detailreich aus, dass sie längst, «ich wusste es von Anfang an», in mir, «Sie sehen so gebildet aus», den mysteriösen Verehrer, «und jetzt bitte von hinten», vermutete, der sie mit geistreich-romantischen Briefen beglückte. Unwahrscheinlich. Sie weiß ja nicht einmal, dass ich ihren Namen kenne! Jasmins Kuchenschere biss in eine rosinengespickte Schnecke, hob sie aus der Theke und versenkte sie in einer Papiertüte, die ein leises, altjüngferliches Hüsteln von sich gab, als sie mit einigen geübten Handbewegungen zugefaltet wurde. Habe dich heute wieder gesehen, sieh, ich steige hinab, in deinem Schoß zu vergessen, vielleicht sollte ich ihr einen dritten Brief schreiben, vergessen? Nur nicht! Jetzt nur nichts vergessen! Schleunigst versuchte ich, mir Jasmins Aussehen einzuprägen (vielleicht für einen Gastauftritt in meinem Roman, vielleicht für eine handlungsbegleitende Phantasie im Badezimmer), wusste aber, noch während ich es versuchte, dass als Frucht dieser Anstrengung lediglich gebräunte, kräftige Arme, ein flacher Bauch und grüne Augen Bestand haben würden. Ich lächelte, sie lächelte, sie lachte, ich zitterte, sie legte die Tüte auf die Theke, blies mit einem kecken Vorschieben der Unterlippe ein Haar aus der rechten Wimper und fragte: «Machen Sie eine Diät?»
«Nein, nein!», antwortete ich schnell und sagte dann etwas sehr Dummes: «Ich bin alleine hier.» Ein Blinder tastet sich durch einen Raum. Von der Decke baumeln Seile. Er muss an einem ziehen. Neunundneunzig Seile sind Attrappen, aber das Hundertste ist an einer Falltür befestigt, auf der ein Amboss steht. Ich zog mit aller Kraft am hundertsten Seil. «Normalerweise», fuhr ich betäubt fort, «komm ich mit Heinz.» Diese Bemerkung ließ mich so viel Boden unter den Füßen verlieren, dass es kaum schlimmer kommen konnte. Doch es kam schlimmer. «Heinz Brenner», hörte ich mich nämlich erläutern, «ein Arbeitskollege. Der wartet sonst immer draußen im …» Hoppsa! «… Auto.» Beinahe «Leichenwagen» gesagt! «Er behauptet zwar immer, dass er nichts wolle …» Stimmt hier der Konjunktiv? Großer Gott! Und wenn er stimmte, käme ihr das nicht reichlich behämmert vor? Wolle? Wollte? «… aber ich bring ihm immer was Süßes mit, und er, der Heinz, meine ich, freut sich wie … wie …» Wie was? Wie wer? Wie wer oder was freut sich Heinz? Nanu? Was mag denn wohl an diesem Seil hängen? Noch ein Amboss? Ich riss an dem herabbaumelnden Seil wie ein betrunkener Glöckner, und mir stürzte, jetzt tot umfallen bitte-bitte, ein heiseres «wie Oskar» in den Mund.
Probleme mit der Tüte, Wiedersehen, ich hob die Tüte vom Boden auf, Probleme mit dem Geldbeutel, ohweh, ich hob den Geldbeutel vom Boden auf, klemmte die Tüte unter den Arm, steckte den Geldbeutel in die Gesäßtasche, Probleme mit der Tür, fester drücken, ting, lassen Sie sie ruhig auf, dann kommt frische Luft rein, ting, Wiedersehen, danke für die Schnecke, ich erreichte die Bushaltestelle verschwitzt und beschämt.
Ich trat in der Bäckerei Gallinger auf wie ein sprachlicher Vollspastiker. Normalerweise brachte nur Susannes Mutter das Kunststück fertig, die Bildwelten zweier oder mehrerer umgangssprachlicher Redewendungen aufs Allerdümmste miteinander zu verschmelzen. Doch ihr legendärer Ausspruch «fit wie Nachbars Turnschuh» stand meinem Bäckereigestammel in nichts nach. Ob es nicht einfacher wäre, Jasmin alles zu gestehen? Ich kaufe die Schnecke nur wegen dir, ich werfe sie an der Bushaltestelle in die Tonne, denn nachher kaufe ich mir mindestens eine helle Nussecke beim Teuren Arthur, supergute Nussecken gibts bei dem, da kann man alle Schnecken vergessen, die ihr Gallinger euch so zusammenbackt …
Schnaubend hielt der Bus auf dem Campus. Die Türen zischelten, legten sich mächtig ins Zeug, schließlich teilten sich die dicklippigen Gummiwülste und gebaren eine Wolke junger, wissensdurstiger, lachender Menschen und ein bedrücktes, reichlich ramponiertes Exemplar der Gattung Georg fahlmanniensis L. Der hatte sich als Junge regelmäßig eine eingeschweißte Zeitschrift namens Yps gekauft, unter deren Folie ein kurzlebiges Plastikspielzeug klemmte, das den mysteriösen Namen «Gimmick» trug. Typische Gimmicks waren das Um-die-Ecke-kuck-Fernrohr, die Mondmaske oder der Zauberbumerang, unnötiger Plastikkram, den man selbst oder mit väterlicher Hilfe zusammenbaute und der längst kaputt war, wenn das nächste Yps erschien. Worauf will ich hinaus? Sie ahnen es nicht! Wetten? Nehmen wir einmal an, die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft wäre ein Ypsheftchen. Was wäre dann die Sprachwissenschaft? Richtig, sie wäre das Schwarze Gimmick, ein lästiges, sich von Schlaftabletten nährendes Nebenfach, das einem, ohne dass man sich dagegen wehren kann, mitgeliefert wird. Zum Glück machte ich bei Frau Professor Bangmann nur einen Sitzschein. Sie war eine traurige, triefäugige Koryphäe im Verschriften mundartlicher Alltagsgespräche, die ihrer Jahre als Feldforscherin (schiefes Hütchen, Tonbandgerät) mit Wehmut und leidender Flüsterstimme gedachte. Mir grauste es vor dem Seminar, vor neunzig Minuten einschläferndem Wortgeplätscher. Unweit der Haltestelle überquerte ich ein schmales Sträßlein und wurde zu einem Wellenkamm des Studentenstroms, der sich zwischen frisch gestutzten Hecken in südliche Richtung ergoss, um auf Höhe des grauen Betonturms, der so geheimnisvolle Fächer wie Experimentalphysik und Elektrotechnik beherbergte, in ein Delta der tausend Möglichkeiten zu münden, dessen dünne Arme auf staubigen Parkplätzen, vor der Buchhandlung, der Bank, dem Lädchen und den gläsernen Eingangstüren zahlreicher Gebäude versiegten.
BsssSSS (die freundliche Attacke) – SSSssSSS (um den Kopf herum) – SSSssss (in Richtung ein Uhr davon). Unerschrocken hielt der Käfer auf Bau 31 zu (Rechtswissenschaft) und wurde zu einem taumelnden Punkt vor den Betonwänden der traditionslosen, nach dem Zweiten Weltkrieg in gedankenloser Windeseile aus dem Boden gestampften Universität. Mit einem Mal erschien mir alles unwirklich. Mir war, als hätte ich die wirkliche Welt auf dem Dachboden zurückgelassen. Allein am Tisch mit der mürrischen Schreibmaschine fühlte ich mich sicher; hier auf dem Campus dagegen war ich ein ältlicher, verlegener Geist, unsichtbar für diese grauenhaft jungen Mädels in ihren bauchfreien Shirts und knappen Shorts. Jetzt, wo ich das alles wahrheitsgetreu niederschreibe, wird mir schmerzhaft bewusst, dass das Wichtigste und Erinnerungswürdigste meines Studiums die hellen Nussecken des Teuren Arthur waren. Lausche ich in mich hinein, höre ich noch immer den semitheatralischen Seufzer, mit dem er meine klingelnde Handvoll Kleingeld entgegennahm. Dienstags waren die Nussecken noch weich und köstlich, doch je näher das Wochenende rückte, desto härter wurden sie. Bevor ich jedoch an diesem Tag dem miesepetrigen Edeka-Verkäufer achtzehn Zehnpfennigstücke aus der Kleingeldtasse in die hohle Hand zählte, schlug ich in der Universitätsbuchhandlung meinen Namen im VLB nach, um mich zu vergewissern, dass es mich noch gab, obwohl mich niemand wahr-, geschweige denn ernstnahm. Danach kaufte ich ein Taschenbuch (den Chandler hatte ich letzte Nacht ausgelesen) und kuckte dabei einer Studentin in die Bluse, die sich neben der Kasse nach Philosophischem bückte.
«Don Juan war Analphabet», hatte Winkler einmal behauptet (oder zitiert?), um, ehe ich widersprechen konnte, mit einem triumphierenden Schlenker des Zigarillos fortzufahren (fortzuzitieren?): «Allein dem Voyeur, diesem Don Juan des Geistes, ist als göttliches Geschenk die Gabe des Schreibens gegeben.» Als Gegenargumente fielen mir damals leider nur ein halbes (Casanova schrieb seine Memoiren erst im Alter – also nach den Frauen) und ein gänzlich indiskutables ein, nämlich eine erfolgreiche, längst verstorbene belgische Romanfabrik, die angeblich von den Autoren, die sie bewunderten (Maugham, Gide, sie selbst), keine Bücher lesen konnte, weil diese ihr viel zu langweilig waren. Freundliche, kleine Brüste, die Studentin richtete sich auf und sah mich böse an, der un-sichtbar Seiende verliert sein un-sichtbares Sein durch das anwesende, weibliche Gewahrwerden seines ihn sichtbarmachenden Beobachtens, vielleicht sehe ich heute Viola, ich hatte sie dienstags schon einmal vor der IB getroffen, lange, rote Haare, Zahnspange, bezauberndes Lächeln, Bärendienst, was für ein Schwachsinn, ich sollte das Skript morgen gleich wieder wegschicken, guten Arsch hat sie auch, hoffentlich wird Jens nicht so wie ich, der biologische Stempel, wenigstens stehe ich im VLB, hat uns allen die Sau ins Fleisch gedrückt, bück dich nochmal, bück dich, bück dich, besucht bestimmt das Seminar über Existentialismus, glotz nicht so, du Bumskuh, wohin mit dem Buch, braucht keiner zu sehen, was ich lese, Inge, vielleicht läuft mir Inge, hat viel größere Titten, übern Weg, und jetzt nichts wie ab nach Nussecktopia.
Der Teure Arthur seufzte herzerweichend, ließ meine Zehner auf das klebrige Gummi des Warenbands fallen, und ein zählender Finger stieß auf jede einzelne Münze nieder, um sie ungläubig anzutippen, «Bon brauch ich nicht», sagte der Mensch, der ich an der Uni war (und den ich nicht sonderlich mochte), und nahm die backfrische Dienstags-Nussecke aus der Tüte. Draußen, unter der gelb-blauen, das Schaufenster horizontal teilenden Edeka-Banderole überquerte Professor Capart den Parkplatz. Unverkennbar der abgehackte Gang, der beständig aus dem Takt zu fallen drohte. Unverkennbar auch die breit aufgefächerten Hände, die auf Hüfthöhe glattstreichende Bewegungen in der Luft vollführten. Ich trödelte aus dem Laden, verzehrte die Nussecke in der Deckung einer Vogelbeerhecke und steuerte erst auf den Eingang zu, nachdem Capart schon einige Minuten lang in Bau 35 verschwunden war. Doch kaum hatte ich das Gebäude betreten, sah ich ihn im Bilderrahmen der Aufzugskabine. Eine Hand blockierte die Lichtschranke, die andere winkte mir zu. Oh, wie ich diese verhängnisvollen Begegnungen hasste! Einmal hatte Capart urplötzlich am Urinal neben mir gestanden (in Bau 12, wenn ich mich recht entsinne). Krampfhaft hielt ich den Blick gesenkt, drückte, presste und schwieg dabei so verbissen wie ein Sprengmeister bei der Entschärfung einer Nitroglycerinbombe in einem Erdbebengebiet. Vielleicht, hoffte ich in den Tagen nach diesem peinlichen Rendezvous, hat er mich nicht erkannt, denn wir hatten schweigend und versagend nebeneinander gestanden, bis ich kapitulierte, ein Erfolg vortäuschendes Tröpfchenschütteln andeutete, den Spatz wegpackte, die Spülung betätigte und mich davonstahl, um meine Lieblingstoilette in der Musikwissenschaft aufzusuchen. Bäuchel, ein Zechkumpan von Heinz, pflegte fast alles, was er erzählte (und das war nicht viel), mit der Frage «Und was lernen wir daraus?» und der prompten Antwort «Nichts!» zu beschließen, und mit einem ähnlichen Resümee (Wie weit darf eine Metapher gehen?) sollte ich diesen anekdotischen Fussel von der Weste meiner Erinnerung (so weit?) zupfen, und sofort stehe ich wieder, Spannungsmusik, Grabesstimme, im blutbespritzen Aufzug des Todes.
Professor Capart begrüßt mich herzlich (meine Veröffentlichung in einem angesehenen Verlag imponiert ihm), der Leuchtpunkt der Lichtschranke verlässt seinen braun gesprenkelten Handrücken, wird unsichtbar, und die zugleitende Tür beschert uns eine unerträgliche Intimität. Ich schnüffele verhalten. Die Flügel von Caparts fleischiger, an der Spitze gespaltener Nase überzieht ein Heer schwarzer Mitesser; im rechten Mundwinkel baumelt ein kleiner, trockener Krümel; das linke Auge wirkt ungewöhnlich feucht. Worüber soll ich mit ihm reden, mit diesem unentwegt Horaz zitierenden Langweiler, dieser tragischen Gestalt, die darunter leidet, dass ihre großen Jahre in Tübingen und Brüssel vorbei sind, diese glanzvolle Zeit, in der die Fachwelt ihre Publikationen noch raunend zur Kenntnis nahm? Seit vielen Jahren hat Capart keinen Satz mehr veröffentlicht. Mit stockendem Staunen trägt er seine alten Vorlesungen vor und katapultiert damit die nichtsahnenden Studenten zurück in die siebziger Jahre. Alle ernstzunehmenden Arbeiten bürdet er Polkinger auf. Der würde meine Magisterarbeit zwar als einziger Erdbewohner lesen, recht begabt, und die Ränder mit seinen ahnungslosen Anmerkungen verzieren, stilistisch schwach, ungenauer Ausdruck, schwerer logischer Fehler, aber wie ein greiser römischer Imperator, der schon bessere Zeiten gesehen hat, behält Capart sich das Recht vor, die alles entscheidende Endnote zu vergeben. Am besten unterhalte ich mich mit ihm übers Wetter. Der Aufzug löst sich mit einem motivationsarmen Ruck. «Jetzt gehts los, Herr Fahlmann!», sagt Capart aufgeräumt und gibt mir erneut Gelegenheit, Bekanntschaft mit seinem säuerlichen Mundgeruch zu machen, der sich heute mit einem mich melancholisch stimmenden Mottenkugelduft mischt, der aus dem Sommeranzug aufsteigt. «Na», der Krümel springt auf den Hemdkragen, wo er sich sichtlich wohlfühlt und es sich bequem macht, «was macht die Wissenschaft?»
«Gut», sage ich. «Trotz», und jetzt ist es soweit, «des Wetters.» Ich bemühe mich, ein intelligentes Gesicht zu machen, Doppelnullnummern, das um Tage verspätete Echo eines James-Bond-Vortrags von Winkler scheppert mir durch den Kopf, nur die Doppelnullnummern, aber Capart will leider nicht, haben die Lizenz, übers Wetter reden, zum Töten.
Stattdessen erkundigt sich die freundliche Doppelnull, die den jungen Dichter ins Herz geschlossen hat, leutselig: «Und was macht die Literatur, Herr Fahlmann?»
«Wie meinen Sie das?», frage ich unschuldig.
«Ihre Literatur. Das, was Sie so schreiben.»
Der Aufzug hält im Verteilergeschoss, öffnet sich, wartet, niemand steigt zu. «Ich werde demnächst wieder was veröffentlichen», gestehe ich. Die Tür schließt sich, schließt sich jedoch nur halb, denn Caparts linkes Hosenbein hat die Lichtschranke erschreckt. Überglücklich gleitet die Tür wieder auf, um den Aufzug einige peinigende Sekunden länger als zuvor warten zu lassen.
«Und was gedenken Sie demnächst zu publizieren, wenn ich fragen darf?»
Die Tür schließt sich. «Zwei Gedichte in einer Anthologie.»
«Kennen Sie sie auswendig?»
Was für eine saublöde Frage! «Nein, leider nicht.»
«Darf man die Titel der Gedichte erfahren?»
Der Aufzug setzt sich in Bewegung. «erste worte. letzte worte.»
«Aha», Capart denkt nach und verkündet dann mit selbstgefälligem Kopfgewackel: «Geburt, Adoleszenz und Tod.»
Peng! Ich bin abhängig von jemandem, den ich für einen völligen Trottel halte.
Natürlich steige ich in Caparts Auto, wenn er mir anbietet, mich in die Innenstadt mitzunehmen, auch wenn ich dort nichts verloren habe. Am Rathausplatz bedanke ich mich dann artig, sehe dem Volvo nach, bis er außer Sicht ist, und nehme den nächsten Bus zurück zur Uni. Aber im Gegensatz zu Marsitzky ist Capart weder gemein noch hinterhältig, und genau genommen fürchte ich auch nicht ihn, sondern seine Willkür, die, wie ich ahne, die Folge einer unbeschreibbaren Inkompetenz ist. So muss ich jederzeit damit rechnen, dass mir ein gruseliger Zufall (Polkinger, ein Missverständnis, üble Nachrede, eine unvorsichtige Veröffentlichung) Caparts Gunst und die Eins für die Magisterarbeit entzieht. Heute weiß ich, dass ich Capart damals mochte; ansonsten hätte mich der Mottenkugelgeruch seines altmodischen Sommeranzugs nie anrühren können, doch dieses Wissen ändert nichts; es macht alles bloß schlimmer. «Sie beschreiten da einen mutigen Bogen, wie er nicht selten begangen (…) vom ersten Gestammel des Kindes, das beglückt die Welt begrüßt (…) Ihr lyrisches Philosophieren von der Wiege bis zur Bahre sozusagen (…) wissen sicherlich, Herr Fahlmann, was der Dichterfürst (…) rief mit ersterbender Stimme: Mehr Licht!»
Endlich hat der Aufzug die Zieletage erreicht und macht die Saumseligkeit der Fahrt mit einem energischen Aufreißen der Tür wett. Er hat nicht nach der Hausarbeit gefragt, denke ich erleichtert. Ich hätte sie bereits vor fünf Wochen abgeben müssen. Oder vor neun? «Ach, Herr Fahlmann, ich wollte Sie was fragen! Da habe ich gestern schon … Etwas Dringendes. Was war es denn nochmal gleich? Ach, ja … Waren Sie mit Ihrer Lesung zufrieden?»
«Ja …» Ich hole in Gedanken aus, gleite dabei aber so heillos in geist- und sternlosen Weiten davon, den Kescher verloren, den Kompass verlegt, dass mir nichts anderes übrigbleibt, als den Vokal unbarmherzig in die Länge zu ziehen. Manchmal vermittelt gerade diese Form ohnmächtiger Sangeskunst den Eindruck besonnener, selbstkritischer Distanz. Kaum ist mein schier endloses «a» verhallt, schieße ich, ohne etwas dagegen tun zu können, ein heiter-gelassenes «durchaus zufrieden» nach, um ein Höchstmaß tiefer Bedeutung in der Tradition Fontanes vorzutäuschen.
«Herr Polkinger hat mir davon berichtet. Ich höre dann bald von Ihnen?»
«Bitte?»
Er tritt aus dem Aufzug. «Ihre Hausarbeit. Sie können Sie ja in mein Fach legen.»
Ich versichere Capart, das tun zu können, bald tun zu werden, voraussichtlich nächste, nein, schon diese Woche, vielleicht nächsten Montag, ähm, da arbeite ich, also Dienstag, ich zupfe das klebende Hemd vom Rücken, nein, alles in Ordnung, danke der Nachfrage, auf Wiedersehen.
Dabei hatte die Sache mit der Hausarbeit ganz harmlos angefangen! Nach der ersten Sitzung des Thomas-Mann-Hauptseminars hatte ich Professor Capart das abgeschmackte Thema Personennamen bei Thomas Mann vorgeschlagen, weil mir das der einfachste Weg zu sein schien, locker an einen Hauptseminarschein zu kommen. Keine umfangreiche Primärlektüre, kaum brauchbare Sekundärliteratur, keine Schinderei. Capart hatte nichts gegen die Personennamen einzuwenden und freute sich sogar über das «ungewöhnliche und ambitionierte» Thema. «Möchten Sie übernächste Woche referieren?» – «Kein Problem!», sagte ich, las in der Nacht vor dem Referatstermin einige Mann-Romane quer, kritzelte die Namen der darin auftauchenden Personen auf ein Schmierblatt, schmiss am folgenden Tag eine Fenetyllin ein, betrat den Seminarraum kaum verspätet und improvisierte fast fünfzig Minuten über Figuren wie Doktor Grabow, Pastor Pringsheim, den Speicherarbeiter Grobleben, Herrn Permaneder, Hofbräu, Herrn Nachbohr und Mamsell Jungmann. Bei Hofbräu und Herrn Nachbohr handelte es sich, wie ich Tage später herausfand, um Fehlgeburten des Querlesens, denn auf den Seiten 329 f der Buddenbrooks heißt es lediglich:
«Es ist nicht gerade Hofbräu, Herr Permaneder, aber immerhin genießbarer als unser einheimisches Gebräu.» Und der Konsul schenkte ihm von dem braun schäumenden Porter ein, den er selbst um diese Zeit zu trinken pflegte.
«I donk scheen, Herr Nachbohr!» sagte Herr Permaneder kauend und merkte nichts von dem entsetzten Blick, den Mamsell Jungmann ihm zuwarf.
Und was hatte ich so schön über die beiden gesprochen! Ich konnte von Glück sagen, dass ich nicht auch noch über die Herren Porter und Zeit oder den chinesischen Rikschafahrer Donk Scheen referiert hatte, aber auch dann wäre Capart wahrscheinlich entzückt gewesen. Ja, er war dermaßen aus dem Häuschen, dass er mir nach der Sitzung vorschlug, meinen «glänzenden Vortrag» zum Fundament einer bahnbrechenden Magisterarbeit zu machen, beziehungsweise gleich über dieses «hochinteressante und ergiebige Thema» zu promovieren. Zuerst brauche er jedoch die verschriftlichte Fassung des Vortrags. «Das bedeutet keine Mühe für Sie. Sie müssen bloß alles niederschreiben, und Ihre Hausarbeit ist in trockenen Tüchern!» Thomas Manns letzte Tagebucheintragung vom 29. VII. 1955 endet abgeklärt: Lasse mir’s im Unklaren, wie lange dies Dasein währen wird. Langsam wird es sich lichten. Soll heute etwas im Stuhl sitzen. – Verdauungssorgen und Plagen. Mir ging es seinerzeit kaum anders: Ich saß am Schreibtisch, hatte Darmdrücken und es erwies sich als schlichtweg unmöglich, das Referat zu rekonstruieren. Ich hatte alles vergessen. Langsam wird es sich lichten. Ich experimentierte mit Fenetyllin, mit Bier, mit guter und mit schlechter Laune, doch die Mosaikstückchen, die ich aus den Fenetyllinsümpfen zerrte, waren größtenteils unbrauchbar. Kurz streckte der Pastorensohn Grünlich den Arm aus dem Morast, winkte mir kraftlos zu, heiratete Tony und versank mit einem gellenden Aufschrei in der schwarzen Brühe. War Christian Buddenbrook nun mit einer Dame zweifelhaften Rufs namens Puvogel – oder Puffvogel? oder Pufforgel? – befreundet, oder spielte mir da mein Gedächtnis einen Streich? Vielleicht sollte ich mit Müller-Rosé aus dem Krull beginnen.
Manns große Kunst der Namensgebung, schrieb ich zögernd, zeigt sich am Deutlichsten, fuhr ich Mut fassend fort, in der Figur des schäbigen Schauspielers Müller-Rosé, den Felix Krull mit seinem Vater in der Garderobe des Theaters (Namen des Theaters nachschlagen!) aufsucht. Dadurch dass Mann den deutschen Allerweltsnamen «Müller» (im Namenslexikon prüfen!) mit dem im Volksmund «Rosé» genannten Roséwein paart, erreicht er, Mann, einen komischen Kontrast von einer schalen Schäbigkeit, die auf den fetten, schwitzenden Träger dieses Namens zurückfällt. Langsam kam ich in Fahrt. Denn gerade beim Roséwein handelt es sich um ein Produkt zweifelhafter Güte. Für Roséweine, hastiges Blättern, bzw. Weißherbstweine werden die Rotweintrauben nach einigen Stunden von der Maische abgekeltert und anschließend wie weißer Most vergoren. Nach der Hauptgärung folgt meist eine gelindere Nachgärung, die einen biolog. Säureabbau usw. Ich schrieb den kompletten Eintrag aus Meyers Taschenlexikon ab und fühlte mich dabei noch schäbiger als der gute Müller-Rosé mit seinen entzündeten Pickeln und dem schlecht sitzenden Toupet. Und wie sollte ich mit Professor Kuckuck verfahren, der, wenn ich mich nicht täuschte, die letzten Seiten des Krull mit seiner beleibten (?) Anwesenheit erfüllt? Sollte ich etwa seitenweise ornithologischen Schwachsinn zum Besten geben? Kuckucke [niederdt.] (Cuculidae), weltweit verbreitete Fam. schlanker, vorwiegend braun und grau gezeichneter, sperling- bis hühnergroßer Vögel mit rd. 130 Arten, v. a. in Wäldern, Steppen, parkartigen Landschaften und bei Thomas Mann, dem ungekrönten Meister der Namensgebung, dem dornengekrönten Meister des geistreichen Tagebuchs.
Sie wollen Beispiele, Professor Capart? Nun gut, hier sind die Beispiele, aber sagen Sie hinterher nicht, man hätte Sie nicht gewarnt! – Gedünstete Zwiebelringe bei der Arbeit verzehrt. K. klagt über meine schweren Blähungen (undatiert). – Verblüffend frühzeitiger Samenerguss mit dem beschämenden Gefühl artistischer Verfehlung und Unbeherrschtheit (2. III. 45). – Gute Laune dank Frivol (5. IV. 32) – Ich riss das Blatt aus der Maschine. Dieser Planet kann nicht kolonisiert werden! Dieser Fall wird nicht übernommen! Dieses Haus hat weder Fenster noch Türen! Ja, es überstieg meine Kräfte, diese Arbeit zu schreiben. Das alles raubte mir die Lust am Leben. Keine Sekunde länger durfte ich über diese bescheuerten Namen nachdenken! Was trinken Sie zum Geburtstag? – Einen Müller-Rosé, Frau Nutte! Ich konnte nicht länger an meinem eigenen Roman weiterarbeiten, wenn sich neben dem Schreibtisch der schiefe Turm der Thomas-Mann-Bände erhob. Vorwurfsvoll. Lindgrün. Doof. Ich brachte die Bücher zurück in die Universitätsbibliothek, wo sie hingehörten. Tage später verlegte ich den Zettel mit der amüsanten Namensliste. Zwei Wochen später erinnerte mich Polkinger lautstark daran (die tüteligen Damen von der Institutsbibliothek bekamen alles mit), dass ich den Abgabetermin der Hausarbeit längst überschritten hätte. Ich faselte etwas von plötzlichen Sterbefällen in der Familie und rief am selben Abend Professor Capart unter seiner Privatnummer an. «Die Arbeit ufert aus. Es war unumgänglich, einen langen Exkurs einzuschieben, zu dem größere Recherchen in der UB notwendig waren.» – Verwundert: «Einen Exkurs?» – «Ja, einen Exkurs über …» Fontane fiel mir ein. Und Reuter. – «Einverstanden. Reichen Ihnen drei Wochen?» – «Selbstverständlich.» – «Hat er dir noch Zeit gegeben?», rief Susanne aus dem Wohnzimmer.
«Drei Wochen», sagte ich. «Das schaff ich nie!» Susanne lag auf der Couch und studierte die Fernsehzeitung. Unter dem Minirock konnte ich (erlaubter Voyeurismus) den weißen Keil ihres Höschens sehen. «Du sagst doch immer, das Studium wär so einfach. Zieh die Sache durch, dann hast dus hinter dir!» – «Ja, es ist einfach, aber ich kanns nicht!» Ich ließ mich in den Sessel fallen, auf den ihre Beine zeigten: noch mehr erlaubter Voyeurismus. Die Freibadbesuche mit Anja hatten Susannes Haut gebräunt und feine Härchen sichtbar gemacht. Sie sah gut aus, sie durfte ins Schwimmbad, und an mir ging das Leben vorüber wie ein dicker, reicher Mann mit Smoking, Zylinder und Zigarre an einem Cartoonbettler. Capart, was für ein kranker Name! Thomas Mann hätte ihn sich nicht besser ausdenken können! «Und wieso kannst du das Ding nicht schreiben?» – «Ich kanns einfach nicht.» – Susanne legte die Fernsehzeitung auf den Wohnzimmertisch, wartete. – «Früher», gestand ich, «habe ich gerne Thomas Mann gelesen … wie er die Erdbeeren … das ist ja wirklich verdammt gut geschrieben … aber alles, womit man sich an der Uni beschäftigt, wird einem vergällt … als würden sie einem Drogen ins Trinkwasser … Kommt heute was im Fernsehen?» – «Der übliche Mist.» Pause. «Ich geh nachher sowieso noch weg.» – «Noch weg», bemerkte ich matt. Bevor ich den Raum verließ, drehte ich mich um. «Ich … äh … wollt dir noch was sagen: Gut siehst du aus!» – «Danke», sagte Susanne und schlug die Fernsehzeitung auf.
Das nächste Telefonat mit Capart hatte ich vier Wochen später geführt. Nun ging ich aufs Ganze und verwickelte ihn in ein längeres Fachgespräch. «In einem literarischen Werk ist die Namensgebung nicht unproblematisch. Eine dicke Frau kann Dommel heißen, ein Luder nie Doose. Ein Bestattungsunternehmer darf nie Grahlmann heißen. Ein alter, dünner Herr mit Hermann-Hesse-Brille kann aber durchaus Grahl heißen. Ein Name wie Gotter ist eine dunkle falsche Fährte; Raumhuber kommt nie aus der Kneipe nach Hause; Kasbohn riecht; aber Karlinski geht schon wieder. Das war jetzt vielleicht ein wenig zu unsachlich …» Leise klappte mein Doppelgänger, den ich die ganze Zeit über im Flurspiegel mit reserviertem Ekel beobachtet hatte, das Telefonbuch zu. «Ein wenig zu unsachlich?», wiederholte ich fragend. – «Oh, das war keineswegs unsachlich!» – «Untersuchte man die Namen im Werk Thomas Manns unter ähnlichen Gesichtspunkten, käme vielleicht als Ergebnis heraus, dass sie strenggenommen gar nicht funktionieren dürften.» – «Aber sie tun es!», bemerkte Capart entzückt. «Jedenfalls fast immer, denn Namen wie Serenus Zeitblom, Adrian Leverkühn oder Hofbräu …» – «Ja, das ist zu dick. Viel zu dick! Äh, Hofbräu ist zu dick! Den Namen meine ich. In München da steht Hofbräus Haus!», rief ich und schämte mich über meine unterwürfige Euphorie.
Und nun, nach der fürchterlichen Begegnung im (s. o.) Aufzug des Todes, müsste ich Capart demnächst ein drittes Mal anrufen; Achim würde sich schlapplachen. Unversehens ist mein Leben zu einem langen, in der Sonne weiß glühenden Gleis geworden, auf dem ich eine Hausarbeitsdraisine durch Telefonanrufkraft wochenweise vor mir herschiebe, ohne jemals den Zielbahnhof zu erreichen, wo mich ein greiser, unartige Liedchen trällernder Capart auf einem Schrankkoffer voller Literaturlexika erwartet. Capart ist der einzige Professor in der Germanistik, der die Seminararbeiten schon während des Semesters haben will. Weshalb? Das hat doch überhaupt keinen Sinn! Aber vielleicht ist es doch zu bewältigen. Ich muss, ich muss, ich muss diese beschissene Arbeit schreiben! Dies hatte ich etwa einen Tag nach der Aufzugsfahrt mit Capart und etwa einen oder zwei Tage, bevor ich mich über den Schreibtisch beugte, um erneut über Namen nachzudenken, notiert.
Im wirklichen Leben (was auch immer das sein mag) schienen die Namen seltsamerweise immer zu passen. Alle Namen! Winkler konnte nur Winkler heißen, Marsitzky nur Marsitzky, und dass hinter der hübschen Jasmin der tumbe Nachname Rimbach hertrottete, passte auch irgendwie. Irgendwie, aber wie? Ich zerbrach mir nicht zum ersten Mal über dieses vertrackte Thema den Kopf, denn es war mir noch nie leichtgefallen, richtig klingende Namen für meine Protagonisten auszudenken, unaufdringliche Namen, die fest mit ihrem Wesen verschmelzen ohne ausgedacht zu wirken. Nie, aber auch wirklich nie, hätte ich eine meiner Figuren Capart genannt (außer vielleicht den langzahnigen Kutscher eines karpatischen Fürsten). In der Wirklichkeit hingegen ging dieser Name bedenkenlos durch. Komisch. Wieso sollte er dann nicht auch in einem literarischen Text funktionieren? Capart spürte das beruhigende Gewicht der Luger in der Hosentasche. Capart hatte den Berg schon oft zuvor erklommen, aber heute war ein besonderer Tag: Heute würde er Polkinger auf dem Gipfel treffen. Nur mit solchen Beispielsätzen gelang es mir, einen Namen auf Texttauglichkeit zu testen. Die Hauptperson meines Romans hatte ursprünglich heißen sollen: Eisler (zu kalt), dann Lindner (zu warm, zu wurmig), und erst nach mehreren Wochen und hunderter solcher Testsätze hatte ich einen wohltemperierten Namen gefunden, der passte, einen wunderbaren, zweisilbigen Namen, der gleichzeitig hart und dumpf klang. Vielleicht hätte ich meinen Helden auch Capart nennen können. Obwohl: Mein Held sah nicht wie ein Capart aus. Caparts waren dümmliche Greise, die sich darin gefielen, nett zu jungen Lyrikern zu sein, weil diese sie irrtümlicherweise an jüngere Versionen ihres Ichs erinnerten. Bestimmt hatte der junge Capart geschriftstellert, Selbstgereimtes im Stil Gottfried Benns, und heute schrie die Prostata. Namen. Weiter über Namen nachdenken!
Um seine charakterlosen Protagonisten zu benennen, arbeitete Winkler mit einem Namenslexikon, während ich meine Erinnerungen plünderte (ehemalige Nachbarn, Lehrer, Feinde), seltener Anagramme bastelte, noch seltener eigene Erfindungen verwendete oder, wenn gar nichts mehr ging, das Telefonbuch von Kiel bemühte. Von Kiel, damit ich nicht in Gefahr lief, den Leuten aus meinen Texten irgendwann einmal auf der Straße zu begegnen. Das Telefonbuch von Kiel, das damals immer auf meinem Schreibtisch lag, war ein wunderbares Buch voller enigmatischer Einträge wie: Mehmet Nuri Atabek, Mustafa Atak, Altanta Segelyacht, ATARI Fachhändler, Seydi Atas, Bahman Atashfeshan, Ahmet Atasoy. Nachdem Mehmet Nuri Atabek, Mustafa Atak, Atlanta Segelyacht und Ahmet Atasoy die Wüste Atas durchquert hatten, gelangten sie in eine kleine Stadt, und über den engen Gässchen und hinter dem sengenden Auge einer unbarmherzigen Sonne klappte ihr Schöpfer das Telefonbuch zu, beendete ihre Existenz, fand sich auf einem Dachboden in der süddeutschen Provinz wieder, es war später Nachmittag, und er wusste, dass er diese verfluchte Hausarbeit niemals schreiben würde. Ich zog der Schreibmaschine die Phrygiermütze (Gott, hatte ich mich bei der Lesung blamiert!) aus schwarzem Plastik über den Kopf und ging nach unten – Susanne hatte Herrenbesuch. Doch ich greife vor. Holzstufen knarrten; die Treppenhauswände waren untapeziert; den Abstieg begleiteten eine in Handhöhe angebrachte Zierleiste (links) und ein Geländer (rechts), dessen Handlauf sich rau wie die Haut eines Dickhäuters anfühlte. In unserer Wohnung lachte Susanne. Vielleicht ist Anja zu Besuch, dachte ich, aber da hörte ich ein Männerlachen. Ich setzte mich auf die Antrittsstufe, Susanne lachte, der Mann lachte, ich kniff mir ausgiebig in den Handrücken, stand endlich auf und steckte den Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür.
Augenblicklich machte sich befangene Stille breit, kroch in sämtliche Ritzen und Winkel meines Zuhauses, kroch in die Taschen der sehnsüchtig auf den Winter wartenden Mäntel an der Garderobe, kroch sogar hinter Spiegel und Weltkarte.
«Schatz?», fragte ich halblaut, um sie zu ärgern.
«Hier!», rief Susanne. «Wir sind im Wohnzimmer.»
Neben ihr auf der Couch saß der weißhaarige Kerl, mit dem sie sich immer in der Edeka-Kantine traf. Vor ihnen auf dem Wohnzimmertisch schaute ein mit Krümeln bedecktes Papptablett aus der Tüte einer mir wohlbekannten Bäckerei. Susanne stellte ihre Tasse neben den Untersetzer. Der Kerl starrte mich mit leerem Gesichtsausdruck an, abwartend, selbstsicher, ohne den leisesten Funken Neugierde, den ich ihm gnädig als Intelligenz ausgelegt hätte. Jemand wie ihm konnte man bestimmt erzählen, Käpten Nero habe bei Trafalgar die belgische Flotte besiegt. Der Schwachkopf sah aus, als käme er direkt aus Spitzbergen. Dort arbeitete er wahrscheinlich in einem Tante-Emma-Laden, denn seine grüblerisch vorstehende Unterlippe und das ausgeprägte Kinn machten es so gut wie unmöglich, nicht an altmodische Registrierkassen zu denken. Käpten Neptun, letterte ich für eine imaginäre Idiotengazette, steckt mit seinem Atom-U-Boot Naupilus im Krakianengraben fest. Von den Ohren sichelten sich schneeweiße Koteletten zu den Mundwinkeln; die Albinohaare hatte er in modischen Gustav-Gans-Wellen zurückgegelt; an eine solche Allerweltsvisage erinnert man sich nur, wenn einem der Besitzer mit einer Machete die Hand abgehackt hat. Ungeheuerlich, dass Susanne für einen solchen Blödmann ihr Haar hochsteckte (normalerweise tat sie das nur, wenn sie freitagabends mit Anja ausging). Aber noch ungeheuerlicher fand ich es, dass mein guter Freund, der sonst so menschenscheue Om, wohlig schnurrend und mit geschlossenen Augen auf dem Schoß des Scheißkerls saß. «Tach», sagte ich ansatzweise diplomatisch.
«Das ist der Wolfgang», Susannes Hand wedelte unbehaglich in seine Richtung, streckte sich aus, zeigte auf mich: «Der Georg.»
Die Oberschenkel der beiden berührten sich auf der Couch.
«Wir kennen uns vom Sehen», sagte der Weiß-Haar-Mann.
Susanne sah ihn an, sah mich an, sah Om an.
«Ich geh mal ne Cola trinken», sagte ich. Im Flur rief ich in meiner verlockensten Jetzt-gibts-was-zu-fressen-Stimme nach Om, doch der wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich trank eine Dose kalte Cola am offenen Küchenfenster, rauchte eine Senior Service, aschte in den Hof und bedauerte Heinz, der mit Onkel Jörg einen patinierten Eichensarg mit Palmenschnitzung zum Transit trug, Turmuhren, ich dachte an Turmuhren mit Glockenspiel, jede Stunde liefen die mechanischen Abbilder von Onkel Jörg und Heinz mit einem Sarg rund, der Sarg verband Onkel Jörg in einem Winkel von 35 Grad mit Heinz’ gekrümmter Gestalt, ruckartig bewegten sich beide Figuren zum Dröhnen der Glocken, ein allegorisches Bild der Vergänglichkeit, eine ächzende, kreuzkranke Sarguhr, der Transit fuhr davon, ich hob den Blick zur Küchenlampe, die Punkte, das ist Fliegenschiss, zweite Dose. Die klebrige matte Süße der Cola harmonisierte bei Weitem nicht so gut mit der Zigarette wie Espresso. Eine Espressomaschine wäre eine lohnende Anschaffung, eines dieser ewig verschnupften Metallungetüme – aber wo das Ding hinstellen? Ich sah mich um, fand keinen geeigneten Platz, schaute wieder aus dem Fenster, hinter mir tropfte der Wasserhahn. Jemand lachte. Pause.
Einige Stunden später: Ich erinnere mich mit Wehmut an unsere Küche. Ein Fenster (mein Fenster!) in der Westwand (Hof), ein Fenster (anderes Fenster) in der Südwand (Straße), dazwischen die vollgebröselte Hochebene des Kiefernholztischs, den uns Heinz zur Hochzeit gezimmert hat. Ich lasse den Blick über die Nordwand des erinnerten Raums gleiten: Östlich der Küchenlokomotive, deren einzelne Wagons «Herd», «Spüle» und «Kühlschrank» heißen, führt die nördliche der beiden Türen in den Wohnungsflur; über der bewegungslosen Lokomotive schweben Hängeschränke als Holzgewölk, dazwischen das kalkfenstrige UFO des Boilers. Ein demütigendes Doppellachen ertönt hinter der Tür in der Ostwand, der Tür zum Wohnzimmer; Susannes melodisches Gelächter zerrissen von rauhem Belfern. Lachte Susanne, es tut weh, daran zu denken, warf sie den Kopf in den Nacken. Die Haut spannte sich an ihrer Kehle und vertiefte die Grube zwischen den Schlüsselbeinrändern. Gott sei dank ist Jens unten bei Mutter und macht mit ihr seine idiotischen Hausaufgaben. Ich hatte befürchtet, dass Susanne den Burschen irgendwann einmal anschleppen würde, eine Eisenstange über den Kopf, nimm dies, du Bastard einer räudigen Spitzbergenschlampe! Packt mal an, Freunde, wir legen ihn zu ner dürren Oma in den Sarg. «Die Alte ist verdammt schwer», wundern sich die Sargträger. «Weitermachen!», rufe ich, sie geben Seil nach, der Kasten rumpelt hinab ins Erdloch, Amen. Nur ins Krematorium darf der Sarg nicht kommen, denn von dort nehmen wir alle Särge wieder mit, bevor Onkel Jörgs Mitverschwörer die Toten auspacken und auf großen Pappkartonstücken in den Hänsel-&-Gretel-Backofen schieben. «Eine Schande ist das!», hatte sich Onkel Jörg gerechtfertigt, als wir nach meinem ersten Arbeitstag im Beerdigungsinstitut Gebr. Fahlmann ein Bierchen im Büro tranken. «Man kann doch keinen Kiefernsarg, der 1.228,– DM wert ist, verbrennen lassen!» Ich verstand sofort.
«Du verkaufst die Särge also wieder, als wären sie ungebraucht?» – «Armin war nie damit einverstanden, aber du musst doch zugeben, dass die Leute dafür bezahlen, den Sarg, den sie gekauft haben, nie wiederzusehen. Sie wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und ob der Sarg nun verbrannt wird, oder ob ich ihn an den nächsten Kunden weiterverscherbele, ist doch schnuppe!» Onkel Jörg setzte die Bierflasche an. Er hatte die Angewohnheit, die Augen beim Trinken zu schließen. Er hob die Flasche zum Mund und mit dem ersten Schluck schlossen sich die Rollos der Augenlider, um sich erst wieder zu öffnen, wenn sich der Flaschenhals von den Lippen gelöst hatte. «Ohne Sarg gibts weniger Asche», erklärte Onkel Jörg und öffnete die Augen, «aber die Jungs kippen deshalb was aus ner anderen Urne bei, damit niemand was auffällt. Keine Bange. Die halten dicht.» – «Habt ihr das immer schon so gemacht?» – «Nein.» Im Zeitlupentempo drehte sich ein Bleistift in Onkel Jörgs prächtig behaartem Ohr. «Dein Vater sah das, wie gesagt, etwas anders. Aber», Fingernagel schnippst gelben Krümel von Bleistiftspitze, «du musst doch zugeben …» – «Jörg, ich hab damit keine Probleme. Ehrlich nicht!» – «Na, wenigstens einer, der die Sachen realistisch sieht!»
Ich nahm mir vor, auch die Sache mit dem Weiß-Haar-Mann realistisch zu sehen, kehrte ins Wohnzimmer zurück und ließ mich unbeteiligt in den Sessel gegenüber der Couch fallen. Der Weiß-Haar-Mann erzählte gerade eine lange und einschläfernde Folge von Anekdoten über einen Igel, der angeblich bei ihm im Badezimmer überwintert hätte. «Immer wenn ich mich geduscht hab, ist er hibbelig geworden. Ist wie ein Bekloppter vor der Dusche hin- und hergerannt, der Igel.» Beim Wort «Igel» huschte ein versonnener Ausdruck über sein Gesicht. «Wenns regnet, kommen nämlich die ganzen Würmer raus.» Er lachte und rümpfte die Nase. Ich wusste nicht, was los war, Pantomime war los, denn sogleich rief er in begeistertem Grusel aus: «Igelscheiße stinkt unbeschreiblich!»
Ich beobachtete Susanne aus den Augenwinkeln und warf ein: «Wenns regnet, sollte man ‹Igel! Igel!› schreien.» Erst prüft der winterliche Angler die Dicke des Eises mit einem tastenden Fuß, bevor er hinaus auf den See geht, um ein Fangloch aufzubrechen. Keiner zeigte sich von meinem Vorschlag begeistert. «Igel! Igel!», sagte ich leise, und nun war die Zeit gekommen, der Angler lässt die Leine in den eiskalten See hinab, einige gewagte taktische Manöver zu vollführen. Da der Weiß-Haar-Mann meine Frau unentwegt Susi nannte, nannte ich sie nun auch so und erkundigte mich in aller Unschuld bei besagter Susi, wo überhaupt Jens sei, Spannungspause, unser Kleiner.
«Unten», antwortete Susanne. Der Weiß-Haar-Mann kraulte den Verräterkater. Unbehagliches Schweigen. «Igel sind lustig», meinte Susanne.
«Ich könnt mich totlachen!», sagte ich.
Ihr Verehrer begann weiterzufaseln (fortgesetzter Igel-Blödsinn, um sich bei Susanne als Tierfreund einzuschleimen), wobei sein Blick leicht hektisch (Käpten Nemson streicht die Segel) über den Boden glitt, als habe er dort etwas Wichtiges verloren (die Maupilus). Ich beschloss, den Weiß-Haar-Mann auszusitzen. «Und was machst Du?», fragte er, als ihm nach einer Weile dämmerte, dass ich keineswegs vorhatte, das Wohnzimmer allzubald wieder zu verlassen.
«Schreiben.»
«Wie … schreiben?»
«Einen Roman.»
«Toll», sagte er. Und zu Susanne: «Ich wollte auch immer mal einen Roman schreiben. Was alles so im Lager passiert. Ja. Ähm. Vielleicht mach ich das auch mal, wenn ich die Zeit dazu hab.»
«Ja, mach das mal!», empfahl ich ihm von oben herab. Meine uneingeschränkte Verachtung gehört Leuten, die glauben, man bräuchte nur Zeit, um einen Roman zu schreiben. Ich war einkaufen. Hui, was ich da erlebt hab! Da könnt ich glatt nen Roman drüber schreiben. Was heute an der Uni passiert ist. Ich sag dir: ein Roman! Zu jener Zeit notierte ich: Schreiben bedeutet Qual, Leiden, Verlust des wirklichen Lebens, und da man keine Zeit und Kraft hat, aufzupassen, kommen irgendwelche Burschen angelaufen und schnappen einem die Frau weg. «Ich wäre überaus neugierig», feixte ich, «einen packenden, bestsellerverdächtigen Edeka-Roman aus deiner Feder zu lesen. Da wäre ich wirklich sehr sehr neugierig drauf!» Susanne kraulte den Kater im Genick, der immer noch auf dem Schoß des Igelfreunds lag; Oms Schweif zuckte in sichtlichem Unbehagen; dann stand der Kater auf, krallte sich in Jeansstoff (Weiß-Haars Geldschublade erbebte), machte einen Buckel, sprang dumpf auf den Teppich und stolzierte erhobenen Schweifes davon, wobei er es sichtlich genoss, dass ihm alle Welt die gebührende Aufmerksamkeit zollte. «Er mag keine Fremden», sagte ich.
«Er hat sich aber gleich zu Wolfgang auf den Schoß gesetzt.»
«Anfängerglück», ömmelte ich böse.
«Ich weiß nicht, was du hast», sagte Susanne, als wir endlich alleine und wieder in der Lage waren, ein halbwegs vernünftiges Gespräch zu führen. «Er ist doch ein netter Arbeitskollege.»
«Ganz nett sind sie alle. Höß war auch ein ganz Netter …»
«Du hast dich unmöglich benommen.»
«Al Bino ist ein Idiot.»
«Nenn ihn nicht so! Weißt du überhaupt, wieso er so weiße Haare hat?»
Ich schüttelte den Kopf und erfuhr: Der gute Al fährt mit seinem Gabelstapler den ganzen Tag vom Kühlraum ins Lager und wieder zurück. Im Kühlraum herrscht eine Temperatur von 20 Grad minus; im Lager dagegen sind es 18 Grad plus. Es ist so arschkalt im Kühlraum, dass weißer Nebel rauswabert, wenn die Schleusen aufgehen. Wie in einem Hard-Rock-Video. Und unser Freund Al, yeah, yeah, hält es nicht für notwendig, bei der Arbeit eine Kopfbedeckung zu tragen, yeah, yeah, yeah!
«Und nach drei Monaten», schloss Susanne, «waren seine Haare schlohweiß.»
«Da hätte sich Al besser ne Pudelmütze aufgesetzt.»
«Ach, halt doch die Klappe!» Susanne sah aus dem Fenster, ein Laster rumpelte vorbei, das Kaffeegeschirr auf dem Wohnzimmertisch antwortete mit freudigem Klirren, draußen ertönte eine Hupe, meine Frau hob die Hand, winkte jemandem auf der Straße (jemandem, der im LKW vorbeifuhr?) und sagte mit gefährlich leiser Stimme: «Vorhin hat eine Inge angerufen.»
«Und?», fragte ich.
«Nichts und.»
«Ruft sie nochmal an?»
«Hat sie nicht gesagt.» Susanne drehte sich zu mir um und imitierte eine affektierte Frauenstimme: «Ist der Georg da?» So ein Quatsch! Inge redete nicht so! «Schade!», flötete Susanne weiter. «Dann richten Sie ihm bitte aus, Inge hätte angerufen. Danke. Auf Wiederhören.»
Inge war seit der VHS-Lesung nicht mehr ins Thomas-Mann-Seminar gekommen. Verkratzte Handrücken. Susanne belauerte mich aus den Augenwinkeln. «Eine Kommilitonin», gab ich zu (schuldbewusst). «Von der Uni» (naheliegend). «Sie war», (versteckter Vorwurf), «bei meiner Lesung.»
«Ist sie hübsch?»
«Was ist das denn für ne blöde Frage?»
Susanne hob die rechte Augenbraue.
«Ja, sie ist hübsch, aber das hat nichts zu bedeuten. Was gibts denn da so saublöd zu grinsen?»
«Und du regst dich auf, wenn ich mal nen Arbeitskollegen zum Kaffee einlade! Ich bin nur froh, dass der Wolfgang so ein feiner Kerl ist! Stell dir vor, er würd alles in der Firma rumerzählen!»
«Würd was alles in der Firma rumerzählen?»
«Natürlich deinen peinlichen Auftritt als Hausgockel!»
«Habt ihr Streit?»
Jens stand in der Tür.
«Nein», sagte Susanne. «Dein Vater ist nur ein wenig gestresst, weil er sein Studium nicht auf die Reihe kriegt.» Unten pinkelte Mutter. Laut plätschernd. Der Strahl wechselte zweimal die Tonlage, wurde leiser, wurde lauter und pladderte aus. «Das hat gerade noch gefehlt!», stöhnte Susanne.
«Komm mit!» Ich nahm Jens an der Hand. «Ich les dir was vor.»
«Was Lustiges?»
«Selbstverständlich. Heute werden nur lustige Sachen vorgelesen.»
In seinem Zimmer angekommen erklomm Jens das Etagenbett, ließ die Beine baumeln, ich kippte Schmutzwäsche vom Schreibtischstuhl und rückte ihn so an die Kletterleiter des Betts, dass ich die Füße auf die fünfte Sprosse legen – verfluchter Schnappschuss! Obwohl Jens damals sieben Jahre alt war, ähnelt er in meinen Erinnerungen dem Vierjährigen, dessen Bild ich im Geldbeutel habe; ein Beispiel dafür, wie der einmalige Fingerdruck auf einen Auslöser das ganze Erinnerungsvermögen schachmatt setzen kann. In einem Akt unverzeihlicher Willkür reißt die Fotografie einen strenggenommen völlig bedeutungslosen Moment aus der Zeit, und an diesem bis zum Platzen mit scheinbarer Bedeutung aufgeladenen Augenblick staut sich von nun an der ohnehin unzuverlässig strömende Fluss des Erinnerns. Staut sich, bildet Strudel, und das Wasser fließt nicht mehr weiter, um das versandende Flussbett von Schwebteilchen und Algen zu befreien. Susanne, von der ich kein Bild bei mir habe, sehe ich deutlich vor mir, schmerzhaft deutlich, aber das Gespenst des fotografierten Vierjährigen schiebt sich beständig über meinen damals schon siebenjährigen Sohn. Ich erinnere mich an den launischen Zug um seinen Mund, an seine Art, den Ranzen ins Kinderzimmer zu schleudern, wenn er aus der Schule nach Hause kam, an seine Angewohnheit, mit den Augen zu zwinkern, wenn er sich sehr konzentrierte, doch unter beharrlicherem Zugriff verschwimmt die Gestalt meines Sohns, verflüchtigt sich, wird zu einem Nebelfleck inmitten überdeutlicher Kulissen. Ich glaube, ich mochte den Nebelfleck sehr. Besonders wenn er vor Vergnügen auf der Stelle hüpfte, wie es nur Kinder und Irre können … Ich habe alles falsch gemacht.
Ich stecke mir eine Zigarette an. Weiter! Momentan liegt der verhängnisvolle Schnappschuss neben der schreibenden Hand auf dem messingeingefassten Marmor-Rund des Café-Tischs. Selig sitzt Jens auf einem Kinderfahrrad, das sich mit vor Anstrengung verkrümmten Stützrädern vom Schotter erhebt. Er hat Susannes Augen, meinen Mund, meine unkämmbaren, schwarzen Haare, und das Gesicht – ja, so könnte Großvater als Kind ausgesehen haben. Jens mochte Geschichten. Abends saß ich lange an seinem Bett und erzählte von Curbel Gölmop, einem hummelkleinen Mann im schwarzen Hochzeitsanzug. Curbel kann fliegen. Klemmt er sich dabei ein rotes magisches Plastikeimerchen unter den Arm, wird er unsichtbar. Jens. Was fällt mir noch zu Jens ein? Es bekümmerte mich, dass er irgendwo diese Filme sah; bestimmt bei Florian, dessen Eltern beide berufstätig waren. «Ich habe Angst, dass er verroht!», hatte ich Großvater am Telefon erzählt. «Am liebsten würde ich ihn gar nicht aus dem Haus lassen. Ich lese ihm Die Schatzinsel und Der kleine Hobbit vor, und das gefällt ihm gut, sehr gut sogar, aber dann schaut er sich bei Florian oder irgendeinem anderen Videosüchtigen Actionfilme an, die ab 16 Jahren sind!» Derartige Erziehungsangelegenheiten pflegte ich mit Großvater zu besprechen, ehe ich mit Susanne in den Boxring einer Diskussion stieg und meist verflüchtigten sich meine Bedenken noch während des Gesprächs, denn Großvater sah alles gelassen und arbeitete mit allen Tricks. «Nein», antwortete ich ihm eine Spur zu gereizt. «Es hat mir nicht geschadet, als Kind Gespensterhefte gelesen zu haben, aber es reißt mich nicht gerade zu Begeisterungsstürmen hin, wenn mir mein siebenjähriger Sohn irgendwelchen Unfug über ‹coole Waffen› erzählt! Und um deiner Frage zuvorzukommen: Nein, es hat mir nicht geschadet!»
«Liest du mir Quatschlieder vor?», fragte Jens.
«Gerne.» Ich legte die Füße auf die fünfte Sprosse der Leiter und zog schWEINe-essIG aus dem Regal, wo es in Gesellschaft von Walt Disney’s Lustigen Taschenbüchern bestens aufgehoben war. Jens mochte meine Gedichte. Lachte er darüber, stellte sich bei mir ein nicht uninteressantes Gefühl der Zufriedenheit ein, das Buch veröffentlicht zu haben. Winkler würde das nicht verstehen! Er hatte sich kein einziges Mal zu meinem Gedichtband geäußert und war wohl aus Neid, selbst keinen Verlag für seine exzentrischen Texte voller redender Tassen und beleidigter Kaffeekannen gefunden zu haben, zu keiner meiner Lesungen gekommen, aber das hatten wir ja schon. Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht, aber Sie können es nachschlagen. Sie haben ohnehin die besseren Karten. Also spielen Sie damit! Zurück zu Winkler! Wer sich nicht für mich interessierte, würde selbstverständlich nie anvertraut bekommen, wie schWEINe-essIG wirklich entstanden war! So einfach war das! Außerdem musste man vorsichtig sein, was man ihm erzählte, denn er klaute alles, was ihm unter die Finger kam. «Darf ich das haben?», fragte er beiläufig, ein reines Ablenkungsmanöver, denn er hatte längst mit seinem Schmetterlingsnetz ausgeholt und die betreffende Formulierung aus der rauchgeschwängerten Luft des Wohnzimmers gefischt. «Das habe ich schon verwendet», sagte ich. – «Und jetzt gehört es mir», sagte Winkler, der außerdem, wie er mir einmal stolz gestand, alle guten Stellen in Büchern, die er las, für spätere Plünderungsarbeiten mit Kringeln markierte. Ich kannte nicht alle seine Texte, aber in den wenigen, die ich kannte, fanden sich beängstigende Echos unserer Gespräche und, was mich weitaus mehr fuchste, meiner Erzählungen. Natürlich wusste ich, dass ich ihm meine Prosa niemals zeigen dürfte (und schon gar nicht die ersten Kapitel des Romans), doch nach einigen Bieren besiegte die Eitelkeit regelmäßig die Vernunft, und ich erwachte am folgenden Morgen mit der Gewissheit, dass nun meine besten Ideen fröhlichen Einzug in Winklers Geschichten hielten. Vielleicht benannte er sogar eine seiner belebten Tassen nach meinem Helden, stahl mir diesen wunderbaren Namen, ohne den mein Roman blass und farblos wäre. Mit dem Namen raubte man meinem Helden sein Wesen, seine Eigenarten, seinen Charakter, raubte ihm alles, was er besaß, und sollte ich eines Tages herausfinden, dass Winkler mir diesen Namen gestohlen oder einen ähnlichen Namen verwendet hätte, der sich, sagen wir mal, nur durch einen einzigen Buchstaben vom Namen meines Helden unterschiede, würde ich unsere Freundschaft so beiläufig beenden, wie man einem unliebsamen Gast in Mollingers Eck das volle Bierglas mit einem Klaps vom Tisch in den Schoß befördert.
«Was hast du, Papa?»
In der Küche klapperte Susanne mit Töpfen und Pfannen.
«Nichts. Ich denke über Winkler nach.»
«Nicht über Mama?»
«Nein.»
«Was denkst du über Winkler nach?»
«Dass er ein Idiot ist.»
«Wieso ist die Amö… wieso ist Winkler ein Idiot?»
«Er klaut Ideen.»
«Wie kann man Ideen klauen?»
«Aus meinen Geschichten.»
«Darf er das denn?», fragte Jens, und auf einmal sehe ich ihn so vor mir, so, wie er damals aussah, sehe ihn hier im Le Maubeuge (Alexandria) deutlich vor mir, stecke die Fotografie in den Geldbeutel, sehe Jens siebenjährig auf dem Etagenbett sitzen. Sein Gesichtsausdruck imitiert die kumpelhaft freundliche Neugierde eines Erwachsenen, auf den Oberschenkeln hat er das mit Star-Wars-Charakteren bedruckte Kopfkissen, nein! Zu spät! Wieder hat der vierjährige Radfahrer den Siebenjährigen aus den Erinnerungen gedrängt. Mit einer Handpantomime bedeute ich dem Kellner, mir noch einen café serré zu bringen, prompt ertönt ein metallisches Schnäuzen, bestimmt geht es ihm gut, denke ich, Susanne wird schon dafür sorgen, dass es ihm an nichts fehlt, bestimmt geht es ihm gut. Ich weiß noch, wie wir zu dritt vor der Weltkarte standen und über den Titicacasee lachten, oder wie entzückt Jens und Susanne waren, als ich ihnen vom Popocatépetl erzählte. Sie glaubten mir nicht, dass es einen Vulkan dieses Namens gibt. «Polarstern, Polykarp, Popanz, Popmusik, da steht er ja, der Popocatépetl! Na, hab ich jetzt recht – oder was?» Ich stecke mir eine Zigarette an, ein schneidend kalter Windstoß treibt mir die Tränen in die Augen, und ich tauche ein in meine Erinnerungen, tauche tief ein, tiefer und treibe davon, rechts neben meinen hochgelegten Füßen das Schlachtfeld auf Jens’ Nachttisch: Kaugummistreifen, Schokokekse, unverständliches Plastikspielzeug aus Überraschungseiern … «Bist du traurig wegen dem Streit?»
Des Streites, korrigierte ich in Gedanken und sagte: «Nein.»
Aufgeregt: «Ich hab mit Florian heute auch Streit gehabt.»
«Ich habe mit Mama nur diskutiert.»
«Ihr habt geschrien.»
«Wir haben laut diskutiert.»
Jens sah mich zweifelnd an.
«Ehrlich», sagte ich. «Wir haben nur diskutiert.»
«Was heißt ‹diskutiert›?»
«Ernst über etwas geredet», sagte ich und schlug das Buch auf, ehe er das Kreuzverhör fortsetzen konnte. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Vater war, aber ich weiß, dass ich mir Mühe gegeben habe. Als der scWEINE-essIG ungenießbar zu werden drohte, trug ich Jens noch einige zentrierte tiergedichte vor, die ich in Der Tex(t)aner veröffentlicht hatte. Die arroganten Trottel hatten nie was von mir drucken wollen, mir meine Erzählungen kommentarlos, zerknittert und kaffeefleckig zurückgeschickt, doch kaum war mein lyrisches Magnum Opus in einem angesehenen Verlag erschienen, kam ein aufgeregter Anruf voller verbaler Bücklinge aus München, und nur um zu sehen, wie weit ich gehen konnte, schickte ich ihnen zwanzig Gedichte dieses Kalibers:
die tiere im huhn
der bär der bär
was tun was tun
so schwer so schwer
oh huhn du armes armes
oh bär auch ein armer ein armer
barmherzigkeit fürs huhn
und gnade dem bären dem armen
dem armen bären im huhn
Sie wurden gedruckt. Alle zwanzig. Wurden genauso kommentarlos gedruckt, wie erste worte, letzte worte gedruckt werden würden. Mein großzügiger Verlag hatte mir bereits das Honorar für beide Gedichte überwiesen. Wenn ein Lyriker pro Gedicht drei Schachteln milde Zigaretten (Stückpreis der Schachtel: 5,45 DM) und ein Bier (Preis pro Glas in Mollingers Eck: liebenswerte 2,50 DM) verdient und noch 15 Pfennig Rest behält (hurra!), wie viel verdient er dann mit zwei Gedichten? Zusatzaufgabe: Überlege! Lohnt sich die Plackerei, wenn heutzutage selbst ein Hilfsarbeiter einen Stundenlohn von 12,00 DM bekommt? Jens sprang aus dem Bett und ging neben mir nieder wie eine Bombe. «Ich muss jetzt fernsehen! Mama hats erlaubt.» Ich öffnete den Mund, um zu fragen, was er sich denn ansehen wolle, doch er kam mir zuvor, rief: «Tiere! Tiere!» und hatte das Zimmer verlassen. Richtige Antwort: Der Lyriker verdient mit zwei Gedichten satte 38 Mark. Als ich einige Minuten später das Wohnzimmer betrat, fand im Zoologischen Garten eine Inventur statt. Eine Dutzendschaft erregter Wissenschaftler und mürrischer Wärter vermaß Kamele und zählte Flamingos, eins, zwei, drei, die Vögel setzten sich in Bewegung, vier-fünf-sechs, begannen zu rennen, siebenacht, Flügelschlagen, neun, nein, ich fang nochmal von vorn an; man katalogisierte Pinguine (sie standen der Sache skeptisch gegenüber, aber einigermaßen still), diskutierte hitzig, zählen wir die Wildenten nun mit oder nicht, und verzeichnete akribisch die Ergebnisse. «Da Schlangen sehr langsam wachsen, ist jeder Zentimeter wichtig.» Man sah, wie eine Gruppe Männer eine oberschenkeldicke Schlange auf dem Boden des Reptilienhauses zu strecken versuchte. «Pro Meter Schlange», tönte der Onkel Fernsehsprecher, «braucht man einen Mann zum Festhalten.» Die Männer machten sich an der Schlange zu schaffen, zerrten sie über die Kacheln, streckten das Vieh, legten das Maßband an, lasen ab, und plötzlich schlug ein hornbebrilltes Mitglied der Vermessungskolonne in Gönnerlaune vor: «Geben wir noch zehn Zentimeter zu, weil sie nicht ganz ausgestreckt ist.» Danach machte sich der unbekümmerte Trupp daran, Heuschrecken und Gottesanbeterinnen in Terrarien mit verdreckten Scheiben zu zählen, und ich ging zu Susanne in die Küche. Ich wünschte so sehr, sie zu kennen. «Es tut mir leid», sagte ich.
«Kann es ruhig!»
Fischstäbchen, Möhren und Erbsen aus der Dose, Kartoffeln – Kinderessen.
«Ich hab mich wie ein Idiot benommen.»
«Schon vergessen!», sagte sie.
Sofort ging es mir wieder gut. Ich verspürte sogar Lust, heute Nacht zu schreiben. Der Roman ging von der Exposition in die Handlung über. Ich mochte meinen Helden. Susanne sah in ihrem kurzen Rock und dem engen, bunt bedruckten T-Shirt, unter dem sich die beherzt zugreifenden Flügel des BHs abzeichneten, großartig aus, kaum zu glauben, dass sie nur drei Jahre jünger ist, wahrscheinlich hat sie nichts mit dem Weiß-Haar-Mann, nur ein netter Arbeitskollege, ein Geschenk war sie, ein unverdientes Geschenk, dessen launisches und unordentliches Wesen ich liebend gerne in Kauf nahm. Ich schloss sie in die Arme, der Flaum über ihrer Oberlippe glänzte golden, im Wohnzimmer schrie ein Pfau. Wir alberten bloß ein wenig herum, es gab ohnehin keine Gelegenheit zum seit Tagen immer notwendiger werdenden Sex. Aber als sie sich wieder dem Herd zuwandte, um unser Abendessen umzurühren, stellte ich mich dicht hinter sie, fasste ihr zwischen die Beine und grunzte brünstig: «Ich gehe über.»
«Das ist nicht witzig», meinte sie.
Ich fand schon. Im Beerdigungsinstitut hatten wir nur selten mit übergegangenen Leichen zu tun, aber kam das vor, stank das Lager noch Tage danach nach Verwesung. Der schlimmste Geruch, den ich je gerochen habe, entströmte einem totalverlöteten Zinksarg, der uns in einem heißen Sommer über den Landweg aus Spanien erreichte. Damit dem Fahrer des ungekühlten Leichenwagens der Zinksarg nicht um die Ohren fliegt, ist am Fußende desselben ein Ventil angebracht, aus dem der Druck entweichen kann. Wohlgemerkt: Nur der Druck kann entweichen, denn als wir den Sarg in der Leichenhalle öffneten (die Angehörigen wollten ihren im Urlaub ertrunkenen Verwandten noch einmal betrachten), erfuhr ich am eigenen Leib, was es heißt, ein grünes Gesicht zu bekommen. Wahrscheinlich hat der Gesetzgeber die barbarische Sitte der häuslichen Aufbahrung nur verboten, um eben diese grünen Gesichter zu vermeiden, die ich bis dahin für eine Erfindung zweit- bis drittklassiger Schundautoren gehalten hatte. Auch die Aufbahrung in Leichenhallen wird nicht gerne gesehen, doch von hundert Fällen enden höchstens drei als verfaulende Schneewittchen hinter der Glasscheibe einer mit betörendem Lilienduft geschwängerten Kapelle.
In unseren gemäßigten Breiten gibt es nur selten Geruchsprobleme: Ein Flies am Boden des Sargs, die sogenannte Matratze, saugt austretende Flüssigkeiten auf und verhindert außerdem, dass den Sargträgern bei der Beerdigung die Leichensuppe über die Schultern rinnt. «Der sparsame Onkel Jörg», Winkler hörte mit wachsender Begeisterung zu, «kleidet die Särge mit einer dicken Lage Altpapier aus. Das erfüllt seinen Zweck genausogut wie eine Matratze und ist weitaus billiger. Deshalb steht neben unseren Mülltonnen eine häufig frequentierte Altpapiertonne für die Nachbarschaft bereit.» Ich grinste Winkler an: «Onkel Jörg hat nichts dagegen, mit einem offenen Geheimnis zu leben.» Dass im Beerdigungsinstitut Gebr. Fahlmann bisweilen doch eine übergegangene Leiche eintrudelte, lag an diversen Medikamenten (Krebs) oder einfach daran, dass der Tote zu lange rumgelegen hatte (etwa wegen einer Obduktion). «Aber das ist nicht unser Bier, sondern das der Verwandten, die sich bei uns oder den schlechtbezahlten Friedhofsangestellten ein letztes Stelldichein mit dem Verstorbenen erkaufen. Heinz sargt im Lager alles mit bewunderungswürdiger Akkuratesse ein, das Leichenhemd ist hinten offen, tideldum, rasch knöpfende Finger, die Decke mit einem eleganten Schwung – El Toro! – hoch bis zur Hüfte gezogen, dann schraubt er den Sarg zu, wir fahren zum Friedhof und überlassen den Inhalt der wohlverdienten Verwesung. Hiermit ist unsere Arbeit getan. Was nun übergeht, betrifft fremde Nasen. Laut Gesetz muss der Tote zwischen 48 bis 96 Stunden nach dem Ableben unter die Erde kommen», Winkler öffnete seine dritte Bierdose, «doch hierbei wird das Wochenende nicht mitgezählt. Stellen wir uns nun einmal vor, der Donnerstag wäre ein Feiertag, am Freitag hätte der Pfarrer keine Zeit – bis Montag ist unsere geduldig wartende Leiche heillos übergegangen, und Gnade dem, der noch einmal am Sarg schnüffeln will!»
So weit, so gut. Solches Zeug will Winkler wissen.
Zurück in die Küche!
«Ich gehe über», flüsterte ich, die rechte Hand zwischen Susannes Beinen. Ihre Schenkel spreizten sich, meine Linke suchte, fand Brust, Susanne ließ mich gewähren, bog dann den Kopf zurück, bis ihre Wange an meiner lag, und flüsterte mir nicht ohne Schadenfreude ins Ohr: «Essen ist fertig!»
«Jens!», rief ich. «Essen!» Jens war eine Sexbremse: Wegen ihm mussten wir jegliche Aktivität auf Nächte verschieben, in denen ich viel lieber schlafen, arbeiten oder was Ordentliches lesen wollte.
«Komme gleich!»
«Du kommst jetzt!», rief Susanne, und Jens kam sofort. Ich war nie versessen darauf, eine Autorität für meinen Sohn darzustellen, bin es nie gewesen. Nur gut, dass er mich nie in Mollingers Eck sah, nichts von meinem Doppelleben wusste, nicht ahnte, wie häufig sein Vater Molli mit einem kräftigen Rülpser herbeizitierte oder Nobbinger dazu beschwatzte, sich einen Furz anzuzünden. Jens durfte nie erfahren, dass wir allabendlich einen fettleibigen Simpel aufzogen, der bei den Stadtwerken arbeitete. Aus schwer ersichtlichem Grund nannten wir ihn Goethe, gaben ihm Schnäpse aus, bis er auf allen Vieren über den Boden kroch und allen Befehlen Folge leistete, die man ihm zurief, während es mir in einem sorgsam verschlossenen Hinterstübchen des Bewusstseins, wo sich prall gefüllte Bücherregale und ein Schreibtisch befanden, vor mir selbst graute. Doch davon wusste Jens nichts. Davon wusste Susanne nichts. Davon wusste Großvater nichts. Und Heinz und Onkel Jörg waren wie ich. «Liest du mir nachher weiter vor?», fragte Jens.
«Vielleicht morgen», sagte ich, denn ich wollte mir nach dem Abendessen noch zwei schnelle Biere mit Achim in Mollingers Eck genehmigen, um mich ein wenig in Schreiblaune zu bringen.
«Versprochen?», fragte Jens.
«Versprochen!», sagte ich.
Susanne sah von ihrem Teller auf.
2Anfang Juni erwachte der Held meines Romans unter den beharrlich zuschlagenden Typen der Schreibmaschine zum Leben. Sogleich tat er nicht mehr alles, was ihm das luftige Gedankenexposé befahl, und nahm sich sogar die Freiheit heraus, Gastspiele in meinen Träumen zu geben, was ich als gutes Zeichen dafür wertete, dass mir sein Charakter gelang. Das Dreckgeschirr auf der Spüle brüllte nach Abwasch, der kann warten, Jens und Susanne hatten das Haus verlassen, endlich Ruhe, drüben gespensterte Onkel Jörg durch seine Wohnung, ein gutgelaunter Zauberer in einer benachbarten Hauswelt. Er winkte mir zu, die Ärmel seines lilafarbenen Bademantels flatterten, ich winkte zurück, Mutters Hochfrisur tauchte ins Blickfeld, unter ihren Pfennigabsätzen knirschte der Schotter, sofort trat Onkel Jörg vom Fenster zurück, seine Hände fuchtelten abwehrend; es gab Differenzen zwischen ihm und Mutter. Übertrieben geschminkt und in einem grellgrünen Kostüm verschwand sie um die Ecke des Beerdigungsinstituts. Ich redete damals wenig mit ihr und konnte kaum glauben, dass sie dieselbe Person war, die mich nach dem Sandmännchen ins Bett gebracht hatte, mir Schlaflieder vorsang, mich zudeckte, mir eine Woche lang meine Lieblingsgerichte kochte, um mich zu trösten, weil ich zum dritten Mal in die Klinik musste, oder mir, letztes Beispiel, die Fingernägel schnitt, bevor eine schnatternde Horde «Tante» Monikas und jovialer «Onkel» Richards zu Besuch kam. Na, kleiner Mann, was macht die Schule? Ein richtiger Junge hat immer ein Messer, ein Stück Schnur und eine Glasmurmel in der Hosentasche. Gibst du mir mal bitte den Süßstoff, Marianne! Immer nur lesen, das ist nicht gut für die Augen. Du musst viel Karotten essen, oder hast du schon einmal, wuha, einen Hasen mit einer, wuhaha, Brille gesehen, wuhahaha? Marianne, dein gedeckter Apfelkuchen ist einfach prima! Ein Zischen, ich drehte mich um, der Wasserkessel hüllte sich in Nebelschwaden, Schritt, Schritt, ich schaltete den Herd ab (erschöpftes Säuseln, weniger Dampf), setzte der Thermoskanne den Filterhut auf, follow the yellow brick road, Schrank auf, Kaffeedose, wo ist der Löffel, sprudelndes Wasser, Susanne, Jasmin, Inge, Koffeinschlamm, ewiger Durst, ewiger Hunger, ewige Angst, bei Tantalos haben die Götter die ewige Geilheit vergessen, erneut füllte ich den Filter und lauschte dem ansteigenden Tropfengesang, der aus dem Inneren der Kanne gluckste – und wenn das Leben nichts wäre, als eine fast endlose Chance, Kaffee zu trinken, schrieb ich ins Notizbuch, hätte es dann nicht mehr und unverrückbareren (dieses Wort ist feige unterschlängelt) Sinn, als man ihm mit Religion, Liebe, Kunst usw. geben könnte?
Beim Niederschreiben dieses Gedankens pfiff ich vor mich hin, heute ist kein Arbeitstag (keine Särge!), kein Unitag (keine Langeweile!), ich nahm die Tasse, schreiben, die Kanne, schreiben, das Notizbuch, schreiben, und stieg, ungefährliches Schwippschwapp, hinauf ins Dachbodenbüro, hinauf zu Thomas Manns Personennamen, hinauf zu meinem Roman. Wieder höre ich das Knarren der Stufen, sehe den Zeitungsstapel auf dem Treppenabsatz, den Zettel Schriftsteller bei der Arbeit an der Tür, peinlich, sollte ich abhängen, ach, ist doch egal, sieht sowieso keiner hier oben, winselnd schwingt die Tür in den Raum, wo eine vom trüben Auge der Dachluke beleuchtete Lichtung den anrückenden Sperrmüllschwadronen wacker standhält. Holzkisten versuchen die freie Fläche zu erobern, Wäschekörbe machen sich zum Entern bereit, ich erinnere mich, erinnere mich, ich erinnere mich gut. Vom Standardinventar des typischen Hollywoodspeichers (die einbeinige Schneiderpuppe, die defekte Standuhr, das Schaukelpferd aus der Kindheit des Helden, der Schrankkoffer mit den Memoiren Jack the Rippers) ist hier oben lediglich die defekte Standuhr vertreten, ein glotzäugiger Zyklop mit erstarrten Hoden.
In die Knie gesackte Pappkartons kriechen dem Lichtfleck unter der Dachluke entgegen, eine Garnitur verdreckter Gartenmöbel türmt sich an der Nordwand, ich lasse die Ostwand und die Kleiderschränke hinter mir, denen beim Öffnen ein capartähnlicher Duft entströmt, eine verhaltene Mottenkugelnuance im modrigen Odeur meines Büros, hier arbeitet einer, dessen Namen in Staub geschrieben wurde. Nach wenigen Metern mündet der Pfad in eine gerodete Fläche, die sich inmitten des Gerümpeldschungels auftut. Hier lebt mein Schreibtisch, Staub, prustendes Niesen, ich stoße das gestauchte Rechteck der Dachluke auf: Frischluft! An der schiefen Wand über dem Schreibtisch hängen die Porträts meiner literarischen Heroen. Misstrauisch beobachten sie, mit welch zuversichtlicher Entschlossenheit ich heute Tasse und Thermoskanne auf den Tisch stelle, Platz nehme und das Notizbuch aus der Brusttasche des Flanellhemds ziehe. Gute Notiz, das eben mit dem Kaffee, kann man eventuell einarbeiten, morgens, wenn er wach wird, vielleicht einen Kaffee mit den anderen. Ich schenke Kaffee ein, lege das Notizbuch neben einen zum Zigarettenkippenigel metamorphosierten Aschenbecher, der bewegliche Schachtelhalmarm der vorzeitlichen Lampe beugt sich in lüsterner Neugierde über das Innenleben der soeben entkleideten Schreibmaschine, links von mir liegen die fertigen Seiten des Romans auf einem leeren Bierkasten, der sich vergebens (natürlich werden wir ihn beim Umzug vergessen) nach Pfand und dem geselligen Gerassel der Leergutannahme sehnt, schreiben, ich muss schreiben, ich muss jetzt endlich schreiben!
Wenige Minuten später legte ich die Arme auf den Tisch und den leeren Kopf darauf. Unten in der Küche war mir alles so leicht erschienen. Als bräuchte ich nur, tripptrapp, hinaufzugehen, Kaffee zu trinken (prompt dampft es aus der erinnerten Tasse), und wäre dann in der Lage, eine Seite nach der anderen runterzureißen, druckreife Seiten, perfekte Seiten, hundert Seiten, anspielungsreich, stilsicher, der Papierstapel wächst, dreihundert Seiten, und wächst, achthundert Seiten, neunhundert, und wächst weiter ins Unermessliche, Büchnerpreis, Spiegelinterview, und im Blitzlichttaumel würde ich allen danken. Danke, lieber Verleger! Danke, lieber Lektor! Danke, lieber Leser! Danke, Georg Fahlmann! Danke! Danke! Danke!
Als ich noch mit der Adler Tippa 1 schrieb (sie verstaubt im wenig erforschten Süden des Gerümpel-Dschungels), pflegte ich willkürliche Buchstabenkombinationen zu tippen, um mich in Schreiblaune zu bringen. Mit heftigem Tastendruck weckte ich die Typenhebel und ließ sie aus dem Korb schnellen. Ungelenk schoss das Q um die Ecke, knallte hart und entschieden aufs Papier. Das Z und das H schlugen brutaler zu, sie waren die Preisboxer unter den Typen, und wehe dem, der es wagte, ihre Freundinnen schief anzusehen! Die 1 kratzte so haarscharf die Kurve, dass man froh war, wenn dieser todesmutige Rennfahrer lebendig das Ziel erreichte. Perkkk!, stanzte das verschlagene i ein Loch ins Papier, und ein Druck auf die Leertaste zu Füßen der durchbrochenen Buchstabentreppe schob die Walze nach Klingstadt. Doch nun (heute schreibe ich mit der Hand) saß ich vor einer moderneren, aber nicht weniger störrischen Schreibmaschine. Nein, keine Personennamen. Heute nicht! Und du brauchst gar nicht erst mit dem Schreiben anzufangen! Dein Held schläft noch. Oder siehst du irgendwelche Bilder vor deinem inneren Auge? Nein. Na, also! Und hörst du irgendwelche Stimmen? Nein. Na, bitte! Und was soll ich jetzt tun? Dir bleiben nicht viele Möglichkeiten, Georg! Ich klappte das Notizbuch auf, wir können es ja später noch einmal versuchen, viel später, du schreibst sowieso am besten nachts, prüfte einige als Motti verwertbare Zitate, down these mean streets a man must go, und puzzelte wie so oft, wenn meine untreue Muse fremden Literaten zu Diensten war, an meiner persönlichen, kläglich einfältigen Philosophie herum, durch deren Verschriftung ich Ordnung in mein unsortiertes Leben zu bringen hoffte: auf den ersten Blick eine Bibliothek, auf den zweiten ein Dachboden mit einer Schreibmaschine, auf den dritten ein dem Verfall preisgegebener Palast mit Jens und Susanne, auf den vierten eine Vorstadtkneipe mit Achim, auf den fünften ein Wohnzimmer mit Winkler, auf den sechsten ein Transit mit Heinz usw. Dies alles jedoch nur in der Zeit vor der Abreise.
Noch war ich nicht in Paris. Noch wünschte ich nicht, mein Leben wäre für alle Zeiten ‹unsortiert› geblieben. Noch arbeitete ich fast täglich an meinem Roman. Abermals (zurück!) taucht das schwingende Lot (zurück, zurück!) in den Zeitsee, Mnemosyne hat heute leichtes Spiel mit mir und versetzt mich wieder auf den Dachboden. Ich halte etwas in der Hand, es fühlt sich glatt und warm an, ein Buch, ein kleines Buch. Ich steckte den Notizblock in die Brusttasche und betrachtete die Schreibmaschine. Vergiss es! Kurzfristig erwog ich, wieder ins Bett zu gehen, das Gesicht in Susannes duftendem Kissen zu vergraben, ein verlockender, ein gefährlicher Gedanke, denn ich fand es seit einigen Wochen immer beschämender, von Jens geweckt zu werden, wenn er aus der Schule nach Hause kam. Was ist dein Vater von Beruf? – Keine Ahnung, der liegt den ganzen Tag im Bett und schläft. Ein Knattern näherte sich, schwoll im Hof an, flatterte zwischen den Hauswänden wie ein aufgescheuchter Lärmvogel, beruhigte sich, die Vespa stotterte noch einige Verwünschungen, dann blieb ihr mit einem heiseren Röcheln die Luft weg. Leisere Geräusche folgten: Helmausziehen, Vespa an die Wand lehnen, Nase hochziehen, Schleim in die Mundhöhle husten, herzhaft ausspucken.
«Alte Sau!», rief ich zur gekippten Dachluke hin.
«Selber Sau!», schallte es draußen. Schritte, Heinz öffnete die Tür des Büros (das Riffelglas klirrte), Tach, Jörg (Heinz), mach zu, es zieht (Onkel Jörg), und mit dem Geräusch plötzlichen Lufteinsaugens glitt die Tür über den Teppich des Beerdigungsinstituts, klackte ins Schloss. Die Stille, die sich nun wieder über das Haus stülpte, störten lediglich die monotonen Versfragmente der Vogelbarden, denen in ihrer geistlosen Balzerei der alles verbindende Kehrreim entfallen war. Wahrscheinlich trinkt Heinz jetzt ein Frühstücksbier mit Onkel Jörg. Die beiden mussten sich nicht mit fliehenden Worten rumplagen, mit fehlendem Sinn, mit verpatztem Rhythmus, mit Jasmin. Flasche auf, zum Wohl, und weg damit! Ex oder Arschloch! Nöte mit weißbleibenden Seiten waren ihnen so fremd wie Mülleimer voller Absagen. Von der Verflüssigung des Kosmos, schrieb ich ins Notizbuch, strich es durch, schrieb: Dobitris & Flabitris, strich auch das.
Vor einigen Tagen hatte mich Heinz nach einem missglückten Bäckereibesuch darüber aufgeklärt, was es mit den Dobitris und Flabitris auf sich hat. «Und was bist du?», fragte ich. – «Sonderfall», strahlte Heinz. «Ich bin ein Bitri!» – «Ich auch», lachte ich. «Wenns die richtige Temperatur hat, eiskalt musses sein, ists mir scheißegal, ob man mein Bier zapft, in eine Dose eingeschweißt oder mit grünem Glas ummantelt hat.» – «Und was müssen Bitris jetzt tun?», rief Heinz. Er brachte den Blinker mit einem lässigen Handkantenschlag zum Ticken, bremste, der zupackende Gurt drückte mir die Luft aus den Lungen und der rechte Vorderreifen des gleichermaßen verdutzten Transits erklomm den Bordstein vor Sonjas Hähnchen Grill. «Hier kommen die Dobitris!» Heinz zog die Handbremse, sprang aus dem Wagen, grölte Frechheiten über die Straße, die auf das Konto einer jungen Mutter im Minirock gingen, dann öffnete ein Schulterstoß die Glastür der Imbissbude. «Zwei Bier für die Männer, Schätzchen, und ne weiße Curry für mich!» Heinz sah mich an, ich nickte, er korrigierte: «Zwei weiße Curry für die Männer!» Außer dem alten Hanjob, der am Tresen klebte, waren wir die einzigen Gäste. «Halt ja die Raffel», raunzte Heinz im Vorbeigehen, «sonst nehmen wir dich nachher mit!» Hanjob lachte wie ein sich aufbäumendes Pferd, fuchtelte in der Luft herum, rief etwas Unverständliches, wiederholte es mehrfach (sang ein Gedicht?) und gab erst Ruhe, als ihm Sonja (verhärmtes Frätzchen, schiefer Mund, Papageienlachen) ein kleines, mit Mumienbinden aus Packpapier umwickeltes Fläschchen reichte. Danach verkündete sie strahlend: «Ich mach euch heute Extralange!» Hanjob wieherte und biss sich erschrocken auf die Unterlippe, als ihm Heinz mit dem gebogenen Zeigefinger drohte. «Hättst wohl auch gern nen Extralangen?» Hanjob begann vor Angst zu zittern, und Heinz murmelte mit einem raschen Blick in meine Richtung: «Bestell dir nochn Underberg, Hanjob! Geht auf mich.» Ich legte die Zigarettenschachtel neben einen verbogenen Plastikteller, den verkrustete Brandwunden als Aschenbecher auswiesen – und da sah ich mein grinsendes Spiegelbild in der Glastür. Richtig. Ich grinste. Ich war froh. Stellen Sie sich das bitteschön vor! Nichtsahnend blickt der Unglückliche in den Spiegel – und sieht sich darin grinsen!
Damals war ich so viele Menschen, aber nur als Heinz’ Begleiter (und manchmal auch als angehender Quartalssäufer in Mollingers Eck) besaß ich ein derart unbekümmertes Naturell, dass es mich abends, wenn ich die Erlebnisse des Tages im Kopfkino der Schlaflosigkeit Revue passieren ließ, mit Staunen erfüllte. Hammett hätte alles distanziert beobachtet; Chandler hätte Sonjas Hähnchen Grill gar nicht erst betreten; und ernstzunehmende Schriftsteller wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es sowas wie Sonjas Hähnchen Grill überhaupt gibt; und ich, nun, ich benahm mich hier etwa so, wie R. S. Prather schreibt: Ein dümmliches Grinsen im Gesicht stand ich am brusthohen Plastiktisch und wartete auf meine Currywurst. In Sonjas Hähnchen Grill gab es noch die gute, alte, richtige Currywurst, nicht diesen Beschiss, den sie einem mittlerweile fast überall anzudrehen versuchen. Die aus der Schnippelmaschine gepurzelten Wurststücke wurden mit Ketchupgirlanden garniert, dann ging darauf ein Schwefelregen aus dem Currystreuer nieder, und schließlich flutete man die leckere Sauerei mit der seit Tagen munter vor sich hinblubbernden Schaschliksauce. Dazu gab es einen zähen Doppelweck zum Tunken. «Und jetzt zu euren Extralangen!» Sonja legte zwei tiefgefrorene Weißwürste auf den Rost, Heinz drängte sich hinter ihr vorbei, kniff ihr in den knochigen Arsch (erfreutes Quietschen), fummelte am Kühlschrank herum und kam hüftschwingend hinter der Theke hervor, zwei Halbliterdosen schwenkend wie Rumbakugeln. Heinz ist einer dieser Menschen, heißt es im Notizbuch, die ins Leben einsteigen wie in einen Linienbus. Unbeirrt fährt der Bus durch die Stadt, hält an Bierhallen, an Kneipen, an Fitnessstudios, an Würstchenbuden – und schließlich am Friedhof. Heinz hatte nie eine ordentliche Schule besucht, er floh vor seiner Familie, er soff sich das Hirn weg, und ihm würde die wunderbarste aller Fluchten, das Lesen, sein ganzes Leben lang versagt bleiben. Wahrscheinlich hat er noch nicht einmal Die Bienen aus dem Monsterfilm gelesen, und da ich die Bienen jetzt ins Spiel gebracht habe, muss ich, aber das kennen Sie ja mittlerweile von mir, weit ausholen, aber das mache ich nur, weil es wichtig ist, zwo, drei, weit ausholen mit dem Gedankenkescher, vier und hep! – ein schneller Kescherzug durch die Zeit und los!
An meinem dreißigsten Geburtstag (Susanne telefonierte damals noch nicht täglich mit dem Weiß-Haar-Mann, sondern erzählte mir, was sie beim Einkaufen erlebt hatte) saß ich mit Heinz in Onkel Jörgs Büro. Wir tranken Himbeerlikör, weil sonst nichts da war, und unterhielten uns über seine Vergangenheit als Powerlifter: Urkunden, Rekorde und persönliche Bestleistungen. «Kniebeuge und Kreuzheben, da war ich über 200 (dohwarisch iwwerzweihunnerd). Und auf der Flachbank hab ich 177,5 Kilo gedrückt. Ich hätt auch die 180 gepackt, aber dann kam mir die Scheißzerrung dazwischen. Musste mir immer Eisbeutel auf die Schulter legen, einreiben und so Zeugs, und dann hab ich irgendwie den Anschluss verpasst. Na ja, vielleicht trainier ich irgendwann wieder. Auf der Bank sind bestimmt noch 125 Kilo drin.» – «Was würd ich denn so packen?», fragte ich. Heinz drückte die Zigarette aus, Kopfwiegen, Genickkratzen. «Vielleicht 60 Kilo.» Zum ersten Mal sah ich bewusst die Krähenfüße in seinen Augenwinkeln. Und wie grau sein Haar geworden war! Heinz steckte sich eine Gauloises an. «60 Kilo ist vielleicht ein bisschen großzügig geschätzt, aber du bist ja ziemlich sehnig vom Sargtragen, vielleicht packst du ja die 50 Kilo (paggschdujoh diefuffzischkielo), aber», tiefes Luftholen, «du hast ja heute Geburtstag (awwerdu haschdjohheudgeburdsdah)!» Er legte ein silbern glänzendes Taschenbuch auf den Tisch und ließ es zu mir rüberschlittern:
Der berühmte Privatdetektiv
SHELL SCOTT
Kriminal-Bestseller von R. S. Prather
DIE BIENEN AUS DEM MONSTERFILM
Heiser: «Du liest doch gern.» Auch heiser: «Danke! Das les ich direkt heute Abend!» – «Was ist denn das?», fragte Susanne, als ich nach Hause kam. – «Hat mir Heinz zum Geburtstag geschenkt.» – »Pack das bloß weg, bevor Jens es in die Finger bekommt!» – «Kleine Kostprobe gefällig?»
Sie rannte an den riesigen Seetang-Gewächsen vorbei, sprang über fleischfressende Pflanzen und raste vor der kochendheißen Lava davon. Sie trug ein Negligé, das die Farbe dünnen Nebels hatte, und es rutschte ständig ihre Schenkel hoch, während sie lief, und ihre bloßen Beine leuchteten weiß im Sonnenlicht. Sie rannte sehr schnell, aber die Riesenaustern holten trotzdem auf.
Klack-klack machten die Austern. (…)
Ja, es sah so aus, als ob die Austern sie einholen würden. Sie war zwar der kochenden Lava entkommen, aber jetzt stand sie am Klippenrand, vor ihr lag das schreckliche Meer des Feuers. Sie saß in der Falle.
«Sowas liest man bestimmt in Spitzbergen!» – «Du machst das Buch sofort wieder zu!», sagte Susanne. Ich protestierte: «Aber jetzt gehts doch erst richtig los …»
Cherry schrie – das machte sie sehr schön.
Und hinter ihr kamen die Riesenaustern näher.
Cherry schrie wieder, jetzt eine halbe Oktave höher.
Klack-klack. «Iiiihhh.» Klack-klack. «Iiiiiihhhhh.» Klack-klack-klack! «Iiii aaaahhhhh!»
»Der Esel ist doch klasse!» – »Ganz große Klasse!», seufzte Susanne. Zwei Tage später, als ich wieder mit Heinz unterwegs war, wollte er natürlich wissen, ob es gut gewesen sei. «Was?», fragte ich, um Zeit zu gewinnen. Er bot mir eine Gauloises an. Dankend lehnte ich ab. Klack-klack machten die Austern. Schwungvoll bog er in die Von-Boka-Straße. Cherry schrie – das machte sie sehr schön. Er warf den dritten Gang rein. Leise: «Buch. Das Buch. War das Buch gut?» – «Welches Buch?» – «Das Krimibuch, das ich dir», Räuspern, «zum Geburtstag, du weißt schon … vorgestern (vohrgieschder) … das Buch halt.» – «Ahhh, das Buch!» Ich mimte einen Anfall spontanen Erinnerns, aber die Riesenaustern holten trotzdem auf. «Das war Klasse.» Klack-klack. «Spannend.» Iiii aaaahhhhh! «Habs in einem Rutsch durchgelesen. Ich mag so Privatdetektivkram. War ne verdammt gute Idee von dir!»
Und Heinz saß glücklich hinter dem Steuer im Kommunionsanzug, saß da wie ein Junge, der seiner Mutter heimlich einen Kuchen zum Muttertag gebacken hat, aber weil ich leider kein guter Schauspieler bin, kein überzeugender Lügner, schien er doch was gemerkt zu haben, denn an meinem nächsten Geburtstag kehrte er wieder zu seinem Standardgeschenk (Flasche Cognac) zurück. Die Bienen aus dem Monsterfilm erhielten jedoch einen Ehrenplatz im Bücherregal, und oft erklärte ich Susanne, sie (die Bienen) wären das allerschönste Geschenk, das ich in meinem Leben bekommen hätte. Heinz fehlt mir, krakelige Schrift, unter meinen Schuhsohlen rumpelt die Métro und verführt die Espressotasse zu einem Scheppertänzchen auf dem Tellerchen, vielleicht (zurück, zurück!) sollte ich meinen Helden von Riesenaustern träumen lassen. Quatsch, wenn ich anfange zu klauen, bin ich keinen Deut besser als Winkler! Ich deckte die Schreibmaschine ab, kann Traumszenen in Büchern ohnehin nicht ausstehen, eine Wolke, die wie ein aufgequollener Wattehase aussah, schwamm durch das Himmelsrechteck in der schrägen Wand, unten klingelte das Telefon, hör auf zu arbeiten, klingelte es erlösend, hör auf zu arbeiten, mach heute Nacht weiter, hör auf, leg dich schlafen, gibs auf, aber flitz jetzt erst mal runter und heb meinen Hörer ab, du Depp! Ich hoffte natürlich, dass Inge es so hartnäckig läuten ließ. Wieso ruft sie mich erst jetzt wieder an? Aber allein, die Tatsache, dass sie wieder anruft …
Doch es war Struebing, der hilflose Buchhändler.
«Spreche ich mit Herrn Fahlmann?»
«Am Apparat!»
«Ihr Großvater ist wieder da.»
«Aha», sagte ich.
«So geht das nicht weiter!»
«So», sagte ich.
«Er kann doch nicht unentwegt … du liebe Güte!»
«Mein Großvater ist ein erwachsener Mann. Reden Sie mit ihm!»
«Würde ich ja gerne, aber er hört mir nicht zu!»
«Herr Struebing. Eine Frage. Was habe ich mit der Sache zu tun? Ich kann meinen Großvater nicht an die Leine legen.»
«So etwas würde ich nie von Ihnen verlangen. Gott bewahre! Aber es geht nicht an, dass er …»
«Geben Sie ihn mir! Ich rede mit ihm.»
Ich setzte mich auf den Boden, den Rücken am Schuhschrank, das Telefon auf dem Schoß. Om wischte durch die Katzentür, sah mich, erstarrte eine Schrecksekunde lang, gähnte dann gelangweilt, warf sich auf den Fußabstreifer und reinigte eine affektiert abgespreizte Vorderpfote. Bisweilen hielt er inne, um mich anzustaunen; ich staunte schonungslos zurück.
«Georg?», fragte der Telefonhörer.
«Wer sonst?»
«Hat er dich schon wieder angerufen?»
«Natürlich.»
«Ich habe eben dein Buch verkauft!»
«Nett von dir. Danke!»
«Na ja, man muss was tun. Wie gehts deinem Roman?»
«Mittelprächtig. Er will nicht so, wie ich es will.»
«Du solltest mal eine Schreibpause einlegen. Das tut dir und damit dem Text bestimmt gut … Moment!» In den Raum hinein: «Ich helfe Ihnen sofort!» Zu mir: «Hast du heute Nachmittag Zeit? Ja? Sechzehn Uhr? Gut, dann bis später! Tschüss, Georg!»