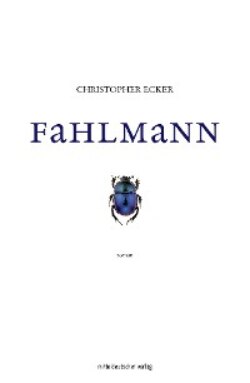Читать книгу Fahlmann - Christopher Ecker - Страница 6
Оглавление1Mein Vater starb, als er sich nach einer Schachtel Zigaretten bückte. Genauer gesagt, bückte er sich nach einer zerknautschten Schachtel Gauloises ohne Filter, und da Heinz der einzige von uns war, der filterlose Gauloises rauchte, kam ich nicht umhin, mir vorzustellen, wie er am Abend des Vortags den Helm aufgesetzt hatte, sich nach getaner Arbeit eine Zigarette anzündete, die Schachtel achtlos fallen ließ und auf seiner Vespa davon knatterte. Ich gebe ihm jedoch keine Schuld am Tod meines Vaters. Heinz hat eine leere Zigarettenschachtel weggeworfen – nichts weiter!
Mein Vater war ein Pedant: Scharfe Bügelfalten, korrekte Manieren, glatter, pomadisierter Scheitel, Rabattmarken, der Schnurrbart dicht über der nervös zuckenden Oberlippe gestutzt. Er war jemand, der aus heiterem Himmel beschließen konnte, die Gewürze alphabetisch zu ordnen. Ich erinnere mich gut an die erbitterten Diskussionen, die der Umsetzung dieses Plans vorausgingen. Vater plädierte nämlich dafür, Jodsalz unter J einzusortieren und Chilischoten unter C, was ich (ich war damals neun oder zehn Jahre alt) für ausgemachten Blödsinn hielt. Jodsalz müsse man unter S wie Salz einordnen, argumentierte ich schlüssig, und Chilischoten gehörten zu P wie Pfeffer.
«Nein, nein, nein!», sagte Vater leise und zupfte sich einen unsichtbaren Fussel vom Jackett.
«Oberbegriffe, Armin!», sagte Mutter und ließ das Buch sinken. «Es geht um Oberbegriffe. Der Junge hat vollkommen recht!»
Nach ihrer überraschenden Einmischung stand es 2 : 1 gegen Vater, doch er gab nicht auf. Er gab nie auf, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. «Nehmen wir mal an, ihr sucht das Jodsalz. Sucht ihr es dann unter S? Hieße das Jodsalz Sodsalz, müsste ich euch recht geben. Kein Problem. Aber Jodsalz heißt nun mal Jodsalz. Dafür kann ich nichts!» Sein Seufzer zollte den ungeheuren Leiden all derer Tribut, die sich in großherziger Selbstaufopferung bemühen, unsere unvollkommene Welt ein wenig vollkommener und übersichtlicher zu machen. «Wieso wollt ihr mich nicht verstehen? Wenn man Chilischoten sucht, sieht man dann bei den P-Gewürzen nach oder», seine Stimme wechselte die Tonlage und drang in listige Gefilde vor, «nicht etwa bei den C-Gewürzen?»
«Aber wir wissen doch, wo alles steht», warf ich ein.
«Nein, mein Junge», sagte Vater im Tonfall resignierten Tadels, den Blick auf die Spitzen seiner Lackschuhe gesenkt, «so leicht dürfen wir es uns nie machen.»
Vater hat es sich im Leben nie leicht gemacht. Bei Spaziergängen las er Bonbonpapierchen und Zigarettenkippen auf, und sah er irgendwo die Ankündigung einer Veranstaltung, die bereits stattgefunden hatte, riss er den Anschlag mit einem Ausdruck ungläubigen Zorns von der Plakatwand. Als er starb, war ich erwachsen und stand am Fenster meiner eigenen Küche, wo die Gewürze weder sortiert waren noch sich überhaupt auf einem Gewürzbord befanden. Ich hielt eine große Tasse Kaffee in der Hand, pustete hin und wieder auf die schwarz spiegelnde Oberfläche und war zu faul, mich mit Susanne zu unterhalten, die hinter mir mit der Zeitung raschelte. Ich sah hinab in den Hof. Genauer. Ich muss mich genauer erinnern, auch wenn es schwer fällt. Meine Konzentration ist heute nicht die beste. Unsere Küche befand sich im ersten Stock, eine Etage und mehrere Jahre über den Jodsalz- und Chilischotendiskussionen meiner Kindheit. Meine Eltern bewohnten zwar noch immer das Erdgeschoss, aber ich war inzwischen mit meiner eigenen dreiköpfigen Familie, deren jüngstes Mitglied sich um diese Uhrzeit im Kindergarten aufhielt, in den ersten Stock gezogen, den Vater, bis ich – übrigens keine Spur reumütig – in mein Elternhaus zurückgekehrt war, an die Familie Bahlow vermietet hatte. Das klingt verwirrend. Mehr dazu später, wenn ich es nicht vergesse.
Am Küchenfenster bot sich mir die Aussicht auf die schmutzig-graue Ostwand des Gebäudes, das in einer Entfernung von gut zehn Metern den Hof begrenzte und die Einnahmequelle unserer Familie beherbergte. Das schwarze Schild mit den Goldlettern war allerdings nur von der Straße aus zu sehen: Es überspannte zwei Schaufensterscheiben, hinter denen schwere, bodenlange Vorhänge den Passanten die Sicht ins Gebäudeinnere verwehrten. Die halbherzige Dekoration (einige staubige Urnen, einige staubige Grablaternen) verwies auf die Art des Gewerbes, das hier ausgeübt wurde. Beerdigungsinstitut Gebr. Fahlmann, stand auf dem Schild, und darunter: Erd-, Feuer- und Seebestattungen. Vater hatte das Unternehmen in den späten fünfziger Jahren gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder aufgebaut. Vater kümmerte sich um die Verwaltung, und Onkel Jörg, ein überzeugter Junggeselle, der nicht so zart besaitet war wie sein Bruder, fuhr den Leichenwagen, sargte ein und widmete sich dem kniffligen Handwerk des Präparierens. Bei all diesen Tätigkeiten ging ihm Heinz zur Hand, der ein noch weitaus vierschrötigeres Naturell als mein Onkel besaß.
Heute erscheint es mir mehr als nur merkwürdig, dass mein empfindlicher Vater auf die Idee gekommen war, Bestattungsunternehmer zu werden. Bei einem Sonntagsspaziergang hatte er sich einmal heftig (fast hätte ich geschrieben: orgiastisch) übergeben, weil er beinahe in einen feucht schillernden Haufen Hundescheiße getreten wäre. «Du bist nicht mal reingetreten!» Mutter konnte es kaum fassen. «Stell dich nicht so an! Wärst du reingetreten …» – «Bitte, Marianne, sei still! Hack nicht länger drauf rum!» Vater lockerte den Kragen, löste den Knoten der Krawatte und wischte sich Schweißperlen von der Oberlippe. «Du machst es nur noch schlimmer! Oh, ich darf gar nicht dran denken, sonst wird mir wieder schlecht.» Diese Begebenheit hat mich vermutlich so stark beeindruckt, weil sich hier das Vaterding in den tadellosen Anzügen, das als ständigen Vorwurf gute Manieren zur Schau stellte, kurzfristig in einen richtigen Menschen verwandelt hatte. Allein die Tatsache, dass sich mein Vater wie ein normaler Mensch übergab und wie alle übrigen Menschen einen – wenn auch übertriebenen – Ekel vor gewissen Dingen empfand, ließ damals in mir eine zarte Hoffnung keimen. Aber in aller Öffentlichkeit auf den Gehweg zu kotzen und seinen Sohn vor dem Zubettgehen in den Arm zu nehmen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Doch ich schweife ab. Vom Fenster aus sah ich also nicht das der Straße zugewandte Ladenschild, sondern nur die auf den Hof hinausgehende Eingangstür des Beerdigungsinstituts, auf deren getöntem Riffelglas ein ehemals weißes Papprechteck die Geschäftszeiten verriet. Rechts neben der Tür starrte ein schwarz verhängtes Fenster ins Leere. An das Institut schloss sich das lang gestreckte Lager an, flaches Dach, getönte Scheiben, und daran fügte sich wiederum die den Hof im Norden begrenzende Garage wie der obere Balken eines F’s.
Unser eigenes Haus war demzufolge, um dieses Bild beizubehalten, ein Punkt, der das bauchbalkenlose, aus einem schmutzig-grauen Beerdigungsinstitut, einem geduckten Lager und einer breiten Garage bestehende F in eine Abkürzung verwandelte. F kürzte natürlich den Namen «Fahlmann» ab, und dass ich diese Beobachtung bereits als Kind gemacht habe, führe ich heute allein auf mein für Anfangsbuchstaben geschultes Auge der Gewürzbordphase zurück. Als mein Vater starb, stand ich also am Küchenfenster, pustete auf den Kaffee, der noch zu heiß war, um einen ersten Schluck zu wagen, und sah, wie Onkel Jörg das Büro verließ. Schwarz gekleidet und erstaunlich früh – er war wie ich ein Spätaufsteher – ging er zum Leichenwagen, der mit der Schnauze das geschlossene Garagentor beschnupperte. Onkel Jörg brüstete sich häufig damit, der einzige Bestattungsunternehmer der Stadt zu sein, der einen Ford Transit fuhr. «Der ideale Leichenwagen! Passen zwei Särge nebeneinander rein. Wir können die ganze Familie mitnehmen, wenn wir die Kinder zusammenklappen und zu den Eltern in die Särge packen», pflegte er zu scherzen, woraufhin Vaters Gesicht einen leichten Grünstich annahm. Für ihn war das Geschäft mit dem Tod eine ernste, aber, und darauf legte er größten Wert, keine wohltätige Sache. «Wir verdienen den Lebensunterhalt mit dem Ableben unserer Mitmenschen. Aber müssen wir deshalb unsere Dienste verschenken?» Vater ließ die Frage eine Weile im Raum schweben, ehe er sie selbst beantwortete, obwohl es inzwischen keinen gab, der die Antwort nicht auswendig wusste: «Nein und nochmals nein! So schlimm der Tod auch sein mag, so traurig für die Angehörigen, so furchtbar, so schrecklich», seine Stimme schwoll an, als wollte er ein Meer teilen, «so wenig haben wir das Recht, mildtätig zu sein. Und warum nicht? Weil wir im Gegensatz zu den Verstorbenen weiterleben müssen. Und zum Weiterleben braucht man Geld!»
Selbst durch das geschlossene Fenster hörte ich den Schotter unter Onkel Jörgs Schuhsohlen knirschen; hinter mir schenkte Susanne sich geräuschvoll Kaffee nach; unten sperrte Onkel Jörg die Fahrertür des Transits auf und stieg ein, wobei er wahrscheinlich herzzerreißend stöhnte. Tck, tck, der Schlüssel wurde im Zündschloss gedreht, tck-ahrrrm!, ein Rauchwölkchen kroch aus dem Auspuff, Onkel Jörg stieß aber nicht zurück, sondern begann im Wageninneren mit irgendwelchen Papieren und Schachteln zu hantieren. Und genau in diesem Augenblick kommt Vater um die Ecke des Hauses, das Haar so korrekt gescheitelt, dass ich von hier oben die weiße Linie Kopfhaut zwischen den dunkelbraun gefärbten Haarhälften sehen kann. Zielstrebig steuert er quer über den Hof auf die Bürotür zu, ein Mensch, der es eilig hat. Vaters Bewegungen wirkten immer eine Spur zu hektisch; nur wenn er etwas erklärte, mich tadelte oder seine geliebten Nachrichten schaute, wurde er ruhig. Plötzlich bleibt er kerzengerade stehen, bückt sich in einer schwungvollen, federnden Bewegung, und genau in diesem Moment, als er sich hinter dem Wagen bückt, nestelt Onkel Jörg mit der rechten Hand am Rückspiegel herum. Ich sehe von meinem schräg über dem Transit gelegenen Beobachtungsposten, wie Onkel Jörg sodann die Hand auf den Schaltknüppel sinken lässt und mit erhobenem Kopf in den neu justierten Rückspiegel blickt, der ihm, wie ich in alptraumhafter Gewissheit begreife, einen leeren Hof zeigt. Und in der Tat entschuldigte sich Onkel Jörg später: «Ich dachte wirklich, es wäre frei.» Ich stehe gelähmt am Fenster, mein Vater hat sich nach etwas gebückt, Onkel Jörg blickt in den Spiegel, und mit irrwitziger Geschwindigkeit stößt der Transit zurück.
Die Reifen schleudern Schotter in die Höhe, ein dumpfer Aufprall, und Vater rudert mit Armen und Beinen durch die Luft, als wollte er zum Mond schwimmen, der als bleiche Muschel am Morgenhimmel klebt. Onkel Jörg erstarrt hinterm Lenkrad, legt den ersten Gang rein, das Getriebe knirscht, erneut wird Gas gegeben, die Hinterreifen entfernen sich von Vaters verkrümmtem Körper, der Motor wird abgewürgt, Onkel Jörg schaut ausdruckslos in den Rückspiegel. Dann steigt er aus, schlägt die Fahrertür zu und verschwindet hinter den schwarzen Scheiben des Hecks.
«Mein Vater ist tot», sage ich tonlos zur Fensterscheibe.
Hinter mir lacht Susanne. Unten taumelt Onkel Jörg hinter dem Heck des Transits hervor, sieht die Gestalt am Boden. Seine Miene ist steinern. Sein Brustkorb hebt und senkt sich. Bisweilen fährt er sich mit der Hand über die Stirn. Leise und eindringlich sage ich: «Das stimmt wirklich.» Hinter mir knistert es (Susanne legt die Zeitung beiseite), Stuhlbeine scharren über den Küchenfußboden (Susanne steht auf), unten beugt sich Onkel Jörg über seinen Bruder, greift dem schlaffen Körper unter die Achseln, zerrt ihn auf den Transit zu. Vaters Absätze ziehen Furchen in den Schotter.
«Was geht denn da ab?», flüstert Susanne neben mir.
Onkel Jörg sieht sich um. Sein Blick zuckt nach links, sein Blick zuckt nach rechts, sein Blick hebt sich, bleibt am Küchenfenster kleben.
«Ich weiß es nicht», sage ich, «aber jetzt hat er uns entdeckt.»
Wir sehen Onkel Jörg an und er sieht uns an, lange und ausdruckslos, ehe er den Körper meines Vaters behutsam auf den Boden sacken lässt. «Halt mal bitte!» Ich drücke Susanne die Tasse in die Hand, öffne das Fenster und rufe Onkel Jörg zu: «Ich komme zu dir runter.»
Gott sei dank, dachte ich auf dem Weg nach unten, ist Mutter in der Schule. Und: Gott sei dank ist Jens im Kindergarten. Mehr dachte ich nicht. Weder empfand ich Trauer noch ein Gefühl der Leere oder des Verlustes (das kam erst Jahre später und hatte andere Gründe) – und schon knirschten meine Sohlen auf dem Schotter des Hofs. Onkel Jörg lehnte am Leichenwagen, der schwarze Lack ließ ihn blass aussehen. Beim Näherkommen verzerrte sich meine Gestalt in der spiegelnden Heckklappe: Erst stauchte es mich zum Zwerg zusammen, um mich gleich darauf wieder auseinander zu ziehen. Ich sah Onkel Jörg fragend an; dieser bewegte den Kopf verneinend hin und her und wich dabei meinem Blick aus.
«Der Krankenwagen kommt gleich!», rief Susanne aus dem Küchenfenster. Der Putz unseres Hauses war, wie mir plötzlich auffiel, erheblich schmutziger als der des Beerdigungsinstituts. Außerdem (auch dies nahm ich mit einer Klarheit wahr, als sähe ich es zum ersten Mal) stand unser Haus eine Spur schiefer. Wegen einer Grubensenkung neigte es sich leicht zur Straße hin, als verbeugte es sich höflich vor den Passanten. Es wurde einem schwindlig, wenn man es zu lange anschaute. Ein sich mit den Jahren verbreiternder Riss, den Vater alle paar Monate neu verputzte, kroch aus dem geschotterten Boden über die Hauswand zum Kellerfenster empor, durchschnitt unsichtbar das Glas, und zuckte sodann eine große fensterlose Partie bis zu einem Punkt empor, den Susanne mühelos berühren könnte, hätte sie sich ein kleines Stück weiter aus dem Fenster gelehnt.
«Ich habe auch bei der Polizei angerufen», sagte sie.
«Polizei?» Onkel Jörg wirkte besorgt.
«Ein Unfall», sagte ich leise. «Sie müssen es zu Protokoll nehmen. Du hast ihn nicht sehen können.» Ich ging neben dem Körper in die Hocke und berührte zum ersten Mal seit Jahren meinen Vater. Die Haut am Hals sah aus wie das schlaffe Gummi einer Faschingsmaske. Die Halsschlagader pochte nicht mehr. Vaters Gesicht war glattrasiert, faltig, weich, ich musste an ein ungekochtes Hähnchen denken. Irgendjemand sollte ihm die Augen schließen. Ich konnte das nicht, stand auf und ließ die Augen weiter ins Leere starren. Im Linken drohte die schmale Sichel der Pupille unter dem unteren Lid davon zu tauchen; wie einen Teppich zog die Sonne den Schatten unseres Hauses behutsam ins Fundament zurück; und auf einmal lag Vaters Hinterkopf in der prallen Morgensonne. Das Licht glitt erst über seine vom Tod geglättete Stirn, dann über die maskenhaften Gesichtszüge. Zur Besinnung brachte mich ein wohlbekanntes Knattern von der Straße her, dem einige mechanische Huster folgten. Ich nahm die zerknautschte Zigarettenschachtel aus Vaters zur Kralle erstarrten Hand und steckte sie in die Hosentasche, bevor Heinz mit der Vespa in den Hof einbog; in meiner Nachttischschublade sollte diese Reliquie noch lange nach Tabak riechen.
«Ich hab ihn nicht gesehen», sagte Onkel Jörg.
Heinz löste den Kinnriemen und nahm den Helm ab.
«Er hat sich nach irgendwas gebückt», sagte ich heiser.
«Man sitzt in dem Ding so gottverdammt hoch», rechtfertigte sich Onkel Jörg und deutete überflüssigerweise auf den Transit. Eine Fliege setzte sich auf meinen Unterarm. Ich ließ sie sitzen. Ihre Füße kitzelten durch meine Haare. Mittlerweile war das Sonnenlicht von Vaters Kinn den Hals hinabgeschmolzen, und mit einer Faszination, für die ich mich heute schäme, registrierte ich, dass Vaters Hemdkragen für den Bruchteil weniger Sekunden die Grenzlinie von Licht und Schatten im Hof bildete. «So eine Scheiße aber auch!», sagte Heinz und steckte sich eine Gauloises an.
Am nächsten Tag lehnte ich wieder an der Leibung des Küchenfensters und sah in den Hof hinab, als wäre nichts geschehen. Susanne war diese Gewohnheit ein Dorn im Auge, aber ich sollte sie erst nach unserem Umzug aufgeben, und das nur notgedrungen, weil die neue Küche bloß durch ein winziges quadratisches Fenster erhellt wurde, dessen ohnehin viel zu schmale Fensterbank Susanne mit Topfpflanzen zustellte, ehe ich protestieren konnte. «Dann bekomme ich beim Frühstück endlich mal dein Gesicht zu sehen!», meinte sie, doch in der Art, wie sie es sagte, schwang das sichere Wissen mit, sich nie mit meiner Morgenlaune anfreunden zu können. Aber ich greife vor. In dem Sommer, von dem ich hier erzählen will, war Vater schon einige Jahre tot und ich schrieb an meinem ersten Roman. An Wochentagen stand ich mit Susanne und Jens, der inzwischen die zweite Klasse besuchte, auf und trank, sobald die beiden das Haus verlassen hatten, einen Kaffee nach dem anderen am Küchenfenster, bis ich mit der Arbeit beginnen konnte. Gegenüber schlich Onkel Jörg durch die Wohnung über dem Beerdigungsinstitut. Um diese Uhrzeit trug er gewöhnlich einen lila Frotteebademantel und bewegte sich durch sein Schlafzimmer, in das der Wind die Vorhänge des geöffneten Fensters blähte, wie ein Taucher mit Bleischuhen auf dem Meeresgrund. Heinz war noch nicht da, denn die Vespa lehnte nicht an der Wand des Sarglagers, und Om war wohl wieder unterwegs, um in der fast hüfthohen Wiese hinterm Haus, die bald mal wieder gesenst werden müsste, seinen beneidenswert unkomplizierten und abenteuerlichen Geschäften nachzugehen.
Noch eine oder zwei Tassen, dann eine Zigarette, überlegte ich (im Gegensatz zu Heinz rauchte ich meist eine milde Marke), und dann müsste ich endlich nach oben gehen, um auf dem Dachboden weiter an meinem Roman zu basteln. Wenn ich heute zwei Seiten rausquäle, bin ich gut. Oder drei. Winkler behauptet, sieben Seiten am Tag schreiben zu können, aber das nehme ich ihm nicht ab. Ich ließ Kaffeepulver in die Filtertüte rieseln, ich brauche nicht mitzufahren, nahm meine Tasse von der Spüle, wo sie mehrere Tellertürme bewachte, denn heute ist ein guter Tag, schwenkte sie mit lauwarmem Wasser aus, summte vor mich hin, ein Schreibtag. Seit Vaters Tod fuhr ich montags und mittwochs im Leichenwagen mit, damit Onkel Jörg währenddessen den, wie er es nannte, Bürokram erledigen konnte. In Notfällen rief er mich mitunter nachts an, und war ich nicht zu Hause, probierte er es in Mollingers Eck, wo ich mich fast jeden zweiten Abend mit Achim traf. Dass man uns nachts anforderte, geschah jedoch höchst selten, denn fast neunzig Prozent unserer Klientel zogen es vor, im Krankenhaus zu sterben, und weil dort der Totenschein erst morgens ausgestellt wird, packt man die Toten nachts in die Kühlvitrinen, lässt die Ärzte weiterschlafen, und damit hat es sich. Onkel Jörg mochte es übrigens sehr, wenn ich ihn in angetrunkenem Zustand begleitete. Ich erinnere mich gut an dieses eine Mal, als er mich in Mollingers Eck abholte, um «rasch einen einzusargen» …
Nach dem siebten Klingeln öffnete die erwachsene, verschlafen aussehende Tochter des Hauses. «Örps!», machte es hinter ihr. «Kommen Sie rein!», sagte die Frau, und wir betraten einen Flur, wo sich ein zerzauster Beo auf seiner Stange freute und rülpsende Geräusche von sich gab. Durch einen Türspalt sah ich eine ältere Dame mit wirrem Haar, vermutlich die Gattin des Verstorbenen, auf dem Ehebett sitzen. Jedes Mal, wenn der Beo rülpste, riss sie die Hände vors Gesicht und schluchzte laut auf. Der Vogel hüpfte zum rechten Rand der Stange, sah die Männer mit dem Sarg nachdenklich an, legte den Kopf schief und erklärte Onkel Jörg: «Örps!» Der holte Luft und wollte gerade etwas erwidern, da fragte ich routiniert (und nach sieben Bieren noch bewundernswert beherrscht): «Wo befindet sich der Verstorbene?» Die Tochter führte uns ins Wohnzimmer, gehäkeltes Deckchen auf dem Fernseher, Nussbaumbücherregale ohne Bücher, Bilder von Waldtieren und Seen, ein nacktes, unangenehm behaartes Bein, das unter einem Plaid mit bunten Rauten hervorlugte. «Brauchen Sie mich noch hier?» – «Nein, danke! Das kriegen wir alleine hin.» Wir setzten den Sarg ab, Onkel Jörg zog die Decke vom Leichnam, faltete sie ordentlich zusammen und legte sie auf einen Sessel. Der Tote war höchstens sechzig, hatte ein versoffenes Gesicht und eine dicke aufgequollene Nase. Schmutzig weißes, ehemals wohl blondes Haar hing ihm strähnig in die Stirn. Wie die meisten Toten sah er erstaunt aus. Und auf einmal legte der Beo im Flur los und gab mit heiserer, vulgärer Stimme eine Sottise nach der anderen zum Besten, und ich sah in verblüffender Klarheit den Verstorbenen vor mir, dem wir gerade das Leichenhemd anlegten, sah ihn vor der Stange im Flur stehen und seinem Beo das Sprechen beibringen: «Ich bin der Felix. Hallo! Hallo! Wie gehts dir? Ich bin der Felix! Ich hab Hunger! Fe-lix! Fe-lix! Ich bin der Fe-lix!» Bei jedem Krächzen des Vogels ertönte aus dem Schlafzimmer ein Schluchzen, und als der Beo in der weinerlichen Cholerik eines Betrunkenen «Wo sind denn die Scheißschlappen?» keifte, verlor ich die Beherrschung.
Onkel Jörg zwinkerte mir zu, sagte: «Der Vogel, der Vogel …», und wir mussten uns aufs Sofa setzen. «Gibt es Probleme?» Die Tochter des Toten erschien in der Tür, ein Postsparbuch in der Hand. «Nein», würgte Onkel Jörg und erhob sich ächzend. «Alles ist in bester Ordnung.» Doch kurz darauf ging es die fürchterlich steile, eng gewundene Treppe hinab, die zu allem Überfluss noch ein unnötig hohes Geländer hatte. Drittes Stockwerk, der Beo keifte, die Tochter war uns in den Füßen, und ich arbeitete ohnehin lieber mit Heinz zusammen, der in etwa meine Größe hatte. Musste ich mit Onkel Jörg, er war klein und dick, einen Sarg tragen, spürte ich es noch am nächsten Tag im Kreuz. «Du solltest den Sarg anheben!», schlug ich vor. «Ja», sagte Onkel Jörg, tat es aber nicht, ich strauchelte, und Zack! schrammte der Sarg an der Wand entlang, Kratzer in der Tapete. Geduldig: «Du musst versuchen, den Sarg noch ein Stückchen anzuheben!» – «Nein», widersprach Onkel Jörg, dessen Augen vor Anstrengung aus den Höhlen traten. «Wenn ich in die Knie gehe, kannst du …» – «Nein, ich gehe in die Knie, und du hebst den Sarg an.» – «Gut», sagte er, machte jedoch keine Anstalten, den Sarg anzuheben. «Vorsicht!», warnte ich vergeblich. «Hoch! Anheben! Langsam!» Zack! wieder die Wand, und Bomm! setzte Onkel Jörg den Sarg ohne Ankündigung auf dem Treppenabsatz ab, wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn, hatte danach aber keine Geduld, sich mit mir über unser weiteres Vorgehen zu beraten, sondern hob den Sarg so plötzlich an, dass ich einen Schritt treppauf machen musste, um mein Rückgrat zu retten. «Sag: ‹Hallo!›», rief oben der Beo mit der versoffenen Stimme des Verstorbenen. «Scheißvogel! Sag endlich was! Sag: ‹Hallo!›, du Idiot!» – «Hallo!», sagte ich. – «Örps!», kam es von oben. – «Ich drehe mich um», verkündete Onkel Jörg, «dann kann ich besser greifen.» Ungeschickt wie ein Käfer begann er, sich im Treppenhaus umzudrehen. «Ich bin der Felix Örps!», rief es oben. Dem «Örps!» folgte das obligatorische Geschluchze aus dem Schlafzimmer. Die sterbliche Hülle Ihres Mannes nehmen wir mit, aber seine Stimme lassen wir Ihnen noch ein Weilchen da. Ich lachte immer noch, als ich versuchte, zu Susanne ins Bett zu kriechen, ohne sie aufzuwecken. «Was ist denn los?», fragte sie. «Der Örps ist los!», sagte ich. Sie fixierte mich schlaftrunken, und ich bedeckte mein Gesicht mit beiden Händen und verkündete mit Grabesstimme, dass in dieser Nacht der Örps gestorben sei.
Solche Nachtfahrten mit Onkel Jörg waren glücklicherweise eine Seltenheit. Das ersparte mir zum einen Kreuzschmerzen, außerdem blieb mein Freund Achim ungern allein in Mollingers Eck sitzen. Montags und mittwochs fuhr ich, wie bereits erwähnt, mit Heinz den Leichenwagen. Er arbeitete länger im Beerdigungsinstitut, als ich mich erinnern konnte, und trug nun Jens auf den Schultern im Hof umher, wie er früher mich getragen hatte. Heinz war früher Gewichtheber gewesen und hatte sogar, was mir schon als Kind imponierte, bei einigen Provinz-Meisterschaften im Kraftdreikampf (Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen) Medaillen errungen, doch seit etwa einem Jahrzehnt ließ er die Hanteln ruhen und die Muskeln verfetten, was seiner Stärke jedoch nur unwesentlich Abbruch tat. Es ist schwer, sich das Aussehen von Menschen zu vergegenwärtigen, die man lange Zeit fast täglich sah. Heinz hatte kurzes drahtiges Haar, das er mit dem Bartschneider trimmte, schwarzes Haar mit vereinzelten grauen Strähnen. Er vertrug mindestens zehnmal so viel Bier wie ein Normalsterblicher, wirkte immer unrasiert, und eine deutlich konturierte tiefe Mulde zwischen Nase und Oberlippe ließ ihn im Zusammenspiel mit den dichten Brauen nicht gerade clever aussehen.
Heinz dürfte damals einundfünfzig oder zweiundfünfzig gewesen sein, benahm sich aber nicht, wie man es von einem Mann im gesetzten Alter erwartet. Es war ein Riesenspaß, mit ihm den Leichenwagen zu fahren, ein entlastender Ausgleich zu jeglicher intellektueller Tätigkeit, ein Ausgleich, den ich in diesem Sommer bitter nötig hatte. Stets eine Filterlose im Mundwinkel kurbelte er das Fenster runter, wenn wir an Ampeln hielten, und schlug älteren Damen im öligen Tonfall eines Jahrmarkt-Anreißers eine Spritztour um den Block vor. Manchmal brüllte er auch Sachen wie: «Ich komm dich holen!» und griff mit behaarter Pranke nach einem Fußgänger, doch zu solchen Entgleisungen kam es erst, wenn die zahllosen Abstecher ihre Wirkung zeigten, die uns zu Kiosken mit Namen wie Bierhalle oder Sonjas Hähnchen Grill geführt hatten oder zu diesen in Getränkehandlungen mit Stehausschank umfunktionierten Garagen, wo Heinz jeden mit Vornamen anredete. Nach einem Tag mit mehreren dieser «Päuschen» konnte es vorkommen, dass er Susanne fröhliche Obszönitäten zurief, was diese mit schiefem Grinsen quittierte; dennoch mochte sie Heinz, er hatte (es ist mir peinlich, es hinzuschreiben, aber ich tue es trotzdem) ein großes Herz, und – was ich besonders an ihm schätzte – einen zwar derben, aber nie verletzenden Humor.
Als Kind ließ ich mir von Onkel Jörg, der, wenn ich es mir recht überlege, kaum älter als Heinz war (beziehungsweise, wenn er noch lebt: ist), gerne erzählen, wie Heinz einmal mithalf, das Zelt aufzubauen, als der Zirkus Maximilanowitsch Borasi in der Vorstadt gastierte. «Und da kommt so ein Wicht von Hypnotiseur und sagt: ‹Hört mal zu, Jungs! Ich brauch heut Abend drei Mann! Jeder kriegt seine zehn Märker.› Heinz ist sofort dabei, denn das Geld ist schnell verdient: Er hat nichts weiter zu tun, als ‹Gra? Gra? Gra?› zu sagen, wenn er nach seinem Namen gefragt wird.» Während der abendlichen Vorstellung wedelt der Hypnotiseur mit den weiten Ärmeln seines bestickten Kaftans vor den Gesichtern der «Freiwilligen» herum – ich stelle ihn mir gerne als beleibten Sultan mit edelsteingeschmücktem Turban und gezwirbeltem Schnurrbart vor – und murmelt seine Beschwörungen: «Durch die Macht meiner Magie werdet ihr kleinen Menschlein eure erbärmlichen Namen vergessen!» Er wendet sich an den ersten Freiwilligen. «Wie heißt Du?» – «Gra?» Er wendet sich an den zweiten. «Wie heißt du?» – «Gra? Gra?» Er wendet sich an den dritten. «Und wie heißt du?» – «Heinz Brenner!», brüllt Heinz so laut, dass ihm die Adern am Hals schwellen. «Ich heiße Heinz Brenner!» Und man hört ihn noch seinen Namen krakeelen, nachdem ihn der Dompteur, der Kraftmensch und der dumme August aus der Manege getragen haben. Natürlich stimmt diese Geschichte nicht, sie ist mir später in zahllosen Varianten über den Weg gelaufen, aber irgendwie stimmt sie doch, denn so war Heinz, und Abend für Abend bestieg er nach einem Schnäpschen mit Onkel Jörg die Vespa, um sich von ihr nach Hause bringen zu lassen. «Sie kennt den Weg», grinste er, eine Zigarette im Mundwinkel – manchmal glaube ich, dass ich ihn mehr vermisse als alle anderen.
Damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht: Die Arbeit für Onkel Jörgs Beerdigungsinstitut hatte auch ihre unangenehmen Seiten. Vor allem, wenn wir bei Autounfällen den Notsarg einsetzen mussten, eine zusammenklappbare Zinkwanne, die an der rechten Innenwand des Transits befestigt war. Die Angehörigen stehen rum, sind zu geschockt, um zu begreifen, dass dieser Klumpen Fleisch und Blut, aus dem gesplitterte Knochen ragen, ihr Bruder oder ihre Mutter war, und betrachten uns voller Hass, als wären wir die Gehilfen des Sensenmanns. Dabei sind wir vielmehr eine Art Müllabfuhr des Todes: Wir streuen Sand, um das Blut auf dem Asphalt zu binden, kehren die gröbste Schweinerei zusammen, und ab damit in die Zinkwanne. Später steht dann am Straßenrand ein Holzkreuz oder eine rote Grablaterne oder, wie in jenem Fall, an den ich mich jetzt deutlich erinnere, das mit einem Kranz umwundene Rad eines Fahrrads. Ich fuhr ein paar Tage nach dem Unfall mit Susanne an dem geschmückten Rad vorbei (wohin wir unterwegs waren, weiß ich nicht mehr; bestimmt hatten wir uns von Onkel Jörg den Transit geliehen, um Getränke einzukaufen) und sagte stolz: «Den haben wir mit diesem Auto abgeholt.» – «Verschon mich mit deiner Arbeit!» – «Der hat hinten im Auto drin gelegen.» – «Georg!» – «Hat immer so geröchelt», ich gab gurgelnde Geräusche von mir, «und von innen an die Zinkwanne geklopft, weil er raus wollte. Erst haben wir gedacht, es würde was am Auto klappern. ‹Was klappert denn da?›, fragt mich Heinz, und ich sage: ‹Das ist doch eher ein Blubbern!›» – «Georg!», zischte Susanne. Ich fuhr schweigend weiter. Nach einer Weile fing ich an, mit Fistelstimme «Hilfe! Hilfe!» zu rufen und dabei ganz leicht mit dem Knöchel an die Seitenscheibe zu pochen. «Hilfe! Hilfe!», piepste ich. «Lasst mich bitte raus! Hilfe!» Gleich, wusste ich, würde Susanne mit diesem lächerlichen Gesichtsausdruck zu schreien beginnen, bei dem ich nicht ernst bleiben könnte. «Macht dir deine Arbeit nichts aus?», hatte mich Winkler mal gefragt. «Nein», sagte ich, «ich bin damit groß geworden. Wir haben im Sarglager Verstecken gespielt. Aber manchmal schafft es schon.» Ich überlegte, was und wie viel ich ihm anvertrauen durfte, und ergänzte vorsichtig: «Junge hübsche Frauen zum Beispiel.» – «Und hast du nie?» – «Nie! Ich bitte dich!» Natürlich hatte ich. Aber das war eine kalte, traurige Sache, nichts worüber man reden sollte. Und schon gar nicht mit jemandem wie Winkler.
Bevor ich mit dem Schreiben begann oder mich wieder hinlegte, weil mir schlecht wurde, wenn ich ans Schreiben dachte, bedauerte ich regelmäßig Jens. In der Schule zwang man ihn zum Stillsitzen, zum Aufmerken und zum Kopfrechnen. Man erzählte ihm jede Menge Unsinn vom lieben Gott und der Wichtigkeit des Arbeitens, nötigte ihn dazu, im Kanon Hoch auf dem gelben Wagen zu singen, las ihm hanebüchenen Unfug vor: Der süße Brei (Gebr. Grimm), Der kleine lustige Hase (Gebr. Dumm) – und aus welchem Grund glauben Erwachsene eigentlich, man müsste Kindern alles über St. Martin erzählen? «Warum hat er dem Bettler nicht den ganzen Mantel gegeben?», hatte Jens einmal wissen wollen, und seine Lehrerin ermahnte ihn, ernst zu bleiben und zukünftig freche Zwischenbemerkungen zu unterlassen. «Ich halte das durchaus für einen berechtigten Einwand», tröstete ich ihn, aber die moralische Unterstützung seines Vaters half Jens in der Schule denkbar wenig.
Als ich die vierte Klasse besuchte, hatte meine Lehrerin, die wir «Fräulein» nannten, obwohl sie schon zum zweiten Mal verheiratet war, eine Nikolaus-Tombola veranstaltet. Fräulein Gilbeck heftete Schönschrift-Zahlen an die Päckchen, arrangierte sie auf dem Pult, und dann musste jeder eine Nummer aus ihrer gefütterten, muffig riechenden Wintermütze ziehen. Das Geschenk, das ich zur Tombola beisteuerte, war ein Dreierpack, bestehend aus einem Bleistift, einem Bleistiftspitzer und einem Radiergummi, ganz wie es Fräulein Gilbeck vorgeschlagen hatte, als Andreas sie fragte, wie teuer das Nikolausgeschenk denn sein müsse. «Wir kaufen nur kleine Sachen.» Fräulein Gilbeck lispelte leicht und sprach stets in diesem geduldigen, nachsichtigen Tonfall, den ich als Erwachsener nur dann anschlug, wenn ich Susanne zur Weißglut bringen wollte. «Wir», fuhr Fräulein Gilbeck in einer Munterkeit fort, die sie für ansteckend hielt, «schenken uns alle etwas Nützliches.» – «Was ist denn etwas Nützliches?», fragte Andreas, und Fräulein Gilbeck antwortete prompt: «Ein Bleistift, ein Bleistiftanspitzer und ein Radiergummi zum Beispiel.» In meiner kindlichen Ehrfurcht vor Autoritäten ließ ich Mutter tatsächlich besagte Schreibwaren kaufen und in das Weihnachtspapier mit den fetten Engeln und verblichenen Kometen einwickeln, das vom Vorjahr übriggeblieben war. Natürlich versuchten wir am Tag der Verlosung rauszukriegen, welche Gewinnmöglichkeiten sich uns boten. Als absolutes und ungeschlagenes Hitgeschenk stellte sich ein Lustiges Taschenbuch heraus, und wir alle hätten selbstverständlich lieber Fantomias schlägt zurück gewonnen als eine Packung Lego (von Michael) oder das Pferdebuch mit den Lesespuren am Rücken (von Karin) oder gar den Bleistift, den Spitzer und den Radiergummi.
Hinter mir, in der nur halberinnerten Küche, in der sich mein erinnertes Ich an seine Kindheit zurückerinnert, weil ich will, dass es sich genau jetzt daran erinnert, begann der Wasserkessel zu pfeifen, erst zaghaft, dann mit wütender Energie. Ich nahm ihn vom Herd, goss sprudelndes Wasser in den Filter, der unförmig auf der Thermoskanne saß, ich rieche den frisch gebrühten Kaffee, rieche ihn hier im Hotelzimmer und stehe wieder am Küchenfenster. Als ich mein Nikolaus-Tombola-Geschenk überreicht bekam, fiel es mir schwer, die Enttäuschung zu verbergen: drei Drittklässlerhefte. Natürlich wusste ich, von wem sie stammten. Das Mädchen hieß Astrid, stand kurz vor der Überweisung in die Sonderschule und wohnte in einem so genannten sozialen Brennpunkt, einer berüchtigten Straße, die wir beim Spielen mieden. Fräulein Gilbeck entging meine Enttäuschung nicht. Sie zeigte sich bestürzt über meinen zugegebenermaßen etwas kärglichen Gewinn und machte den Vorschlag, dass der- oder diejenige, «der oder die drei Hefte für die dritte Klasse zur Nikolaus-Tombola einer vierten Klasse beigesteuert hat», mir morgen etwas mitbringen solle, «als Wiedergutmachung sozusagen», einen Apfel zum Beispiel, den der oder die Betreffende (außer Fräulein Gilbeck wusste jeder, um wen es ging) mir vor der ersten Stunde auf die Bank legen könne. Ich sah mich außerstande, zu protestieren. «Lasst es doch bleiben!», hätte ich gerne gerufen. «Macht euch wegen mir keine Umstände und vergesst die ganze Sache!» Stattdessen sagte ich nichts und schämte mich, im Mittelpunkt zu stehen, schämte mich dafür, dass sich Astrid schämte, schämte mich, dass jeder wusste, dass sie mir jetzt einen Apfel mitbringen musste, schämte mich, dass Jochen einen Bleistift, einen Spitzer und einen Radiergummi gewonnen hatte, außerdem mochte ich damals keine Äpfel. Genauso wenig wie Birnen, Mirabellen und Pflaumen; allein das Wort «Fallobst» jagte mir einen Schauder über den Rücken.
Am Boden des Filters hatte sich ein fingertiefer Morast gebildet, ich goss heißes Wasser nach, flutete den Sumpf zum dampfenden Tümpel, zum See, und ließ den Kaffeesatz bis zum oberen Rand emporstrudeln. Am nächsten Tag hatte ein Apfel auf meiner Bank gelegen. Ich betrat das Klassenzimmer, sah ihn, bemerkte zugleich, dass mich alle beobachteten, versuchte, erfreut und überrascht zu wirken, näherte mich meinem Platz ohne Astrid dabei anzusehen, setzte mich blöd grinsend hin und ließ den Apfel unter der Bank im Ranzenfach verschwinden. Selbst nach den Weihnachtsferien lag er noch da, faulte und verströmte süßlichen Verwesungsgeruch. Ich ekelte mich dermaßen vor dieser verschrumpelnden Frucht, dass ich sie nicht berühren konnte. Nicht in der Lage, sie eigenhändig zu entfernen, setzte ich meine Hoffnungen in die Putzfrauen, doch der Apfel blieb liegen. Abends vorm Einschlafen dachte ich an nichts anderes als an diesen sich in grauen Schleim verwandelnden Apfel, ich konnte mich in der Schule kaum noch konzentrieren, vergaß Zahlen beim Kopfrechnen, verlas mich beim Vorlesen, Apfel, tönte es unaufhörlich in meinem Kopf, verfaulender Apfel. «Georg?» Fräulein Gilbeck baute sich vor mir auf. «Hast du häusliche Probleme?» Ende Februar fasste ich den Entschluss, mir die Sache etwas kosten zu lassen. Neben mir saß Jochen. Seine Eltern waren bei einem Autounfall tödlich verunglückt, was ihn in den Augen seiner Mitschüler zu einer Sensation machte. Er lebte bei einer alten Tante, durfte Raumpatrouille Orion und Die Vögel sehen («Und wosch! fliegt die Tankstelle in die Luft!») und war ein hartgesottener, frühreifer Bursche («Dann haben wir aus ihrer Tittenmilch Pudding gemacht!»), der kein Wort Hochdeutsch sprach und seine Popel so genussvoll und ungeniert verzehrte, wie ich es seither nie wieder gesehen habe. «Ich geb dir ne Mark, wenn du den Apfel wegmachst.» – «Ich machs für zwei.» – «Okay!», sagte ich, und wir besiegelten es mit Handschlag. Vielleicht hat Susanne ja recht mit der Behauptung, dass ich zu viel in der Vergangenheit lebe, überlegte ich am Küchenfenster, aber ich kann nicht verzeihen. Von Fräulein Gilbeck bis zum unfreundlichen Busfahrer meiner Gymnasialzeit: Sie stehen alle auf der Schwarzen Liste.
Ich warf die Filtertüte in den Ausguss, schenkte mir Kaffee ein. Unten zog Mutter die Wohnungstür zu, und kurz darauf sah ich sie nur wenige Meter an der Stelle vorübereilen, wo Vater gestorben war; sie hatte offensichtlich die erste Stunde frei. Seit Vater tot war, blühte sie von Jahr zu Jahr mehr auf. Die Arbeit machte ihr Spaß, die Schüler nannten sie Frau und nicht Fräulein Fahlmann, und auf die Idee, eine Nikolaus-Tombola zu veranstalten, wäre sie gewiss nicht gekommen. Mutter, von deren Vater ich die Leidenschaft für Bücher geerbt hatte, half Jens nachmittags bei den Hausaufgaben. Mein Argument, dass sich das schon einmal bezahlt gemacht habe, überzeugte selbst Susanne, überdies mochte ich es (was ich Susanne allerdings nicht auf die Nase band), meine Mutter in dem wiederzuerkennen, was Jens mir erzählte, Mutter, wie sie früher gewesen war, wenn sie sich neben mir über den Wohnzimmertisch beugte, vor uns aufgeschlagene Bücher und Hefte, während sie sich mit dem Tintenkiller geduldige Locken ins Haar drehte.
Leider hatte die Mutter meiner Kindheit nur wenig mit der sonnenbankgebräunten Person zu tun, die jetzt über den Hof hastete, um den Acht-Uhr-Fünfzehn-Bus zu erwischen, einer Frau, die sich krampfhaft weigerte, alt zu werden, mit zu jungen Männern schäkerte, lachhaft modische Kleider und Teenager-Schmuck trug sowie viel zu oft «in den sonnigen Süden» flog. Ich kann mir übrigens kaum vorstellen, wie ich als Kind aussah. Gewiss, es gibt Fotografien (ich auf Mutters Schoß, ich auf der Schaukel hinterm Haus, ich beim Kuchenbacken mit mehlbestäubtem Gesicht), aber diese Bilder scheinen mir auf seltsame Art und Weise verkehrt zu sein, denn in meinen Kindheitserinnerungen agiere ich stets als körperlich kleinere Version meines erwachsenen Ichs, und der Gedanke, dass ich der kleine Junge gewesen sein soll, der meiner Mutter von seinem Taschengeld ein Küchengerät aus Plastik zu Weihnachten kaufte, verwundert und rührt mich zugleich. Im Gegensatz zu Vater gab mir Mutter immer das Gefühl, ihr etwas Schönes, etwas Nützliches geschenkt zu haben, indem sie meinen Tanten und Onkeln das Geschenk präsentierte, wenn diese am zweiten Weihnachtsfeiertag ihren Pflichtbesuch abstatteten. Ich hatte Vater einmal ein Feuerzeug zum Geburtstag geschenkt. Obwohl er sich damals bei mir bedankte, argwöhnte ich, dass er sich nicht so recht freute, dabei hatte mich das rote Plastikfeuerzeug siebzig Pfennig gekostet und mir zudem einen langen, belehrenden Vortrag des Tabakwarenhändlers über die Gefahren des Rauchens eingebracht. «Und dann schneiden sie dir die schwarzen Raucherbeine ab», resümierte er vergnügt und überging mit einem wissenden Lächeln meine Bemerkung, es handele sich um ein Geburtstagsgeschenk für meinen Vater. «So was hör ich jeden Tag», seufzte er. «Das hör ich so oft, dass ich mir manchmal wünsche, ihr würdet euch was Ordentliches ausdenken.» Wortlos zählte ich ihm sieben Zehnpfennigstücke in die aufgehaltene Hand; ich werde ihn ebenfalls auf meine Schwarze Liste setzen.
An seinem Geburtstag wickelte Vater das Feuerzeug aus der Papierserviette, in die ich es eingeschlagen hatte, sagte: «Aha!», was längst nicht so erfreut klang, wie es wahrscheinlich klingen sollte, räusperte sich erschrocken, als er den Gesichtsausdruck meiner Mutter bemerkte, murmelte: «Danke sehr!» und ließ das Feuerzeug in der Jackentasche verschwinden. «Verschwinden» ist das richtige Wort, denn es blieb tagelang verschollen, bis es überraschend in der Kramschublade des Küchentischs auftauchte, wo ich ab und zu nach Kleingeld stöberte. Von da an schob ich das Feuerzeug jeden Abend unauffällig in Vaters Reichweite, sobald er in seinem Fernsehsessel Platz genommen hatte, um die Tagesschau zu sehen, die Beine hochgelegt, auf dem Wohnzimmertisch der Aschenbecher und die Abendzigarre.
Aber jedes Mal, wenn Vater das Feuerzeug benutzte und es beim Wetterbericht an die Spitze der Zigarre hielt, um die Flamme mit kussähnlichem Schmatzen in den Tabak zu saugen, wurde mir schmerzlich bewusst: Er hatte vergessen, dass es sich hierbei um das Geburtstagsgeschenk seines Sohns handelte. Achtlos legte er es beiseite und zog sich in eine Wolke beißenden Gestanks zurück, aus der nach einer Weile ein Arm kam, um nach der Fernsehzeitung zu tasten. Dieses Spielchen machte ich etwa eine halbe Woche mit, dann hatte ich die Nase voll: Ich ließ das Feuerzeug in der Kramschublade, und zu meiner Bestürzung zog Vater am ersten feuerzeuglosen Abend ein Schächtelchen extralanger Streichhölzer aus der Brusttasche der Feierabendweste und gab sich mit großer Selbstverständlichkeit Feuer. Seitdem habe ich ihm nichts mehr geschenkt.
Über solche Sachen dachte ich oft nach, wenn ich mich ins Untergeschoss schlich, nachdem Mutter zur Arbeit gegangen war. Bereits im Wohnungsflur lauerten Erinnerungen, und kaum war die Tür hinter mir ins Schloss gefallen, ergriff mich die wehmütige Gewissheit eines unwiederbringlichen Verlustes. Eine moderne Couchgarnitur hatte die bequemen Sessel vertrieben, der Läufer war verschwunden, über dessen umgeknickte Ecke wir früher alle gestolpert waren, und die zahllosen Aschenbecher hatten nach Vaters Tod ihr trauriges Exil auf dem Dachboden angetreten, wo sie nur noch mir treue Dienste leisteten. Im neu gekachelten Badezimmer, hier roch es nach Mutters süßlichem Deodorant, vermisste ich meinen Handtuchhalter Marke Entenkopf, auf dem Glasregal über dem Waschbecken stand ein einziger verwaister Zahnputzbecher, aber am schlimmsten hatte es mein Kinderzimmer erwischt. In diesem kleinen, als Gästezimmer verkleideten Raum endete der Rundgang. Ich legte mich aufs Bett, das noch am alten Platz stand, und zelebrierte eine Senior Service, eine dieser legendären Zigaretten, die James Bond zu rauchen pflegt. Ich aschte in den Bettkasten, ließ Arabesken und Ornamente aus Rauch zur Decke aufsteigen, aus deren Flecken und Rissen die vergessenen Fratzen der Jugend traten. Auch aus den Falten der Vorhänge krochen Erinnerungen, bewegten sich seitwärts wie Krebse auf mich zu, ich nahm einen knisternden Zug an der Zigarette, vermisste das Star-Wars-Plakat an der Tür, die Bravo-Poster von Debbie Harry an den Wänden, vermisste sogar die Vollmondnächte, in denen ich nicht schlafen konnte und die Lamellen der Fensterläden das Scheinwerferlicht der vorbeifahrenden Autos über die Zimmerdecke fächerten. Ich war nicht gerne erwachsen. Ich war nie gerne ein Kind gewesen. Mutter mochte Susanne nicht. Susanne mochte Mutter nicht. Ich mochte Mutters Freunde nicht. Tja … Gegenüber machte Onkel Jörg sich bemerkbar, immer noch im lila Bademantel. Ich winkte, und zufrieden darüber, dass ich ihn gesehen hatte, schloss er das Schlafzimmerfenster und zog den Vorhang zu. Ich nahm die Thermoskanne von der Fensterbank und schenkte die Tasse wieder voll. Damals hatte Onkel Jörg meinen Vater eingesargt, alleine, am Nachmittag, aber das Licht brannte noch immer hinter den getönten Scheiben des Lagers, als ich schlafen ging. Am nächsten Tag fuhr er ihn gemeinsam mit Heinz zum Krematorium, nahm dort persönlich die Urne in Empfang und zeigte sie uns allen, bevor er sie nach Sylt zu unserem Reeder schickte. Den Wunsch, auf See bestattet zu werden, hatte Vater mehr als einmal geäußert. Bestimmt ertrug er die Vorstellung nicht, dass sein zu Lebzeiten so sorgsam gepflegter Körper im Erdboden zu Sülze verrottete, Käferlarven ernährte, Maden ein Heim bot, während der Totenwurm Tunnel um Tunnel ins verwesende Fleisch bohrte.
Der Polizist, den sie uns damals geschickt hatten, war klein und in Zivil, hatte starken Sonnenbrand auf der Stirnglatze und versuchte offenbar, einen Weltrekord im Preisschwitzen aufzustellen. «Sie brauchen keinen Leichenwagen zu rufen», sagte er und sah von seinem Block auf. «Sie können das ja selbst machen.» Dieser Gedanke ließ ihm von nun an keine Ruhe mehr. «Ich weiß, dass das makaber klingen mag, aber irgendwie ist es doch», er zögerte, «praktisch», jetzt war es heraus, «wenn er hier im Hof», um Verständnis heischendes Armrudern, «Sie verstehen schon!» Interessiert wandte er sich an Onkel Jörg, der neben dem Toten auf einem umgedrehten Bierkasten saß. «Wollen Sie es selbst erledigen, Herr Fahlmann?» Onkel Jörg brachte ihn mit einer matten, abwehrenden Handbewegung zum Schweigen. Teilnahmslos beobachtete ich, wie das Sonnenlicht die Westfassade unseres Hauses hinabströmte. Nachdem der Polizist gegangen war, begann Onkel Jörg zu weinen. Heinz legte mir den Arm um die Schulter. Der alte Doktor Birch kam, um den Totenschein auszustellen. Danach ließ er einen Flachmann mit gutem Cognac rumgehen. Er bemerkte mehrmals, es sei eine Schande, ich stimmte jedes Mal zu, gab ihm den Flachmann zurück, er nahm selbst einen tiefen Schluck, Heinz räusperte sich entschlossen. «Wir packen ihn besser weg, bevor Marianne nach Hause kommt!» Und dann packten wir Vater weg.
Im Flur klingelte das Telefon, hartnäckig, mit prahlerischem Dudeln. Früher haben Telefone wenigstens noch richtig geläutet, aber das hört man leider nur noch in alten Filmen. Hier gibt es kein Telefon. Wozu auch? Ich sitze an einem – nein, ich muss weitermachen, muss mich weiter erinnern, das Telefon läutet, ich muss mich erinnern, wie ich die Kaffeetasse auf die Fensterbank stellte, in den Flur ging, muss mich genau erinnern, wie ich den Hörer abhob …
«Spreche ich mit Herrn Georg Fahlmann?»
Ich kannte die Stimme. «Ja», sagte ich.
«Es geht um Ihren Großvater.»
«Wer spricht dort, bitte?»
«Buchhandlung Struebing. Struebing mein Name.»
Vorsichtig, um mich nicht im Telefonkabel zu verheddern, ging ich zurück in die Küche, schob das Frühstücksgeschirr beiseite und parkte das Telefon zwischen Tellern und Marmeladengläsern. Jens hatte seinen Kakao nicht ausgetrunken, aber wir waren froh, wenn er überhaupt frühstückte. «Ein halbes Brötchen», drängten wir und werteten es als Erfolg, wenn er zwei Drittel davon aß. Ein Pausenbrot brauchte man ihm gar nicht erst zu schmieren, da der Hausmeister der Grundschule, ein gewisser Herr Sattler, einen florierenden Handel mit aufgeschnittenen Brötchen unterhielt, zwischen deren Hälften er Mohrenköpfe plattdrückte; für Jens gab es nichts Köstlicheres.
«Was kann ich für Sie tun, Herr Struebing?»
«Er ist wieder da.»
«Und?»
«Er lässt sich nichts sagen.»
Ich ließ ihn zappeln.
«Wäre es möglich, dass Sie mit ihm …?»
«Sie möchten, dass ich mit ihm spreche?»
«Genau», sagte Herr Struebing dankbar, und kurz darauf meldete sich mein Großvater mit einem skeptischen: «Roeder?»
«Na, wie gehts?»
«Georg! Hat er dich wieder angerufen?»
«Wer sonst? Wie gehts dir?»
«Bestens. Über die Stufen des Walds tanzt das silberne Herz.»
Zu sagen, dass Großvater die Literatur liebte, ist untertrieben. Im Unterschied zu üblichen Bibliophilen handelte es sich bei ihm jedoch, wie er gerne betonte, um einen philanthropischen Bibliophilen, einen, dessen Lebenssinn darin bestehe, jeden an seiner Liebe zum gedruckten Wort teilhaben zu lassen. Hatte er einen guten Tag, das heißt einen Tag, an dem er erwachte und sich mitteilsam fühlte, was ziemlich häufig vorkam, zog er den Sonntagsanzug an, fuhr mit dem Bus in die Innenstadt und beriet die Kunden in seinen zwei oder drei Lieblingsbuchhandlungen. Da diese aber erst nach neun Uhr öffneten, begann er die Runde notgedrungen in der Buchhandlung Struebing, wo man nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften, Geschenkpapier und Schulbedarf verhökerte, ein Umstand, den Großvater von ganzem Herzen verabscheute. Durch einen Zufall (Jens schrieb ein Diktat, konnte den Füller nirgends finden und brauchte einen neuen) hatte sich mir eines Tages die Gelegenheit geboten, Großvater bei der Arbeit zu beobachten. «Kann ich Ihnen behilflich sein?», fragte er, den Oberkörper leicht vorgebeugt, die Hände in Bauchhöhe verschränkt, eine zuvorkommende Haltung, die ihm im Zusammenspiel mit der scharf gebogenen Nase und dem wiedehopfartigen Haupthaar etwas Vogelähnliches gab. «Sie arbeiten nicht hier, Herr Roeder!», versuchte der Buchhändler einzuschreiten, und ich nahm mit Entzücken zur Kenntnis, dass man das Ärgernis beim Namen kannte. «Wenn das so weitergeht, werde ich mich in Bälde gezwungen sehen, die Polizei zu alarmieren!» Großvater lächelte entwaffnend freundlich. «Ach, für mich ist das doch keine Arbeit! Das mach ich gerne!» – «Es geht nicht darum, ob Sie es gern machen, Herr Roeder!» – «Ich denke, dass es ganz allein darum geht!» Mit einer höflichen Verbeugung beendete Großvater das Gespräch. Ich verstand nicht, wieso Struebing sich aufregte. Meiner Meinung nach sollten Leute wie er heilfroh sein, wenigstens einmal am Tag eine kompetente Kraft im Laden zu haben.
«Was empfiehlst du heute?», fragte ich Großvater.
«Ich habe zurzeit ein Faible für die Amerikaner.» Wir plauderten ein wenig, Großvater nahm mir das Versprechen ab, ihn bald besuchen zu kommen, er habe da ein Buch, das ich unbedingt – er lachte. «Struebing macht die ganze Zeit spitze Ohren. Ohren wie ein kleiner Elferich – ich muss Schluss machen, da kommt Kundschaft.» Hastig wünschte er mir viel Glück bei der Arbeit, Grüße an die Familie sowieso, ach ja, natürlich sei er gespannt auf meinen Roman, sehr gespannt sogar. Er legte auf und ließ mich allein in der Küche zurück. Mittlerweile war es acht Uhr fünfundfünfzig. Ich stellte mich wieder ans Fenster, trank eine weitere Tasse Kaffee, rauchte und genoss es, noch immer nicht arbeiten zu müssen. Unten kurvte Heinz auf der Vespa in den Hof, gab Gas wie ein Stuntman, schlitterte über den Schotter, feixte zu mir hoch, nahm den Helm ab und brüllte: «Alles klar?» Ich antwortete mit einem aufgerichteten Daumen. Heinz lehnte die Vespa an die Wand, hängte den Helm an den Lenker, schnippte die Zigarettenkippe fort und zeigte mir den steifen Mittelfinger, ehe er, eine frische Gauloises zwischen den Zähnen, im Lager verschwand. Dort, wo die Kippe aufgekommen war, stieg zwischen den Steinen ein Rauchfaden auf. Mein Vater war sechsundfünfzig, als er starb. Da blieben mir noch fünfundzwanzig Jahre, nicht dran denken, schreiben, muss schreiben, muss jetzt endlich mit dem Schreiben beginnen, nur noch fünfundzwanzig Jahre, muss endlich schreiben.
Es gelang mir, den Kaffee nach oben zu transportieren, ohne etwas zu verschütten. Der Trick ist denkbar einfach. Vater hat ihn mir verraten, und ich glaube, das ist das Einzige, was ich jemals von ihm gelernt habe. «Du darfst beim Laufen nie auf die Tasse schauen», hatte er mir erklärt. Das sei der ganze Trick, und es funktioniert tatsächlich. Ich stieg die Treppe hinauf zum Dachboden, versuchte zu vergessen, eine randvolle Tasse in der Hand zu halten, zwang mich stattdessen, schwipp-schwapp, starr geradeaus zu sehen, setzte mich an den Schreibtisch, stellte die Tasse auf ein Schmierblatt – und nun begannen die richtigen Probleme. Außerirdische nahm man mir nicht ab. Aber Außerirdische waren doch das Einzige, was zählte!
21644 West 54. Place war ein ausgedörrtes braunes Haus mit einem ausgedörrten braunen Rasen davor. «Mrs. Florian?», sagte ich. «Mrs. Jessie Florian? Sind Sie die Mrs. Florian, deren Mann mal ein Vergnügungslokal auf der Central Avenue betrieben hat?» Ich klappte das Buch zu und überlegte, wo die Nagelschere wohl sein mochte. Susanne in Sachen Ordnung etwas schlampig zu nennen, war untertrieben. Ihre getragenen Slips fanden sich im Bad unterm Waschbecken, neben dem Bett, unter ihrem Kopfkissen, und manchmal räkelte sich eines der Seidenhöschen sogar in prahlerischer Freizügigkeit auf der Lehne meines Lesesessel. Es überraschte mich längst nicht mehr, wenn sich auf dem Telefontisch eine halbgegessene Birne in eine bräunliche Scheußlichkeit verwandelte, oder mich beim Hochklappen des Klodeckels ein blassgelber Teich angrinste. Susannes Neigung zur Unordnung wurzelte tief in ihrem Wesen, und dieses Ärgernis zu bekämpfen, hatte sich bereits in den ersten Wochen unseres Zusammenlebens als ebenso aussichtslos erwiesen, wie, sagen wir mal, erfolgreich nach der Nagelschere zu fahnden. Ich versteckte die Zehen unter der Decke, kratzte mich an der Nase, gähnte. Dabei fiel mir ein, dass morgen Mittwoch war, ich nahm die Armbanduhr vom Nachttisch, heute war Mittwoch. Mittwoch hieß: Leichenwagen fahren. Mittwoch hieß: Tote wegpacken. Mittwoch hieß: schwarze Kleider anziehen. Mittwoch hieß: das Haus verlassen. Mittwoch hieß: unablässig den Anschein erwecken, gleichzeitig freundlich, mitfühlend und betroffen zu sein. Mittwoch hieß: abstumpfen. «Es ist, als ob mir jeder Tote, den ich sehe, etwas nimmt.» Heinz waren solche Überlegungen fremd. «Nimmt?», hatte er befangen gefragt. Ernste Gespräche machten ihn verlegen; am unangenehmsten war es für ihn, wenn ich vom Schreiben oder der Uni erzählte; das tat ich daher nur in Notfällen. «Was nimmt?», wiederholte er ratlos, und ich bereute, überhaupt damit angefangen zu haben. Ich murmelte: «Irgendwas verschwindet», ergänzte matt: «Hokos-pokus-verschwindibus!» und war heilfroh, dass keine weiteren Nachfragen kamen.
Susanne gegenüber gab ich vor, die Arbeit mit dem Tod ließe mich völlig kalt. Die Decke neben mir hob und senkte sich; Susanne hatte bereits geschlafen, als ich von zwei Bierchen aus Mollingers Eck zurückgekommen war. Sie schlief, wie üblich, auf dem Rücken, den Kopf in die Beuge des angewinkelten rechten Arms geschmiegt, das Kinn knapp über den Stoppeln der Achselhöhle. Ihr Gesicht sah friedlich aus, die Lippen glänzten leicht. Über die bloße Schulter und das Kissen ergoss sich langes dichtes Haar, ihre Haut roch nach Schlaf. Die Brüste, die sie für zu groß hielt, waren halb bedeckt, und über dem Saum der Sommerdecke erschien als mittelschwere erotische Versuchung dieser Nacht die bräunliche Rundung eines Warzenhofs. Ich legte das Buch auf den Nachttisch, bemühte mich, kein allzu schweres Beben zu erzeugen und beugte mich rüber zu Susanne. Feine kupferfarbene Härchen bedeckten ihren Körper, schimmerten im Licht der Nachttischlampe, vorsichtig zog ich an der Decke: Schwupp!, erschien die rechte Brustwarze, weiterziehen, schwupp!, sah ich die linke. Flache Höckerchen überzogen die Haut der Warzenhöfe, doch kaum traf sie der feine, feste Luftstrahl aus meinem angespitzten Mund, vergrößerten sie sich, schwollen an, die Höfe kontrahierten, ihr Durchmesser verringerte sich, und die Haut fältelte sich auf, bis sie in einer prallen, feucht glänzenden Form erstarrt war. Es fiel mir schwer, die Brustwarzen nicht zu berühren, aber da Susanne es nicht mochte, wenn man sie nachts weckte (und schon gar nicht aus erotischen Gründen), begnügte ich mich damit, sie ausgiebig zu betrachten. Bald schwollen die Brustwarzen wieder ab; Susannes Lippen öffneten sich mit einem klebrigen Schmatzen; ich griff nach einem Papiertaschentuch.
In Momenten wie diesem überstieg es mein Fassungsvermögen, dass eine so schöne Frau freiwillig mit mir zusammenlebte. Susanne war mit einundzwanzig trotz wütender Ermahnungen ihres Trainers aus der Handballmannschaft ausgetreten, hatte ihr Studium abgebrochen (dreieinhalb Semester Sport und Bio), ihr Kinderzimmer geräumt, ihre Heimatstadt verlassen, und zu dritt (Jens begleitete uns als blinde Lurchart) waren wir in den ersten Stock meines Elternhauses gezogen, während die Habseligkeiten der Bahlows noch in zwanglosen Grüppchen vor dem Haus zusammenstanden und auf den Möbelwagen warteten. Die Rückkehr ins Elternhaus war ein Vorschlag meines Vaters, der darin wohl die letzte Möglichkeit sah, mich aus der tödlichen Umklammerung einer Zweier-WG zu befreien, in der ich mich gemeinsam mit Achim langsam aber sicher ins Nirwana soff. Ich hätte übrigens nie mit Susanne zusammengelebt, schlimmer noch, sie wahrscheinlich niemals kennengelernt, hätte ihr Achim damals in Paris nicht so gut gefallen. «Heute doch nicht mehr!», hatte sie nach ihrem unbedachten Geständnis lachend beteuert. «Aber damals», sagte ich. – «Nur solange, bis ich mit dir allein im Hotelzimmer war.» Kalt und teilnahmslos sagte ich: «Ich bin also die zweite Wahl.» – «Nein, das bist du nicht, und du weißt das ganz genau! Mensch, du kannst mir doch keinen Strick draus drehen, dass mir vor Jahren jemand anderes mal ganz gut gefallen hat!» Mir behagte nicht, dass sie bewusst vermied, Achims Namen auszusprechen. «Wer hat dir vor Jahren mal ganz gut gefallen?», bohrte ich. «Wer hat dir damals in Paris mal ganz gut gefallen?» Ich wollte, dass sie Achims Namen aussprach, jetzt sofort, alles wollte ich wissen, alles wollte ich hören, sie musste Achims Namen in den Mund nehmen, musste sich zu ihrer Schuld bekennen, den Namen, den Namen, ich wollte sie den gottverdammten Namen aussprechen hören, und als ich meine Frage zum vierten Mal wiederholte, nun mit verstellter Stimme, stand Susanne auf und verließ das Wohnzimmer.
Dass solche Streitereien im Hause Fahlmann an der Tagesordnung waren, hätte Heinz’ Weltbild erschüttert: Für ihn war Susanne eine Göttin, und die Tatsache, dass ich mit ihr zusammenwohnte, was mich dazu berechtigte, sie nackt unter der Dusche zu sehen und mit ihr im selben Bett zu schlafen, erhob mich in den Rang eines Halbgotts, dem man so viel wie möglich über das Alltagsleben der Göttin entlocken musste; etwas, das Heinz in der entwaffnenden Unschuld des Ahnungslosen fortgesetzt versuchte, indem er unsere Gespräche mehr oder weniger geschickt in pikante Gewässer steuerte: Wer von uns zuerst ins Bad gehe, wer morgens als Erster wach werde, Geburten seien doch was Fürchterliches, Mann! Er wolle keine Frau sein! Die müssen der die Poperzel wieder zunähen! Und die Nachgeburt ist so ein Oschi! Ob ich eigentlich bei Jens’ Geburt zusehen durfte? Und war ich mal schlecht gelaunt, folgerte Heinz natürlich, Susanne habe ihre Tage, und lachte: «Dann ist wohl Handbetrieb angesagt!» Manchmal tat er mir mit seiner unbeholfenen Sehnsucht, Intimitäten über Susanne in Erfahrung zu bringen, so leid, dass ich kleine «Geheimnisse» preisgab. Etwa indem ich ihm berichtete, sie habe sich eine viel zu enge Jeans gekauft. Nach einer solchen Information konnte ich beobachten, wie hinter Heinz’ Stirn eine Maschinerie aus Bewunderung und Furcht zu werkeln begann. Furcht? Trifft es das? Hatte Heinz wirklich Angst vor Susanne? Ich denke schon. Er hatte zwar keine Probleme damit, ihr aus dem Wagen Zweideutigkeiten zuzugrölen, aber war er mit ihr allein im selben Zimmer, bekam er kalte Füße. Einmal hatte ich Großvater zum Augenarzt gefahren, während Heinz unseren Badezimmerboiler reparierte. Als ich zurückkam, empfing mich im zugequalmten Flur («Bei einer solchen Fummelei muss ich einfach fluppen!») eine verunsicherte Susanne: «Das war voll psycho! Der Heinz hat nicht ein einziges Wort mit mir gewechselt. Ist der irgendwie sauer auf mich?» – «Wer weiß!», sagte ich und behielt die Wahrheit für mich.
Ich betrachtete die tief und fest schlafende Schöne nicht ohne Neid, denn in den meisten Nächten hatten meine Gedanken freie Fahrt auf allen Bahnen. Erst huschten sie über den Jahrmarkt, lungerten an den Buden rum, vertrieben sich die Zeit mit Dosenwerfen, Luftgewehren und Zuckerwatte, dann fuhren sie auf den Karussells, bis ihnen schlecht wurde, und am Ende zog es sie magnetisch, Wolfgang, in die Geisterbahn. Hinter jeder Kurve lauerte derzeit ein Wolfgang. Als Skelett, als Toilettenpapier-Mumie, als zottiger Yeti. Doch am unheimlichsten war er als er selbst. Dachte ich an Wolfgang, musste ich an Susannes Arbeit denken. Dachte ich an Susannes Arbeit, musste ich an Wolfgang denken. Ich musste in diesem Sommer viel zu oft an Wolfgang und Susannes Arbeit denken.
Meine Frau arbeitete fünf Tage die Woche im Edeka-Lager. Von acht bis zwölf fuhr sie dort eine elektrische Ameise, lud irgendwelche Waren auf und karrte sie in der Gegend rum. Spannte sie ihren Bizeps an, konnte ich trotz Sargtragens nicht mithalten: Zack!, macht es, Susanne presst meinen Unterarm auf die Tischplatte, und Jens gibt ein kränkendes Krähen von sich. Für die vier Stunden Ameise zahlte man Susanne knapp sechzig Mark, nicht gerade viel, aber wenn sie nach Hause kam, zauberte sie stets Schmuggelware wie Kaugummis oder Zahnpasta aus den Jackentaschen. «Täglich gehn so viele Sachen zu Bruch, das fällt gar nicht ins Gewicht.» Sie zuckte mit den Achseln. «Außerdem macht das dort jeder!»
Neben mir tastete Susanne nach der Decke, ich breitete sie über ihren Busen und zog mich auf meine Seite zurück. Meine Füße zeigten nach Westen. Dort schützte mich eine fensterlose Wand voller Bücherregale vor dem Anblick des Beerdigungsinstituts. Sagt er uns, welche Bücher im Schlafzimmer stehen? Ja, das tut er, aber er tut es nicht gern. Hier standen hauptsächlich Science-Fiction- und Kriminalromane, die nicht ins Wohnzimmer durften. Niemand brauchte zu wissen, was ich exzessiv las. Mein Kopf zeigte auf den begehbaren Einbauschrank; er nahm die Ostwand gänzlich ein; Schiebetüren, Mottenkugeln, Klamotten, langweilig. Nordnordwest erhob sich die glückliche Insel meines Lesesessels, hartnord spiegelte sich die Glühbirne der Nachttischlampe in einem vorhanglosen Fenster, südwestlich erstreckte sich das Geröllfeld von Susannes abgelegten Kleidern bis zur Schlafzimmertür. Totgeknüllte Blusen streichelten flugunfähige BHs, Hosen versuchten sich vergeblich aufzurichten, Socken krochen in verknotete Shorts, ich löschte das Licht, über der Wiese hinterm Haus formierten sich helle Punkte zu unbekannten Sternbildern, eine Wolke zerschnitt den Mond, Wolfgang, meine Gedanken entschlossen sich zu einer weiteren Fahrt in der Geisterbahn, ich knipste das Licht wieder an, nahm das Buch vom Nachttisch, war zu müde, um zu lesen, betrachtete das Titelbild. Mitchum sieht einfach nicht wie Philip Marlowe aus. Susanne mochte es ganz und gar nicht, wenn ich ihr solche Sachen erzählte. Das wäre klugscheißerisch. So ein Unfug! «Wenn du wissen willst, was klugscheißerisch ist», hatte ich mich einmal empört, «dann hör dir das an!» Und ich improvisierte: «Dass ich ein Frosch sei, / Behauptetest du. / Das mag wohl sein. / Ich sag nicht ja, / Ich sag nicht nein.» – Susanne dachte angestrengt nach, man konnte förmlich Rad in Rad greifen sehen, und sagte dann: «Du Vollidiot!» Ihre Arbeitskollegen hielten mich auch für einen Vollidioten, aber damit konnte ich leben, beruhte es doch auf Gegenseitigkeit. Ich verstand nicht, wieso Susanne Wert darauf legte, die Mittagspause mit ihren Kollegen zu verbringen. «Kümmer dich um deine Angelegenheiten», hatte sie gesagt, als ich mit ihr darüber reden wollte, «und komm bloß nicht wieder auf die Schnapsidee, mich auf der Arbeit zu überraschen!» Das hatte ich tatsächlich einmal getan – ein Fiasko! Wenige Minuten nach zwölf parkte ich den Leichenwagen unweit des Edeka-Lagers in einem Wendehammer und ging die letzten Meter zu Fuß. LKWs brausten vorbei, es gab keinen Bürgersteig, Steinchen spritzten. Als ich mich dem Schlagbaum näherte, hob er sich automatisch. Dahinter mündete die Zufahrtsstraße in eine rissige Betonfläche, wo Dutzende von LKWs die langgestreckte Rampe des Lagers umschwirrten. Befehle wurden gebrüllt, näher ran, noch näher, stopp, nicht zu nah, ich stieg eine steile Metalltreppe ohne Geländer hoch, öffnete eine Stahltür und befand mich in einer Vorhalle, von der zahllose Gänge abzweigten: Gänge mit Süßigkeiten, Gänge mit Getränkekästen, Gänge mit Dosenfisch, Klopapier und Scheuermilch.
Durch das verzweigte Labyrinth, das mich an die Szenarien erinnerte, mit denen Jens seinen Gameboy fütterte, huschten Ameisen; Gabelstapler kurvten auf den Linien unsichtbarer Schnittmuster durch die fensterlose Halle; Zombies sprangen ab, hetzten zur Rampe, beluden die LKWs. Zombies nannte Susanne diejenigen ihrer Kollegen, «die 150 % arbeiten», sie selbst kam meist «auf 110 %», außer an dem Tag, als sie sich «am Glasbruch» den Zeigefinger aufgeschnitten hatte. Das mit den Prozentzahlen habe ich nie richtig verstanden. Ist auch nicht weiter wichtig. Kann also getrost vergessen werden. «Ich suche eine Frau Susanne Fahlmann.» – «Kantine», sagte das leere Gesicht. «Macht Mittag.» Die Kantine erwies sich als schmaler Schlauch von Raum, der lediglich einer Selbstbedienungstheke und einer Reihe Biertische mitsamt Bänken Platz bot. Zusammen mit mir hatte eine dicke Frau den Raum betreten und füllte ihn nun dünstend aus. Waden wie Keulen, Brüste wie geplatzte Airbags, das Beinfett hing ihr als schlechtsitzender Fleischstrumpf über die Sandalen. Hier also verbrachte Susanne ihre Mittage! Ich sah feixende Gesichter, sah verlebte Gesichter, sah dumme Gesichter (leicht zu erkennen am stumpf vorgereckten Kinn), sah platte Nasen, sah trübe Augen, sah mittendrin meine Susanne.
Sie erschrak, als sie bemerkte, wer da hinter den Rückenfalten der Fetten hervorspähte, hatte sich jedoch gleich wieder im Griff und winkte mir zu. Mit eingezogenem Bauch quetschte ich mich an der lawinengleichen Erscheinung vorbei, grüßte tapfer in die Runde, setzte mich zu Susanne und schnorrte aus Verlegenheit eine Zigarette von einer der Plattnasen. Stille. Seit ich mich an den Tisch gesetzt hatte, redete keiner mehr. Susanne aß hastig ihren Tomatensalat, ohne den Blick vom Schälchen zu heben. Neben ihr saß ein junger Mann mit weißem Haar. Im Unterschied zu den übrigen Tischgenossen beobachtete er mich scharf, fast abschätzend. Das war wohl dieser Wolfgang, der immer bei uns anrief. Rief er an, klang Susannes Stimme anders als sonst. Sie lachte zu viel und zu laut, und kam sie danach zurück ins Wohnzimmer, machte sie ein Gesicht, als hätte sie etwas zu verbergen; aber weil es schon viele Gespräche über meine «krankhafte Eifersucht» gegeben hatte, riss ich mich zusammen, ließ den Albino weiterglotzen und schritt selbst dann nicht ein, als er meine Frau «Susi» nannte. Sein «Susi» klang nach Ehebruch. Ich drückte die Zigarette in einem Unterteller aus, setzte den Weißhaarigen an die Spitze der Schwarzen Liste und sagte kühl und beherrscht: «Schatz, wir müssen los!» Noch niemals zuvor hatte ich Susanne «Schatz» genannt.
Sie bewegte sich im Schlaf, drehte sich auf die rechte Seite, die Decke rutschte von der Schulter, und die unterbrochene Linie der Wirbeldornfortsätze straffte die Haut zwischen den Schulterblättern: eine Reminiszenz an unsere Sterblichkeit in Knochensprache. Ich deckte ihren Rücken zu. «Du bist noch wach?», fragte sie halb im Schlaf. Ich nickte. Dann fiel mir ein, dass sie mein Nicken nicht sehen konnte, und flüsterte: «Ja, aber ich mach jetzt das Licht aus.» Die Nachttischlampe erlosch, und während sich nordnordwest die beleibte Kontur des Lesesessels aus der Schwärze schälte, erinnerte sich das Schlafzimmer an die fürchterliche Heimfahrt. «Wenigstens bist du nicht mit diesem Ding vorgefahren», hatte Susanne gesagt, als sie sich auf den Beifahrersitz des Transits schwang. Ich verwandelte den Blinker in eine tickende Uhr, Rückspiegel, Seitenspiegel, ich fuhr an, beschleunigte, überholte einen LKW, schaltete in den zweiten Gang, fragte: «Was magst du an diesen Menschen?» – «Wie meinst du das?» – «Die nennen dich Susi.» – «Ja, und?» – «Was ist ein Susi?» – «Hahaha!», ärgerte sich Susanne, starrte aus dem Fenster. Ich musterte sie verstohlen von der Seite: Sie sah großartig aus. Tu es endlich! Jetzt mach schon, du Feigling! Und ich gab meiner Stimme diesen nachsichtig herablassenden Tonfall, den Susanne so hasste, und fragte: «Sag mal ehrlich! Würdest du auch gerne von mir Susi genannt werden?» – «Ach, halt die Klappe!»
Ihr Umgangston war merklich rauer, seit sie mit diesen Menschen zusammenarbeitete. Wie gerne hätte ich sie nun gefragt, ob sie allein wegen Jens bei mir bliebe – aber was, wenn sie ja sagte? «Es sollte eine Überraschung sein.» – «Klasse.» – «Das mach ich jetzt täglich.» – «Klasse.» – «Ich bring Heinz mit und wir tragen dich im Sarg raus.» – «Toll», sagte Susanne und versuchte sich an einem Lächeln. Ich akzeptierte das Friedensangebot und schlug in gespielter Begeisterung vor, Jens von der Schule abzuholen. Der habe nämlich keine solchen Schwierigkeiten mit Leichenwagen wie sie, und diese unbedachte Äußerung, Zigarette, brachte das Fass, Glas Milch, beinahe wieder zum Überlaufen, Glas Milch und Zigarette … jetzt. Vier tastende Schritte West. Vier zaghafte Schritte Süd. Umrunden Sie das Bett, ohne sich die Schienbeine zu prellen, und nehmen Sie Kurs auf die Tür im Südosten des Schlafzimmers! Ich hob die Füße kaum vom Boden, Spitzbergen, Spitzbergen, wir fahren nach Spitzbergen, meine Hausschuhe bahnten sich, kleine Eisbrecher, den Weg durch Susannes Krempel, im Flur harrte ich lauschend aus, Jens hatte einen leichten Schlaf, und erst als es im Kinderzimmer weiterhin still blieb, ließ ich mich vom fahlen Rechteck der offenen Küchentür verschlucken. Silberfischchen auf der Flucht, der Kühlschrank öffnete sich, übergoss den gekachelten Fußboden und die gestreiften Beine meiner Pyjamahose mit käsigem Licht, dem Türfach entschwebte eine Packung Milch, dann saugte die zufallende Tür das Licht zurück ins grönländische Innere. Erstarren. Lauschen. Leiser sein! Ich nahm ein verhalten klirrendes Glas aus dem Schrank über der Spüle, wunderte mich, dass beim Öffnen der Schranktür nicht ebenfalls ein Licht anging wie im Kühlschrank, schenkte das Glas voll, lehnte mich an die Leibung des Küchenfensters.
Dort rauchte ich eine milde Zigarette (die Senior Service spare ich für feierliche Momente auf), trank die Milch in kleinen Zügen, gut gegen Sodbrennen, unten ging die Klospülung. Mutter war noch wach. Oft hörten wir sie pinkeln: mit sattem, unverklemmtem Strahl. Susanne: «Das macht die extra!» Ich: «Quatsch. Das hat sie früher nie gemacht. Wahrscheinlich lässt sie die Klotür offen, seit sie allein lebt, und vergisst, dass sie dadurch den Wohnungsflur in einen Resonanzkörper verwandelt.» Das Rauschen erstarb in den Rohren, und das Knistern der Zigarette wurde zum einzigen Geräusch der Nacht. Gegenüber erfüllte bläuliches Flackern Onkel Jörgs Wohnzimmer. Die Vorhänge waren zugezogen. Mutter hatte sich immer über «Onkel Jörgs Filme» aufgeregt. «Wir spielen nur Karten», rechtfertigte sich Vater. – «Von wegen!» Mutter lächelte anzüglich. «Ich weiß doch, was ihr treibt, wenn ihr drüben die Vorhänge zuzieht!» Es passte nicht zu Vater, dass er sich mit seinem Bruder Filme wie Das fröhliche Fotzentrio ansah. Der Titel ist keine Erfindung von mir. Ich hatte die Hülle dieses Films als Kind unter Onkel Jörgs Kommode entdeckt: Zwei splitternackte lächelnde Frauen zogen einer ebenfalls nackten Schwarzen, die sich spreizbeinig zwischen ihnen bückte und dem Betrachter zuvorkommenderweise das Hinterteil zukehrte, die Arschbacken auseinander.
Kaum vorstellbar, dass mein verklemmter Vater sich so etwas ansah! Normalerweise machten ihn bereits Kussszenen verlegen: Er verließ das Wohnzimmer, wenn ich mit Mutter Drei Engel für Charlie ansah (hier wurde lange und ausgiebig geküsst) – und dann heimlich rüber zu Onkel Jörg, fröhliches Fotzentrio und hoch die Tassen! Unten klapperte Katzentür Nummer Eins. Kam Vater aus dem Bad, hatte er – im Gegensatz zu Mutter – ein Handtuch um die Hüften geschlungen. Katzentür Nummer Zwei klapperte auf unserer Etage, und sofort schnurrte Om um meine Beine und rieb den Kopf mit berechnender Zärtlichkeit an den Waden, bis ich mich seiner erbarmte und einen Schluck der Milch in eine Untertasse gab. Kaum stand sie vor dem Kater, verlor er das Interesse daran und begann stattdessen seinen Schnurrbart zu putzen. Wegen dieses auffällig buschigen Barts hatte ich ihn Albert Schweitzer nennen wollen. Das schien mir passend. Außerdem gefiel mir die Vorstellung, dass sich mit dieser Namenswahl die Wiese hinterm Haus in Lambaréné verwandeln würde, Regionshauptstadt in Gabun, 26.300 Einwohner, Moschee, modernes staatl. Krankenhaus, Flughafen. Aber Susanne hatte natürlich was dagegen gehabt, die blöde Kuh!
Der Kater unterbrach das große Reinemachen, um mich hinter einem hochgereckten Hinterbein hervor argwöhnisch zu mustern. «Milch», erklärte ich geduldig auf die Untertasse zeigend. «Feine Milch. Das mögen Katzen.» Ich nahm einen tiefen Zug, löschte die Glut im Aschenbecher. Die Augen des Katers reflektierten das schwache Licht in der Küche. Dann senkte er den Blick, die Pupillen wurden groß und dunkel, und mit einem zum Fragezeichen gekrümmten Schwanz stolzierte er Richtung Kinderzimmer davon, wo er, wenn er nicht auswärts schlief, seine Nächte verbrachte. Er weckte Jens nie auf. Selbst morgens ließ er ihn weiterschlafen und machte vor unserer Schlafzimmertür solange Rabatz, bis der gute alte Onkel Dosenöffner, der auch sehr zäh sein konnte, endlich aufstand, um dem Pelzwecker eine stinkende Büchse Katzenfutter zu öffnen. Lassen Sie sich nicht von der Munterkeit des Stils täuschen. Erst später entdeckt man im Anfang den Plan. Sagen die, die es wissen müssen. Hoffen wir, sie sind ehrlicher, als ich es bin.
Fahlmann stellte das Glas auf einen Stapel schmutzigen Geschirrs, leerte den Aschenbecher, nahm sich vor, morgen den Müll runterzubringen, Mittwoch, im Flur stand der Kater und starrte. Fahlmann, Mittwoch, starrte zurück. Mit einem empörten Maunzen verschwand Om in Jens’ Zimmer. Mittwoch. «Sie sind Philip Marlowe, ein Privatdetektiv?» – «Sehn Sie nach.» Als ich Montemar Vista erreichte und es in dem Kriminalroman bereits zu dämmern begann, hielt ich das für einen guten Anlass, das Licht zu löschen und mir meinen Tod vorzustellen. Heinz stehen die Tränen in den Augen. «Oh, Gott!» Er wendet sich ab und legt Onkel Jörg den Kopf auf die Schulter. «Wieso er? Wieso ausgerechnet er?»
Sogar im Halbschlaf merkte ich, dass die Dialoge eine Spur zu pathetisch ausfielen, hatte aber weder Zeit noch Lust, mich um solche Bagatellen zu kümmern, denn schon wirft sich eine weinende Susanne über den Sarg. Vater (das Gesetz von Zeit und Raum hat längst seine Gültigkeit verloren) nimmt Mutter in den Arm: «Er war ein guter Junge!», die Sonne verfinstert sich, eloi, eloi, lema sabachtani, und lässig auf einen Grabstein gestützt prahlt Winkler vor den versammelten Reportern: «Naturellement, mesdames et messieurs! Natürlich hat er mich autorisiert, seine Werkausgabe herauszugeben.» Aber das ist noch gar nichts! Während meiner Schulzeit hatte mich meine überschwängliche Begeisterung fürs Dramatische zu weitaus gewagteren Szenen hingerissen. Klassenarbeit Erdkunde, splitternd fliegt die Tür auf, ein Polizist mit vernarbtem Gesicht hechtet ins Klassenzimmer der 8a, rollt sich geschickt ab und lässt die Mündung seiner Waffe über die Bankreihen streichen. Hinter ihm erscheinen weitere Polizisten. «Wer von Ihnen ist Georg Fahlmann?» Ein hagerer, finster dreinschauender Kommissar im Trenchcoat tritt vor. – «Wer will das wissen?», frage ich. – «Wir brauchen Ihre Hilfe, Fahlmann!» Plötzlich fährt er herum und schnappt: «Wer ist dieser Knilch?» – «Das ist Herr Schöppke.» Ich mache eine abfällige Handbewegung. «Ein Erdkundelehrer.» Urkunden werden überreicht, Handgranaten detonieren, Maschinengewehrgarben zerfetzen meine Mitschüler, ich steige in den wartenden Jeep. Bereits auf dem Lehrerparkplatz fallen die ersten Schüsse. «Das ist ein Hinterhalt. Sie hat ihnen alles verraten. Man darf niemals – Papa?» Ich schaltete das Licht an. Es war Jens.
«Was gibts?»
«Om stinkt.»
«Aha.» Wieso steht er auf meiner Bettseite, obwohl sich Susannes Seite näher an der Tür befindet? «Nach was stinkt er denn?» Jens kicherte vielsagend, und ich brachte erst ihn ins Bett, packte dann Om im Genick, trug ihn ins Bad und duschte sein Hinterteil mit lauwarmem Wasser ab. «Was warn los?», fragte Susanne, als ich mich wieder hinlegte.
«Schlaf weiter!», sagte ich.
«Gute Nacht!», sagte ich.
Pause. «Gute Nacht!», sagte ich etwas lauter.
«Gute Nacht!», sagte Susanne.
«Haben Sie Interesse, für das FBI zu arbeiten?», fragte der hagere Kommissar und sah mich abwartend an.
3Ich bin der einzige Mensch, über den ich nie einen Roman schreiben könnte, bekannte ich in jenem Sommer meinem Notizbuch. Ich habe keinen hervorstechenden Charakterzug, nichts, bei dem der Leser sagen würde: «Aha, das ist Georg Fahlmann!» Ich bestehe aus unverbundenen Taten, Gedanken, Ängsten und einem dürren aber leidlich gesunden Körper. Ich stehe morgens am Fenster und werde nicht wach, ich schlafe abends schlecht ein und stelle mir meine Beerdigung vor. Ich habe nicht einmal einen Tic wie jede siebte Figur bei Thomas Mann, und oft weiß ich nicht, wer oder was ich eigentlich bin. Ich verschwende viel Zeit meines ereignislosen Lebens, mich an ereignislose Zeiten zu erinnern und mir etwa zu überlegen, wieso es mich belastet, dass ich im Sportunterricht nie die Kletterstange hochgekommen bin. Nachtrag: Eben ist mir noch jemand eingefallen, über den ich nie einen Roman schreiben könnte: unser neuer Briefträger.
Das letzte Wort erhebt sich in Großbuchstaben über die zittrigen Krakel meiner Handschrift. Und dass es mit zornigen Strichen eingekästelt ist, zeigt mir, wie schwer mir der Mann damals zusetzte. Heute erinnere ich mich der Gefühle und Empfindungen meines früheren Ichs mit gewisser Wehmut, obiger Notiz, nebenbei bemerkt, mit ungläubiger Scham: Die Klage, ein ereignisloses Leben zu führen, erscheint mir leichtfertig, denn nach allem, was mir inzwischen widerfahren ist, hat die Verknüpfung der Worte «ereignislos» und «Leben» einen fast idyllischen Beigeschmack. Eigentlich ist es unerheblich für mein Vorhaben, aber da ich den Briefträger nun aus den Kellern der Erinnerung hinauf ins Parterre gezerrt habe, will ich ihn da nicht verloren stehen lassen – inmitten der abgedeckten Sessel und Stühle. Anfangs hatte ich gedacht: Der lernts noch, aber als Wochen und Monate ins Land gingen und ich meine Briefe weiterhin in der Nachbarschaft zusammensuchen musste, weil er meine Post nach mysteriösen Kriterien auf fremde Briefkästen verteilte, platzte mir der Kragen. Ich wartete einen günstigen Zeitpunkt ab, um ihm die Leviten zu lesen, und als ich ihn einige Tage später die Straße entlangwatscheln sah (ich kam mit dem Leichenwagen vom Getränkemarkt Zarth zurück), dachte ich: So Freundchen, jetzt bist du fällig! Ich fuhr an ihm vorbei, parkte zehn Meter weiter. Ein Dackel, der vor der Metzgerei Kundel an einem Laternenmast festgebunden war, wir müssen draußen bleiben, mahnte das Schild auf der Glastür, Wurst, Wurst, Schinken, lockte das Innere des Ladens, beobachtete, wie ich ausstieg und mich in Halbstarkenmanier an die geöffnete Wagentür lehnte. Der Bauch des Dackels hing durch, einige Häuser straßab verschwand der Briefträger hinter einem Zaun, tauchte wieder auf, bog in einen Gartenweg, seine Mütze schwamm auf einer Hagebuttenhecke, und schon saß sie wieder auf seinem Kopf. Ich überlegte, was ich sagen sollte. Ohne stehen zu bleiben, wühlte der Briefträger in seiner schweren Tasche. Ein Ausspruch Philip Marlowes geisterte mir durch den Kopf: Ich hör die Parzen mit den Scheren klappern, aber bestimmt wusste der Briefträger nicht, was Parzen sind. «Die was?», würde er fragen und damit alles ruinieren. Es gab andere Möglichkeiten. «Ab heute können Sie Ihre Briefe in der Hölle austragen.» Schrotflinte unter die Nase und abgedrückt. Hurra, Aufregung, das Dackel-Frauchen verließ die Metzgerei, hurra, wuff, hurra, jetzt fessle ich mich mal mit meiner Leine, Wurst, Wurst, Schinken, «halt mal bitte still», Wurst, sie band den Köter los, Schinken, wuff, prima Schinken, ist das etwa Fleischwurst, «hier, mein Schatz», sie hielt ihm ein Stück Wurst unter die Schnauze, und endlich näherte sich der Briefträger, links die lederne Posttasche, rechts eine böse Schlagseite.
«Entschuldigen Sie», begann ich zaghaft, «ich muss mir die Post immer in der Nachbarschaft zusammensuchen.» Das Ärgernis schnaufte, es war sehr jung, es war sehr fett, es sah mich verständnislos an. Frau Kundel glotzte aus dem Schaufenster der Metzgerei; ich nickte ihr freundlich zu. Dem Briefträger hing hellblondes, verschwitztes Haar in die Stirn, über seiner dicken Oberlippe spross das schüttere Bärtchen eines Dreizehnjährigen, und dass er trotz akuter Atemnot eine Zigarette rauchte, machte mich betroffen. Ebenfalls milde stimmte mich sein kränkliches Aussehen: Unter den Fischaugen glänzten feuchte Ränder, das bartlose Fleisch der Wangen und des Halses war leicht gerötet. Er nahm die Zigarette aus dem Mund und fragte: «Ihre Post zusammensuchen?» Ich würde ihn gar nicht erst auf die Schwarze Liste setzen. «Bei den Nachbarn», erklärte ich. «Die Post ist nicht in meinem Briefkasten.» – «Ah, ich mach was falsch.» Er seufzte so ausgiebig, dass sich seinem Doppelkinn die Gelegenheit bot, nach dem Krawattenknoten zu schnappen. «Sie ahnen nicht, wie oft mir so was passiert. Tut mir sehr leid. Ist mein Fehler. Ich versprech Ihnen, es wird nie wieder vorkommen!» – «So schlimm ist es auch nicht. Ich wollte nur …» – «Es wird nie wieder vorkommen! Wie war Ihr Name, sagten Sie?» – «Fahlmann. Georg Fahlmann.» – «Fahlmann», er schaute an mir vorbei, «vom», er las die Beschriftung des Transits: «Beerdigungsinstitut Georg Fahlmann.» Erst amüsierte es mich, dass er Gebr. für eine Abkürzung meines Vornamens hielt, aber dann begriff ich die Tragweite dieser Fehlleistung. Ich hätte ihn nie mit dem Transit abfangen dürfen! Nun hatte sich nämlich der durchaus klug kombinierte Zusammenhang Georg-Fahlmann-fährt-einen-Leichenwagen-auf-dem-sein-Name-steht in den Windungen seines Gehirns verhakt. Rasch versuchte ich zu retten, was noch zu retten war.
«Das mit dem Auto hat nichts zu sagen. Ich wohne zwar neben dem Beerdigungsinstitut Gebrüder Fahlmann», hierbei zeigte ich auf den Transit, «habe dieses Auto», ich zeigte wieder auf den Transit, «aber nur geliehen. Fahlmann. Das ist mein Name. Georg Fahlmann. Nebenan. Ich wohne ne-ben-an. Neben dem Institut. Also die Post bitte ne-ben-an in den Briefkasten werfen!» Der Briefträger quittierte den Dammbruch des Stausees von Informationistan mit einem Kopfnicken. Dann meinte er ernst: «Ich habe Post für Sie, Herr Georg Fahlmann», wobei es ihm in rührender Weise misslang, seiner Stimme einen amtlichen Tonfall zu geben. Er kramte in der Umhängetasche. Wieso benutzt er kein Wägelchen wie alle Briefträger? Die Tasche war vollgestopft. Außerdem stand eine Flasche Sprudel darin. Waldquelle. Mit wenig Kohlensäure. Der Anblick dieser Flasche erschütterte mich so sehr, dass ich mit einem harschen «Werfen Sie mir die Post doch einfach in den Briefkasten!» in den Transit stieg.
Am Nachmittag holte ich die Post bei Onkel Jörg ab.
«Über was regst du dich eigentlich so auf?», fragte Susanne.
«Ich rege mich darüber auf, dass ich mich nicht mehr über etwas aufregen kann, über das man sich eigentlich aufregen müsste. Aus irgendwelchen sentimentalen Gründen …»
«Wer ist man?»
«Man bin immer ich.» Man stand am Küchenfenster, sah aber nicht hinaus, sondern Susanne und Jens an, die frühstückten. «Ich rege mich darüber auf, dass die Post nicht kommt.»
«Aber du regst dich nicht mehr über den Briefträger auf.»
«Nein. Irgendwie tut er mir leid.»
«Weil er so fett ist?», fragte Jens aufgeregt.
«Auch deshalb», sagte ich.
«Und die Sprudelflasche?», hakte er nach.
«Die hat dem Fass die Krone ins Gesicht geschlagen.»
Jens lachte übertrieben, um zu zeigen, dass er sich auskannte. Sie quälten ihn seit einigen Wochen mit Sprichwörtern. Wer im Glashaus sitzt, fragte die linke Spalte, und in der rechten musste mein Sohn unter so verlockend blöden Angeboten wie ist seines Glückes Schmied oder hat Gold im Mund die richtige (aber ernüchternd langweilige) Satzhälfte aufspüren. Seine Lehrerin strengte sich mächtig an, ihn nach allen Regeln der Kunst zu verblöden. Wie konnte sie einem Siebenjährigen Unfug vom Kaliber eines einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul beibringen, ohne ihm zu erklären, dass es sich bei einem Gaul um ein Pferd handelt, dass man das Alter eines Pferds am Gebiss bestimmen kann, dass man also nicht schauen darf, wie alt das Pferd ist, das man geschenkt bekommt, um den Schenker nicht zu kränken, und so weiter, und so weiter, und so weiter.
«Einem geschenkten Barsch», sagte ich, «schaut man nicht in den …»
«Georg!», sagte Susanne.
«Arsch!», brüllte Jens. Kakaogetränkte Krümel flogen aus seinem Mund.
«Nicht mit vollem Mund sprechen!», rief Susanne.
«Glashaus währt am längsten», ergänzte ich selbstgefällig und zwinkerte Jens dabei zu.
Ich hätte damals gerne mehr Zeit mit ihm verbracht, aber morgens musste er in die Schule, und sie brachten ihm Blödsinn bei, nachmittags machte er mit «Oma Marianne» blödsinnige Hausaufgaben, um den vormittäglichen Blödsinn zu vertiefen, und danach spielte er draußen mit Florian, bis um sechs Uhr die Glocken läuteten. Abends hingegen las ich ihm vor oder bemühte mich, ihm das beizubringen, was seine Lehrerin nicht wusste oder für unwichtig hielt. Zum Ereifern gab es für mich kein besseres Thema als Jens’ Hausaufgaben. Susanne regten andere Dinge auf. Drei Häuser weiter hielten sie Hühner. Kurz nach seiner Einschulung hatte Jens herausgefunden, dass er den Hahn zum Krähen bringen konnte, indem er mit meiner Faschingstrompete trötete, und eines Morgens ließ er sich von mir wecken, und wir schlichen um vier Uhr dreißig zum Flurfenster, Jens trötete, und kurz darauf hörten wir ein fassungsloses Krähen. Der Hahn gab keine Ruhe mehr, bis es hell wurde. Susanne hatte es unverantwortlich gefunden, dass ich «solche Aktionen» förderte, aber wie oft im Leben bietet sich einem schon die Gelegenheit, einen Hahn zu wecken?
«Irgendwann werde ich es ihm beigebracht haben.»
«Wem was?», fragte Susanne.
«Dem Briefträger», sagte ich, «das mit der Post.»
«Deine Probleme möchte ich haben.»
«Und ich deine.» Ich trat hinter sie, hob ihr Haar an und küsste sie ins Genick: Ihre Haut war zart und roch gut. Jens kicherte, wie immer, wenn sich seine Eltern küssten. Susanne lächelte, ich stellte mich wieder ans Fenster, drüben rannte eine nackte Gestalt durch die Wohnung. Die Etage über dem Beerdigungsinstitut hatte beide Augen weit aufgerissen: Onkel Jörg lüftete gleichzeitig Wohn- und Schlafzimmer. Das linke Fenster zeigte mir Couch und Fernseher, das rechte ein zerwühltes Doppelbett. Die nackte Gestalt hatte das Schlafzimmer verlassen, doch leider war sie nicht mehr im Flur hinter der offenen Wohnzimmertür erschienen: Das Badezimmer (von dessen Existenz nur der rostnasige Propeller eines Ventilators zwischen den Fensteraugen kündete) hatte sie verschluckt.
«Onkel Jörg läuft nackt durch die Wohnung!», sagte ich.
«Wo?» Jens presste die Nase an die Scheibe.
«Im Schlafzimmer. Vielleicht sieht man ihn gleich wieder.»
Doch leider blieb Onkel Jörg verschwunden. Nach einer Weile setzte Jens sich wieder enttäuscht an den Frühstückstisch und erweckte den Anschein, das letzte Drittel des Brötchens aufzuessen.
Heinz kurvte in den Hof. «Heinz ist da», sagte ich.
«Nackt?», fragte Jens hoffnungsvoll.
«Nein. Viel zu früh. Ich hab erst zwei Tassen Kaffee intus.»
Heinz nahm den Helm ab, brüllte etwas zu mir hoch.
Ich öffnete das Fenster. «Was ist denn los?»
«Früher Termin im Evangelischen. In einer halben Stunde will ich dich im verfickten Büro sehen. Und zieh dir was an, du fauler Sack! Im Schlafanzug nehm ich dich nicht mit.»
«Das Schildchen schaut aus deinem T-Shirt», sagte Susanne.
«Macht nix», sagte Jens. «Hast du gehört? Heinz hat ein schlimmes Wort …»
«Das macht wohl was», sagte Susanne.
«Was heißt ‹intus›?», fragte Jens.
Ich sah wieder aus dem Fenster. Mein Roman machte mich wahnsinnig. Es war eine solche Tortur, berühmt werden zu wollen. Allein deshalb verkniff ich mir heldenhaft dümmliche Ideen und alberne Scherze und verzichtete sogar auf lustige Lieder und Gedichte: Das harte Los desjenigen, der endlich ernst genommen werden will, aber nicht weiß, ob es sich überhaupt lohnt, ernst genommen zu werden. Jens zupfte an meinem Ärmel. «Hast du ihn nochmal gesehen?»
«Nein. Onkel Jörg ist jetzt bestimmt schon angezogen.»
«Bad ist frei!», rief Susanne.
Ich checkte mit Jens noch flott den Inhalt des Ranzens, dann betrat ich das Badezimmer, ein Schemen im beschlagenen Spiegel, feuchte warme Luft, das Pappröhrchen einer Klopapierrolle am Halter, Haare, überall Haare, ich zog die Spülung, man konnte Susannes Haare wie Tang aus der Badewanne fischen, ein nasses Handtuch in der Ecke, ich hob es auf und hängte es an den Haken. Es ist noch ein Tasten, aber ich verfolge ein Ziel, ja, zum ersten Mal seit langer Zeit verfolge ich ein Ziel. Kleine Pause. So, hier bin ich wieder. Machen wir weiter! Seit diesem Mittwochmorgen nahm mein Leben zunehmend groteskere und beunruhigendere Formen an. Der zaghafte Auftakt meiner Schwierigkeiten, den ich vor der gläsernen Theke einer Bäckerei zu lokalisieren glaube, ist dem Lösen der Leinen eines Hochseeschiffs vergleichbar, und mit gedrosselter Geschwindigkeit verlässt es den Hafen, um in tieferen, fast schwarzen Gewässern allmählich Fahrt aufzunehmen.
Natürlich weiß ich, dass es unmöglich ist, einen dermaßen vagen Zeitpunkt wie den «Auftakt meiner Schwierigkeiten» zu bestimmen (sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht), aber jedes Mal, wenn ich über den steil absteigenden Zickzackpfad nachdenke, den mein Leben seither eingeschlagen hat, fällt mir dieser Mittwochvormittag ein, an dem wir so ungewohnt früh mit der Arbeit begannen. Denken heißt vereinfachen, behauptet Strigaljow, und ich glaube in seinem Sinne zu sprechen, wenn ich daraus folgere: Erinnern heißt noch mehr vereinfachen. Im wirklichen Leben gibt es keine Schlüsselerlebnisse. Ein Kind kauft seinem Vater ein rotes Plastikfeuerzeug zum Geburtstag, findet aber erst als Erwachsener heraus, dass sich dieses Geschenk unmerklich in die Drehscheibe eines Sackbahnhofs verwandelt hat, eine dieser Plattformen, auf der die Lokomotive mal in diese, mal in jene Richtung geschwenkt wird. Oder beginnt die Drehscheibe erst im Moment des Erinnerns zu rotieren? Ich weiß es nicht. Feste Meinungen lösen in mir ein gewisses Unbehagen aus, vor allem, wenn sie mit meiner Person verknüpft sind. Letzten Endes weiß ich nur, dass dieser Mittwoch ein gewöhnlicher Arbeitstag war. Vielleicht fing alles früher an?
Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr verstricke ich mich, Schiffe, Drehscheiben, Lokomotiven, wahrscheinlich ist es sinn- und ergebnislos, überhaupt einen Anfang finden zu wollen (einen Anfang für was auch immer), werfen doch alle Geschehnisse ihre Angelleinen weit in die Vergangenheit zurück: Es handelt sich um dicke, straff gespannte Schnüre, die sich in der Zeit verlieren. Ihre Haken sind fest verankert, und auch dieser eine Mittwochmorgen baumelt an einem Haken, den ich mir gerne rostig und vom Salzwasser zerfressen vorstelle. Ich tauche am Seil entlang die Zeit hinab, Heinz hupte, ich band die Schnürsenkel, mit jedem Schwimmstoß erinnere ich mich genauer, rieche die Abgase des Transits, dessen Motor schon seit einigen Minuten läuft, tauche tiefer, das Wasser wird kühler, noch tiefer, und schon höre ich das Knirschen des Schotters unter den Sohlen, hörte es laut und ganz nah.
Heinz hupte erneut, ich stieg zu ihm in den Transit und schnallte mich an. «Wegen mir», sagte ich, «kanns losgehen, Keule.» Er mochte, wenn ich ihn «Keule» nannte (das erinnerte ihn an seine Zeiten als Kraftdreikämpfer). Er hieb mir mit der flachen Hand auf den Oberschenkel, trat das Gaspedal durch, ließ gleichzeitig den ersten Gang kommen. Reifen schleuderten Schotter auf, der Transit rumpelte über den Bürgersteig, legte sich quietschend in eine Rechtskurve: Wir waren unterwegs. Heinz hielt mir seine Zigaretten hin. Bei dieser Geste handelte es sich um einen in Ehren ergrauten Scherz. Ich hatte nur ein einziges Mal von seinen Filterlosen geraucht, und Heinz freute sich noch heute über meinen Hustenanfall. Ich tat so, als dächte ich über das Angebot nach (auch das gehörte zum Ritual) und lehnte dankend ab. «Na, nimm dir schon eine», drängte er.
«Für mich ist es noch zu früh zum Rauchen.»
«Ach, Quatsch!» Heinz hielt die rotglühenden Drahtkreise des Zigarettenanzünders an die Spitze der Gauloises. «Zum Rauchen isses nie zu früh!» Aschezähne fraßen sich ins weiße Papier, Heinz inhalierte, behielt den Rauch lange in der Lunge und ließ ihn mit einem wohligen Seufzen aus den haarigen Nasenlöchern strömen. «Du weißt gar nicht, was dir entgeht, Kleiner!» Maulfaul zuckte der Kleine mit den Achseln, Heinz schaltete das Radio an, fluchte unflätig, schaltete es wieder aus, langweilte sich demonstrativ und bedachte mich mit vorwurfsvollen Seitenblicken.
Aber ich war weder wach noch gesprächsbereit.
«Halt mal kurz an der Bäckerei.»
«Yup!» Heinz warf einen Blick in den Rückspiegel, trat auf die Bremse. «Na, da glotzt ihr blöd, ihr Mistböcke!» Der Transit kam mit tickender Warnblinkanlage mitten auf der Straße zum Stehen. «Is nich mein Bier, wenn irgendwelche Scheißkerle das Trottoir zuparken!» Heinz zog die Handbremse; den Motor ließ er weiterlaufen. Zwei ältere Damen unterbrachen ihr Schwätzchen und spähten zu dem lauernden Leichenwagen hinüber.
«Willst du auch was?», fragte ich.
«Nö», sagte Heinz. «Bin fett genug.»
«Wie du meinst.» Ich schlug die Wagentür zu, schlüpfte zwischen Stoßstangen durch, und endlich setzte der Kopf der Autoschlange, die sich hinter dem Transit gebildet hatte, zu einem halbherzigen Überholmanöver an. Niemand bedachte uns mit obszönen Gesten, niemand hupte, keiner lamentierte – am Steuer eines Leichenwagens darf man sich alles erlauben. Bürgersteig, Stufe eins, bereits auf der Treppe der Bäckerei Gallinger, Stufe zwei, begannen rosinengespickte, mandelbestäubte Monde mein Denken zu umkreisen. Ich nehme, Stufe drei, eine Schnecke, Ting, ein Schweinsohr, ein … ich starrte die neue Verkäuferin an.
«Eine Schnecke», stammelte ich, «ein Schweinsohr, ein …»
«Ja?»
«Zwei Schnecken, ein Puddingstückchen …»
Sie half mir: «Und ein Schweinsohr?»
Dankbares Nicken, schöne Brüste, die Kuchenzange griff viermal zu, das Mädchen hatte einen schlanken, sportlichen Körper, nascht bestimmt nie vom Teig, dachte ich verzaubert von der Anmut, mit der sie die Kaffeestückchen in die Papiertüte packte, höchstens achtzehn, schätzte ich, sie hatte die kräftigen, sonnengebräunten Unterarme einer Tennisspielerin. Wie zufällig berührten meine Fingerspitzen beim Zahlen ihre Handfläche, ein verwegenes Geldstück sprang auf die Glastheke, schwebte über den Kuchen, den Zöpfen und rollte davon, als ich danach griff. Verwirrt steckte ich mein ganzes Wechselgeld in eine verplombte Sammelbüchse. «Die armen Kinder», bemerkte ich. «Wenn man dieses Elend sieht», ich tippte an die Büchse, «weiß man erst, wie gut es einem selbst geht.» Die Verkäuferin sah mich befremdet an, und da ich keinen blassen Schimmer hatte, über was ich mit ihr reden sollte, verbreitete ich einige Dummheiten über das Wetter, und als meine Fähigkeiten, charmant über die Wetterlage zu dozieren, erschöpft waren, bezog ich die Kleine kurzerhand ein. «Sie freuen sich wahrscheinlich nicht annähernd so über gutes Wetter wie ich.»
Hinter ihr konnte ich in die Backstube sehen: Der Propeller eines Knetarms über der Metallwanne der Knetmaschine; Siebe und Brotschieber an der gekachelten Wand; ein weiß gekleideter Jemand, der nicht gerade aussah, als hätte er das Rad erfunden, machte die Tür von innen zu. Die Verkäuferin schluckte schwer. «Wieso kann ich mich nicht über gutes Wetter freuen?»
«Mmh», sagte ich im verzweifelten Bemühen, Zeit zu gewinnen. «Sie sind doch den ganzen Tag hier drinnen.» Damit wollte ich es bewenden lassen, aber weil sie mich immer noch verständnislos ansah, musste ich weiter ausholen. «Ich bin den ganzen Tag unterwegs. Verstehen Sie? Zwar mit dem Auto, aber man ist unterwegs. Man, das heißt in diesem Fall: ich. Ich bin also unterwegs, den», bloß nicht «lieben, langen» sagen, «ganzen Tag bin ich unterwegs. Im Freien.» Ich lachte herzlich, bis mir klar wurde, dass ich viel zu lange und viel zu laut lachte. Und worüber lachte ich überhaupt? Damit mir das ohnehin dünne rote Fädchen meiner Rede nicht endgültig zwischen den Fingern davonglitt, begann ich den nächsten Satz mit einem altklugen «Unterwegs zu sein …», doch diese drei Worte hatten es in sich: Sie mündeten geradewegs ins Leere. Unterwegs zu sein, ja was denn, was denn, hilfsbedürftig starrte ich ins Brotregal, unterwegs zu sein ist supergut? toll? fabelhaft? unterwegs auf jeden Fall? ist prima? allererste Sahne? in Biskin gebadet? glänzend? angenehm? gute Titten? unterwegs zu sein, bringt Segen? Ting!, rief die Ladenglocke, ich fuhr herum, kleiner Junge, Sommersprossen, für fünfzig Pfennig Colafläschchen. «Die hab ich früher auch gern gegessen», fand ich meine Sprache wieder, lächelte der Schönen zu, griff die Tüte, ging zur Tür, immer unterwegs, wünschte allen einen schönen Tag, Titten, blieb stehen, voll ins Maul, drehte mich um, denn das Wort «Wegschnecke» hatte sich in meinem Denken quergestellt, wieso Wegschnecke, wunderbare grüne Augen, wunderbare skeptisch dreinblickende grüne Augen, scheiße, warum bleibe ich gerade stehen, ungewöhnlich skeptisch dreinblickende grüne Augen, Wegschnecke, ich wünschte dem Jungen mit verschmitzter Stimme einen guten Appetit. Ting! Treppe runter. Autotür auf. Rein. Autotür zu. Wieso, zum Teufel, Wegschnecke?
«Mann, das hat ja ne halbe Ewigkeit gedauert!»
Ich legte die Tüte auf die Ablage vor mir und schnallte mich an.
«Sie haben ne neue Verkäuferin», sagte ich.
«Und?» Heinz scherte so abrupt aus, dass die Tüte auf den Wagenboden fiel. «Was ist mit der?»
Ich bückte mich nach den Kaffeestückchen, damit Heinz meinen Gesichtsausdruck nicht bemerkte, denn eine gewaltige Detonation hatte soeben mein Hirn in einen Bombentrichter enormen Umfangs verwandelt, aus dessen qualmendem Krater die Erkenntnis kletterte (wir müssen sie uns als abgerissene, ein weißes Fähnchen schwenkende Gestalt vorstellen), dass ich mich nicht gerade wie Don Juan benommen hatte. Wegschnecke, dachte ich. Schnecken aus der Bäckerei, dachte ich. Schnecken unterwegs, dachte ich. Wenn es darauf ankam, konnte auch ich witzig und charmant sein, aber nicht heute, nicht heute Morgen. Nur gut, dass ich in der schwarzen Jeans und dem Rollkragenpullover nicht wie der typische Angestellte eines Beerdigungsinstituts aussah.
«Würdst sie wohl gern mal flachlegen», sagte Heinz.
Ich reichte ihm kommentarlos das Puddingstückchen. Obwohl er nie etwas mitgebracht haben wollte, kaufte ich ihm immer ein Puddingstückchen, und er freute sich jedes Mal drüber wie ein Schneekönig. «Blinker setzen, du Arschloch!» Heinz überholte rechts, die Ampel sprang auf rot, «War orange!», Gas, Hupe, «Mösenalarm!» Er wich der strampelnden Radfahrerin aus und jagte Rivers of Babylon summend den Transit hoch in den vierten Gang, ohne dass das Getriebe ein einziges Mal mit den Zähnen knirschte. Dass Heinz so souverän Auto fuhr, lag eindeutig an seinem engen Verhältnis zu dem Wagen. Dieser Satz gefällt mir nicht. Klingt irgendwie bemüht. Stimmt. Ich bemühe mich. Das darf man ruhig merken. Ich habe keine Geheimnisse mehr. Wer Geheimnisse hat, muss auf seinen Stil achten. Doch mir geht es um mehr. Sprang der Transit nicht an (was im Winter häufig vorkam), redete Heinz ihm gut zu, und jeden Abend, nachdem er ihn in oder vor der Garage geparkt hatte, tätschelte er ihm zum Abschied die schwarz lackierte Flanke, um kurz darauf die Vespa mit einem Klaps auf den Hintern zu begrüßen. «Die fahrn heute wie die allerletzten Schweine!» Heinz leckte ein Puddingklümpchen vom Handrücken und steckte sich eine Zigarette an. Mittlerweile hatten wir die Vorstadt verlassen. Die Gebäude wurden ansehnlicher, Busse und Taxis tauchten auf, die riesigen Schilder von Einkaufsmärkten, Jugendliche mit verkehrtherum aufgesetzten Baseballkappen, Skateboards, Walkmans, Zeugen Jehovas, gut gekleidete Frauen, ich schmunzelte.
«Was gibts denn da so blöd zu grinsen?»
«Mir ist vorhin was Ulkiges passiert!» Ich berichtete vom nackten Onkel Jörg, woraufhin Heinz einen Witz über einen blutigen Tampon erzählte. Ich verzehrte derweil die zweite Schnecke; das Schweinsohr würde ich mir für später aufheben. Heinz trug Kniestrümpfe mit einem unerhörten Muster: Grüne Rauten erschreckten orangefarbene Rauten. Ihm war es egal, wie er rumlief, solange man keine dummen Witze darüber machte. Mein Freund Achim hatte einmal einen Scherz über Heinz’ «modische Kleidung» gerissen, und Heinz langte über den Tisch, packte Achim am Kragen und schüttelte ihn durch, bis ihm (Hörensagen) das Bier hochkam.
«Hast du noch was in deiner Tüte?»
«Ein Schweinsohr.»
Heinz dachte nach. «Halbes Schweinsohr?»
Ich brach das Kaffeestückchen in der Mitte durch.
«Bistn netter Kerl!» Drei heißhungrige Bisse und er wischte die Krümel vom Anzug, den Onkel Jörg, wenn Heinz es nicht hörte, den «Kommunionsanzug» nannte. Der Stoff spannte über der Brust und an den Oberarmen, ein Lederflicken schützte den rechten Ellenbogen, die Taschen waren ausgebeult. Normalerweise ragten überdimensionale, spitze Kragenzipfel über das Revers, aber heute trug Heinz ein Hemd mit diskretem Kragen, wahrscheinlich sogar das Hemd, das ihm Onkel Jörg zu Weihnachten geschenkt hatte. Mich rührte die Art, wie Heinz sich kleidete. So liefen Junggesellen rum, die sich morgens das Erstbeste aus dem Schrank nehmen, was ihnen in die Finger kommt. Die Sache hatte nur einen Haken: Heinz war kein Junggeselle. Als Kind entnahm ich einer Äußerung meiner Mutter, dass er verheiratet sei, ein Umstand, der mich in Erstaunen versetzte. Mir kam es merkwürdig vor, dass der Heinz, der abends auf der Vespa den Hof verließ, zu einem Zuhause fuhr, wo er ein eigenes Leben führte, das mit unserem keinerlei Berührungspunkte hatte. Heinz sprach nie von seiner Familie; ich fragte ihn nie danach. Einmal hatte ich ihn mit Frau und Kind in der Stadt gesehen, einen unbehaglich dreinblickenden Heinz und nicht den unkomplizierten Kraftmenschen, den ich kannte und mochte. Ich hatte mich im Eingangsbereich eines Spielwarengeschäfts verborgen, einem gläsernen Gang zwischen Schaufenstern voller Marionetten und Stoffgiraffen. Heinz ging dicht an mir vorüber, ich hätte ihn am Ellenbogen berühren können. Er sah erschöpft aus, ausgelaugt, in der linken Hand eine Einkaufstüte, an der rechten ein Kind, und dieses Kind, es war nicht zu erkennen, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelte, hatte einen so einfältigen Gesichtsausdruck, dass ich vor Bestürzung einige Schritte rückwärts machte. Und da sah mich das Kind! Es drehte den Kopf in meine Richtung und schaute mich an. Mit leerem, schläfrigem Blick sah es mich solange an, bis ich mich umdrehte und ins Spielzeuggeschäft flüchtete. «Ich höre.»
Ertappt fuhr ich zusammen. «Was?»
«Du hast mir noch was zu erzählen!»
«Was soll ich dir denn zu erzählen haben?», fragte ich heiser.
«Alles. Über die Bäckerei – und die Frauen …»
«Ich glaub, ich rauch erst mal ne Zigarette.»
«Aha!», lachte Heinz und hielt mir den Anzünder unter die Nase. «Endlich wirst du wach!»
Nach einigen Zügen begann ich mich erheblich wohler zu fühlen. Ich würde zwar fast den ganzen Tag im Leichenwagen sitzen, aber der Gedanke, dabei nicht nachdenken zu müssen, war befreiend. Körperliche Arbeit erledigt sich von selbst. Tote wegpacken, Särge zum Auto bringen, Särge aufladen, Särge abladen – kein Problem! Und abends mit Achim auf zwei oder drei Bier in Mollingers Eck. Es gab noch einen Unterschied zu den Schreibtagen: In dieser Nacht würde mir ausnahmsweise mal nicht die Einsicht den Schlaf rauben, wieder einmal mit voller Wucht an meine schriftstellerischen Grenzen geprallt zu sein und nicht länger so weiterleben und -schreiben zu können. Heute ist mein Ehrgeiz geringer. Vieles ist mir gleichgültig geworden. Dennoch genieße ich es, Sie ahnen ja nicht, wie sehr ich es genieße, jetzt einen Absatz zu machen und den nächsten mit einer nüchternen Beschreibung zu beginnen.
Die Leichenhalle des Evangelischen Krankenhauses lag im Keller eines Seitentrakts. Ein zur Tür hin offenes U kleiner, rechteckiger Milchglasfenster befand sich unter der Decke des fast quadratischen Raums. Eines der Fenster stand offen. Draußen sah man gestutzten Rasen und, vorausgesetzt man presste sich dicht an die Wand, den blauen, fast wolkenlosen Sommerhimmel. Für Winkler war meine Arbeit ein Quell steter Faszination, aber in den Leichenhallen, die ich besuchte, ging es nicht zu wie in den Horrorfilmen, von denen er schwärmte: «Nackte Frauen sind gut», behauptete er oft, «aber nackte, tote Frauen, die bärenstarken Leichenwäschern den Kopf samt Wirbelsäule abreißen, sind besser.» Ich mochte andere Filme. Nein, das ist gelogen. Ich mag keine Filme. Ich sah selten fern; ins Kino ging ich nie. Heute immer noch nicht. Wieso auch?
Winkler brachte das Gespräch regelmäßig auf meine Arbeit, obwohl ihm meine Informationen eine Illusion nach der anderen raubten. Die Leichen lagerten zum Beispiel nicht, wie er glaubte, in Kühlvitrinen. «Natürlich gibt es Kühlvitrinen in der Prosektion, aber darin bewahrt man nur die strittigen Fälle auf, bei denen es eventuell zu einer Obduktion kommen kann. In manchen Krankenhäusern gibt es nicht einmal eine Leichenhalle, und wir müssen die Toten in den Sterbezimmern der jeweiligen Stationen abholen, aber mir sind Krankenhäuser mit Leichenhalle lieber. Das ist diskreter.» – «So», nickte Winkler, «ich verstehe.» – «Was willst du noch wissen?» – «In welchem Zustand sind die Leichen?» – «Nun, das Pflegepersonal hat sie vor dem Aufbahren gewaschen. Man hat ihnen frische Binden angelegt und jedem eine Windel angezogen, damit niemand beim Transport ausläuft. Am besten sehen die Leichen aus, die wir in Altenheimen abholen. Frisch rasiert und gekämmt. Sogar die Nägel hat man ihnen geschnitten. Alles nur …» Winkler unterbrach mich und ergänzte: «Damit keine Gerüchte entstehen wie: Im Altenheim X werden die Leute schlechter behandelt als im Altenheim Y.» – «Genau», sagte ich.
«Ihr wart heute ganz schön auf Zack», sagte Heinz.
Der Pfleger, ein bulliger Mensch mit schweren Augenlidern und Pferdeschwanz, nickte.
«Herzschlag», vermutete ich.
Der Pfleger, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, nickte erneut.
Das Gesicht des Aufgebahrten war zu einer Maske erstaunten Leids erstarrt; Heinz hob ein Augenlid: Eine geweitete Pupille stierte ins Leere. Die Haut des Toten hatte sich noch nicht verfärbt und wies lediglich an den Fingernägeln die aschgraue Tönung auf, die nach einem Herzschlag den ganzen Körper überzieht. Sie hatten uns wirklich schnell gerufen. Ich stellte mich an die Wand, blickte aus dem Fenster, sah in die Sonne hinein und kniff die Augen zusammen. In den Wimpern schillerte das Spektrum der Fraunhoferschen Linien. Oder hieß der gute Mann Frauenhofer? Ich blinzelte, Frauenhofer klingt blöd, ohne e, genau, schreibt sich wahrscheinlich ohne e, Grundkurs Physik, ich hatte nichts verstanden, alle Physiklehrer auf die Schwarze Liste, mit Befremden stellte ich fest, dass ich mir das Gesicht der Bäckereiverkäuferin nicht ins Gedächtnis rufen konnte, Abbild der Sonne auf der Netzhaut. So sehr ich mich auch konzentrierte, ich sah nur ihre schönen Unterarme vor mir, die Kuchenzange, die zugriff, vielleicht findet sie mich ja trotzdem sympathisch, ihre Möpse, vielleicht denkt sie, ich wäre schüchtern, gut, schüchtern ist gut, vielleicht hab ich mich gar nicht so schlimm blamiert … «Weißt du, was das ist?», fragte Heinz.
«Eine Trage?», mutmaßte ich.
Heinz nickte dem Pfleger aufmunternd zu, und dieser verkündete: «Das ist ein Ferno-Verstorbenen-Transporter.» Dann machte er die Spannungspause seines Lebens.
«Ein was?», fragte ich.
«Na, erklärs ihm schon!», sagte Heinz, und ich bekam erläutert, es sei ein Problem, die Verstorbenen aus den Krankenzimmern zu schaffen, ohne dass die Besucher und Patienten dadurch gestört würden. «Stell dir vor, du gehst deine Omma im Krankenhaus besuchen, tideldum, und da schieben sie gerade nen Toten ausm Nachbarzimmer. Da kannst du ja gleich wieder nach Hause gehn!» Der Ferno-Verstorbenen-Transporter sei die Lösung dieses Problems, denn diese scheinbar leere Krankentrage habe einen doppelten Boden, eine so genannte Leichenmulde. Das Wort «Leichenmulde» kam ihm verdächtig glatt von den Lippen. Was ging hier vor? Wieso wusste er so gut Bescheid? Hatte er einen Kurs an der Volkshochschule besucht? Leichenmuldenkunde für jedermann? Und wie ließ sich sein enormes Bedürfnis erklären, den Ferno-Verstorbenen-Transporter in den höchsten Tönen zu loben? Und (diese Frage machte mir am meisten zu schaffen) wieso hatte Heinz den Kerl dazu gebracht, mir alles zu erzählen? «Das ist doch ganz einfach», beantwortete der Pfleger eine rhetorische Frage, die ich nicht mitbekommen hatte. «Toter drauf, abgesenkt, Scheinabdeckung drauf und tideldum, fahr ich eine leere Trage zum Lift.» Als er seine Ansprache beendet hatte, freuten wir uns alle, Heinz wurde seinen Tampon-Witz los, im Gegensatz zu mir musste der Pfleger herzlich darüber lachen, und als er sich endlich getrollt hatte, sargten wir den Alten ein.
«Das Tideldum ist doch ein Hit!», sagte Heinz.
«Porno-Verstorbenen-Transporter», sagte ich.
«Das letzte Mal hat er noch viel mehr getideldumt.»
«Der hat doch ein Rad ab.»
«Tideldum!», sagte Heinz.
«Hast du ihn deshalb gebeten …?»
Ein ernstes Tideldum bestätigte meinen unausgesprochenen Verdacht.
Nachdem der Sarg im Transit verstaut war, leistete ich Heinz bei zwei Dosenbieren und einem eiskalten Apfelschnaps Gesellschaft. Krankenhäuser ziehen Kioske mit Stehausschank magisch an. Hier erscheinen ältere Herren in Bademantel und Hausschuhen, um ihr Päckchen HB zu kaufen, und kippen, da sie nun schon einmal die Strapaze der Hospitalflucht auf sich genommen haben, rasch noch einen Underberg oder ein Dosenbier. «Kommt ne Frau zum Arzt und sagt: ‹Mein OB steckt quer.›» Ich bewunderte die Zwanglosigkeit, in der Heinz mit der Verkäuferin scherzte; neben mir zitterte ein alter Mann im Trainingsanzug; unter seiner Augenklappe spähte gelblich verfärbter Mull hervor; ab und an packte er meinen Ärmel und erhob die Stimme, um sich über irgendwelche Missstände auf der Inneren auszulassen. Ich nickte unverbindlich und trank lauwarme Cola.
«Merkst dus?», fragte Heinz, als wir in den Transit stiegen.
«Was?» Ich manövrierte zwischen parkenden Autos durch (ab jetzt fuhr ich, denn die Abstecher zu Kiosken und Trinkhallen wären von nun an fester Bestandteil des Tages).
«Wie sie warten.»
«Wer wartet?»
Heinz deutete mit dem Daumen hinter sich. «Die Totenwürmer.»
«Tideldum», meinte ich vorsichtig, denn ich war mir nicht sicher, ob er Spaß machte.
Vor einigen Jahren hatte ich mit Achim einen seiner damaligen Freunde besucht, einen verpickelten Sonderling, der aus einem mir heute schleierhaften Grund einen platten Fisch, möglicherweise eine Scholle, auf dem Balkon seiner Einzimmerwohnung trocknete. Der Leib des toten Fischs hob und senkte sich in benommenen Atembewegungen. Das waren die Maden! Unter dem Fisch wanden sich so viele Maden, dass er zu atmen schien. Die Maden waren überall. Stolz lüpfte Achims Bekannter einen Blumentopf, und selbst dort, wo das kleine Abtropfloch im Topfboden das Wachstuch berührt hatte, ringelten sich zwei winzige, weiße, deutlich segmentierte Maden. Damals wurde mir schlecht, aber ich kotzte nicht. Mein Vater hätte wahrscheinlich in hohem Bogen über das rostige Balkongeländer gereihert, einem seekranken Entomologen nicht unähnlich, der sich grüngesichtig über die Reling des Schiffs beugt. Einmal kotzte Vater, als er eine Möhre für mein Meerschweinchen aus dem Kühlschrank holte. Sie hatte inmitten einer grauen, schleimigen Pfütze gelegen, klatschte schlaff und runzlig in Vaters Handfläche, von der Spitze tropfte verwester Schmand, Vaters Backen blähten sich gewaltig auf, ich sprang einen Schritt zurück, Vater sah sich ratlos um, eine Hand auf dem Mund, in der anderen die verfaulte Möhre, und dann explodierte das Mittagessen aus seinem jäh aufplatzenden Gesicht. Ich schaltete in den vierten Gang, und Heinz kommentierte das nnkrrkkks! des Getriebes mit diesem Spruch, den ich in meinem Leben schon so oft gehört hatte, dass ich ihn selbst dann vor mich hinmurmelte, wenn ich alleine im Transit saß und mir das übliche Malheur mit der Kupplung passierte.
«Schau mal, die Kleine mit dem Ranzen!» Heinz kurbelte das Fenster runter und brüllte: «Ich fühls! Ich kanns fühlen! Die Totenwürmer! Die sind überall, die Totenwürmer!»
«Mach das Fenster wieder zu», lachte ich.
Heinz rülpste. «Einen Scheiß werd ich tun! Uh, stinkt das!» Er fächelte mir den Rülpser zu, steckte sich eine Zigarette an, rauchte. «Hast du alles gesehen? Von Onkel Jörg, meine ich?»
«Es ging zu schnell.»
«Wirst dus ihm sagen?»
«Weiß noch nicht. Wenn ich es ihm sage, lässt ers vielleicht bleiben.» Und nach einer kurzen Pause fügte ich hinzu: «Jens hat ihn noch nicht gesehen.» Inzwischen hatte sich Onkel Jörg bestimmt angezogen und nahm die Aufträge entgegen. War er mit Heinz unterwegs, bat ein Anrufbeantworter, der sich meine Stimme ausgeborgt hatte, Namen und Adresse zu hinterlassen, versicherte, er werde halbstündlich abgehört, und log selbstbewusst: «Unser Wagen kommt binnen einer Stunde bei Ihnen vorbei.» Ich aß mein halbes Schweinsohr, die Totenwürmer seien überall, philosophierte Heinz. Wie konnte ich nur ihr Gesicht vergessen? Wäre sie mir auf der Straße begegnet, hätte ich sie sofort wiedererkannt. Aber wieso befand sich dort in meinem Gedächtnis, wo eigentlich ihr Gesicht sein sollte, ein großer, leerer Fleck? Nur ihre anmutigen Bewegungen waren geblieben, die Titten, die Kuchenzange, die skeptischen, grünen Augen, der Küster, ein Herr Friedler oder Fiedler, stakste wie ein Storch über den Rasen vor der Katholischen Kirche, den Kopf gesenkt, als suchte er etwas. Er sah uns vorbeifahren, verschränkte die Arme und fing im Rückspiegel zu grübeln an, bis ihn eine langgezogene Kurve aus dem Rahmen kippte. «Ich müsste nochmal in die Bäckerei.»
«Jetzt gleich?», fragte Heinz.
«Das wär mir eigentlich am liebsten.»
«Kein Problem.» Heinz grinste. «Willst du wissen, wie sie heißt?»
Ich war noch nie ein guter Schauspieler. «Also gut», sagte ich. «Wie heißt sie?»
Und Heinz zerlegte ihren Namen mit lüsterner Grimasse in stöhnende Silben. Er ließ jede Silbe so brünstig auf der Zunge zergehen, dass ich vor Ekel eine seelische Gänsehaut bekam.
Jasmin hieß sie, Jasmin Rimbach.
4Es kam einer Flucht gleich, dass der frisch graduierte Entomologe Carl Richard Bahlow im Jahr 1910 nach Deutsch-Ostafrika reiste, um dort im Auftrag der Insektenhandlung Staudinger & Bang-Haas nach seltenen Arten zu suchen. Unter normalen Umständen hätte Bahlow das anfangs hartnäckige, später erpresserische Angebot der Firma niemals angenommen, aber nachdem Staudingers Briefe aus Dresden-Blasewitz zunehmend deutlicher geworden waren und sogar von Polizeigewahrsam und Festungshaft sprachen, übergab Bahlow dem höhnisch abwartenden Beamten des Kieler Hauptpostamtes den Brief mit der Zusage. Es mochten Wochen sein, die er durch die gut bezahlte Flucht gewann, zu der ihn die Firma nötigte, vielleicht sogar Monate. Womöglich wuchs in dieser Zeit sogar Gras über die ganze Sache; doch dass dies eine kindische Hoffnung war, wusste er selbst.
Bahlow sollte sich, nur so viel war ihm bekannt, einer Expedition des Berliner Geologisch-Paläontologischen Universitäts-Instituts und Museums anschließen (unterstützt von Sr. Hoheit des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg, Regenten von Braunschweig), die seit 1909 im Süden Deutsch-Ostafrikas ihr Lager aufgeschlagen hatte, aber erst am Tag vor der Abreise würde er in Marseille weitere Instruktionen von einem Außenagenten der Firma erhalten, einem gewissen Herrn Kuider. Mit dem Herabsausen des Stempels wurde es unwiderruflich: Afrika! Der Postbeamte sah Bahlow, dessen Kenntnisse über Deutsch-Ostafrika sich auf das Wissen beschränkten, dass der Kilimandscharo drei Gipfel besaß, streitlustig an. Der murmelte ein leises «Dankeschön» und ließ sich von seinen Füßen durch die Kieler Chausseen nach Hause tragen, wo er sogleich sein möbliertes Zimmer kündigte. Kaum eine Woche später erhielt er per Eilboten den Fahrschein nach Marseille.
In den Tagen vor der Abreise dachte er oft an dieses Ölgemälde von Jan Baptist Weenix, das einen herausfordernd nachdenklichen René Descartes zeigt, der ein Buch in der Hand hält. Die Wahrhaftigkeit des Buchtitels hatte den jungen Bahlow im Utrechter Centraal Museum erschüttert: Mundus est fabula. Wahrscheinlich lebt es sich besser, wenn man alle Geschehnisse als Bestandteil einer Geschichte sieht, überlegte er beim Kofferpacken, als Kettenglieder einer deutbaren Geschichte, die man jedoch nicht liest, sondern erlebt. Einige Stunden später überlagerten ähnliche Gedanken das mesmerisierende, abteilfüllende Rattern der Dampflokomotive, doch erst in Marseille beschloss er, mitzuspielen und die Zeichen zu deuten. Erinnerte der helle Kalkstein der Stadt nicht an vom Sonnenlicht gebleichte Knochen? Aber was hatte das zu bedeuten? Stand das für Afrika?
Der Entomologe beobachtete mürrische alte Männer, die im Schlick nach Muscheln gruben. Die Hosenbeine hochgekrempelt watete er durch das warme Wasser, und als das Mittelmeer seine Füße umspülte, behutsam den Boden unter den Sohlen untergrub, sackte er tiefer in den Sand und versuchte wankend und armrudernd das Gleichgewicht zu wahren, Symbole, Wolken, Zeichen, Bahlow malte Schlaufen und Kreise in den Sand, ja, er fühlte sich tatsächlich wie die Figur in einem groß angelegten Spiel, die ihre ohnmächtigen Züge auf dem Brett (sei es zu Fuß durch Marseille oder mit dem Schiff nach Dar es Salaam) aus der Vogelperspektive verfolgt, und mit einer Wärme, die er nicht für möglich gehalten hätte, gedachte er seines Craniums, der bergenden Schale, die sein Ich vor dem Zugriff der anderen schützte. Der restliche Tag geizte nicht mit weiteren Botschaften. Natürlich wies die an einen Kutschverschlag gepinselte Abkürzung MDL auf seine Reiseroute hin (Marseille – Dar es Salaam – Lindi). Und bedeutete die Sandschnur im Treppenhaus, die plötzlich abriss, nicht die erzwungene Abreise aus Kiel? Von Eindrücken übersättigt fiel Bahlow in das zu weiche Bett.
Als er erwachte, kam ihm sein Verhalten am Vortag lächerlich vor, diese krampfhafte Suche nach Zusammenhängen. Sie wollten, dass er nach Afrika fuhr, um Insekten zu sammeln. Also würde er es tun. Tat er das nicht, gaben sie den Behörden verfängliche Hinweise. Er verbummelte den Vormittag, gönnte sich den kostspieligen Luxus einer Rasur. Zur festgesetzten Stunde wartete er am Quai du Port und trank starken Kaffee aus einer verblüffend kleinen Tasse. Die Schattenblätter eines Lorbeerbaumes huschten über Tischplatte und Handrücken, Frauen, Mädchen, Bahlow vermied es, ihnen in die Augen zu sehen, erschienen sie ihm doch so unberührbar fern wie die exotischen Käfer in den versiegelten Schaukästen seiner Studienzeit. Schönheit bevölkerte die knöcherne Stadt, im Französischen heißt es «la mort», femininum, bloß nicht in die Augen sehen. Zu seiner Rechten bewachte das bleiche Fort Saint-Jean die Einfahrt des Alten Hafens, Bahlow fütterte die Tasse mit Zuckerstückchen und versteckte Kinn und Oberlippe in einer grüblerischen Hand, hatte doch die Konjunktion seiner empfindlichen Gesichtshaut mit dem schabenden Messer eines Marseiller Barbiers zu unappetitlichen Pusteln geführt, Pusteln, die aufplatzten, wenn er mit dem Fingernagel daran kratzte, Pusteln, die milchige Tropfen freigaben, durchzogen von feinen Blutfäden, Mädchen, Frauen. Der junge Mann, der in einem Café an der Hafenpromenade auf einen Außenagenten der Insektenhandlung Staudinger & Bang-Haas wartete, trug einen verdreckten Ulster (mit dem er erfolgreich eine ärmliche Tuchweste verbarg), der Stehkragen scheuerte am Sonnenbrand, und obwohl sich ein drittes Lebensjahrzehnt in Form eines straff gespannten Gürtels abzuzeichnen begann, wirkte Bahlows Erscheinung kraftlos und schwächlich, das Echo einer asthmatischen Kindheit in ständig wechselnden Seebädern. Frauen. Mädchen. Was, wenn sie alle nackt gingen? Sich vor ihm nach Münzen bückten? Ablenken. Muss mich ablenken, muss ganz Auge werden.
Neugierige standen auf der Plattform des Forts Saint-Jean; als ironischen Kommentar zu Bahlows Warten ließ man ein Schiff in den Vieux Port einfahren: den Anker zum Grundfassen gerichtet, die Bugsprietwände losgehakt. Auch der lästige Mitreisende namens Strigaljow, der am Nachbartisch eine Zeitung in offenbar kyrillischer Schrift las, betrachtete das Schiff, und als sich ihre Blicke kreuzten, nickte die verhärmte Gestalt freundlich; Bahlow errötete vor Ärger. Nicht genug, dass ihm dieser Strigaljow während der Bahnfahrt unaufhörlich von den Abgründen der russischen Literatur berichtet und ihm kandierte Früchte aufgenötigt hatte, nein, der aufdringliche Bursche musste sogar in derselben Pension wie er Quartier beziehen, einer billigen Unterkunft, zu der eine Treppe von der Allée de Meilhan hinaufführte. Heute Morgen hatte Bahlow ihn im Frühstücksraum demonstrativ geschnitten. Unauffällig ließ er die Repetieruhr in der Hosentasche anschlagen: fünfzehn Uhr und fünfzehn Minuten. «Doktor Bahlow?»
«Ja?»
«Wir sind verabredet. Mein Name ist Kuider.» Der Greis legte einen Stock mit Elfenbeinknauf zu Bahlows weichem Hut auf einen freien Stuhl. Kuider trug spiegelnde Lederschuhe, eine einreihige Weste, gestreifte Kammgarnbeinkleider (dunkel), die Manschetten und Frontknöpfe glänzten golden. Bahlow war froh, sich eine schwarze Diplomatenkrawatte umgebunden zu haben. Neben ihnen warf Strigaljow einige Münzen auf das Tischchen und entfernte sich in ungelenker Hast. Kuider legte den Zylinder auf den Tisch, warf den Cutaway über die Lehne des zur Garderobe umfunktionierten Stuhles. Seine Bewegungen wirkten jugendlich, aber Bahlow konnte Kuiders tatsächliches Alter nicht schätzen, braune Flecken, Pergamenthaut, Falten und Furchen bildeten Spinnennetze und Flussdeltas, Augen, strenge Augen, eine gebieterische Stimme fragte: «Sie sind gut angekommen?»
«Ja. Gut. Gestern Nachmittag.» Mit gelindem Erstaunen musterte Bahlow Kuiders Halskette, an der ein kreisförmiges daumennagelgroßes Amulett aus rauchigem Silber baumelte: Ein Andreaskreuz schmiegte sich in einen Ring. Bahlows umherwandernde Tasse hatte auf der Tischplatte ebenfalls einen Ring hinterlassen, wässrig braun, gedankenverloren malte Bahlow mit dem Finger ein Kreuz in den Kaffeekreis, sieht wie das Amulett aus, lästig, wie Kuider seinen Blick zu fangen suchte, um ihn schließlich zu packen und festzuhalten. «Wie war die Reise, Doktor Bahlow?»
«Gut», antwortete dieser und fügte, um nicht unhöflich zu erscheinen, hinzu: «Etwas anstrengend.»
Kuider rieb die Hände gegeneinander. «Sie scheinen nicht zum Plaudern aufgelegt zu sein. Lassen wir uns also directement zum, sagen wir, offiziellen Teil des Treffens übergehen. Die Angelegenheit ist nicht ungefährlich. Unser erster Mann …» Der Kellner trat an den Tisch, und Kuider bedeutete ihm mit einer grausam beiläufigen Geste, nicht gestört werden zu wollen. «Wie unpassend! Wo war ich stehen geblieben?» Der Kellner zog sich ins schattige Innere des Cafés zurück.
«Sie sagten, es sei nicht ungefährlich», bemerkte Bahlow.
«In der Tat. Valdsky, unser erster Mann, ein Missionar, meldet sich seit vier Monaten nicht mehr. Es ist unwahrscheinlich, dass er noch am Leben ist, aber halten Sie die Augen offen. Ein Bild von Valdsky wurde Ihrem Dossier beigefügt.»
«Meinem Dossier?»
«Keine Sorge. Ich werde es Ihnen gleich aushändigen.»
«Was habe ich zu tun?»
Kuider lachte tonlos. «Sie sammeln Insekten für die Insektenhandlung Staudinger & Bang-Haas.»
«Nein, ich meine, was soll ich wirklich tun?»
«Insekten sammeln.» Wieder lachte Kuider. «Dafür werden Sie von der Firma bezahlt. Und weil Sie diesen Auftrag von uns bekommen haben und nicht von der Firma, bitten wir Sie, außerdem die Augen offen zu halten. Das ist, hoffe ich, nicht zu viel verlangt.»
«Und wenn ich nein sage?»
«Das werden Sie nicht wagen! Sie wissen das, und wir wissen das. Sie haben doch sicherlich geahnt, dass uns Ihre Vorliebe für das weibliche Geschlecht nicht verborgen geblieben ist – ansonsten hätten Sie unser Angebot wahrscheinlich ausgeschlagen. Oder sollte ich eher sagen …»
«Was habe ich zu tun?», fragte Bahlow kalt.
«Sie haben zu beobachten. Sie haben zu berichten.»
«Weiter nichts.»
«Das reicht uns vorerst.»
«Vorerst?»
«Ich darf Ihnen hier und heute nicht mehr verraten. Nur so viel: Wir halten es für überaus wichtig, dass Sie unvoreingenommen sind.»
«Unvoreingenommen?»
«Ja.» Hiermit schien das Thema für Kuider erschöpft zu sein. Er wandte sich ab, rief in perfektem Französisch nach dem Kellner. «Nehmen Sie auch einen Absinth, Doktor Bahlow?»
Dieser nickte zögerlich; Kuider bestellte zwei Absinth.
«Sie dürfen mir wirklich nicht mehr verraten?»
«Nein.» In amüsiertem Bedauern hob Kuider die Hände. «Ich weiß nicht, ob Sie das entschädigen wird, aber ich habe den Auftrag, Sie mit den Hintergründen der Expedition vertraut zu machen, der Sie sich in Kürze anzuschließen gedenken.» In der Nähe des Tendaguru-Berges, etwa drei bis fünf Tagesreisen von der Küste entfernt, war ein Ingenieur der Lindi-Schürfgesellschaft namens Sattler über einen gigantischen Knochen gestolpert, der quer über dem Pfad lag, der sich von Lindi aus ins Innenland schlängelt. Bei dem halb aus dem Erdboden herausgewitterten Stück handelte es sich um einen Beinknochen enormen Ausmaßes, und als der bekannte württembergische Geologe Professor Fraas zu Forschungszwecken in der Kolonie weilte, unterrichtete ihn Sattler bei einem Gläschen Portwein über diese Kuriosität. Fraas, ein Mann der Tat, zog am folgenden Tag mit zwanzig Trägern ins Landesinnere, wo er in einem wissenschaftlich höchst bedenklichen Gewaltakt einige prachtvolle Fundstücke ausgrub, um sie nach seiner Heimkehr der Stuttgarter Öffentlichkeit zu präsentieren. «Ein geschickter Schachzug, um die Gelder für die dringend notwendige wissenschaftliche Expedition zu organisieren. Ich lese Ihnen nun einen», Kuider blätterte in einem Notizbuch, «Auszug aus einem unveröffentlichten Manuskript vor, das uns Dr. Sproesser von der Schweizerbart’schen Verlagsbuchhandlung hat zukommen lassen. Ah, hier haben wir es! Es war eine nationale Ehrenpflicht, den Schatz, der im deutschen Boden Afrikas ruhte, mit allen Mitteln zu heben und für die wissenschaftliche Welt nutzbar zu machen. Das Berliner Geologisch-Paläontologische Universitäts-Institut und Museum unter der Direktion Herrn Geheimen Bergrats Professor Dr. Branca nahm sich der Sache an.» Bahlow bedeutete dem Kellner, ihm noch ein Gläschen des köstlichen Anislikörs zu bringen. «Ein Komitee unter dem Protektorat Sr. Hoheit des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg, Regenten von Braunschweig, erließ einen Aufruf, um die Mittel zur Ausrüstung und Entsendung einer Expedition zusammenzubringen und in erfreulich kurzer Zeit hatte der Opfersinn privater und korporativer Förderer der Wissenschaft die nötigen Geldmittel zur Verfügung gestellt. Im Ganzen dürften sich die Kosten auf 180.000 Mark belaufen haben, eine recht bescheidene Summe, wenn man – hier fehlt das Wörtchen ‹diese›! – etwa mit der gleichzeitig ins Werk gesetzten Südpolarexpedition vergleicht, für die 1 ½ Millionen gesammelt …»
Der Absinth nahm Bahlows Hand und führte ihn davon, seine Augen schwebten über dem Vieux Port, den kleinen Segelbooten, den wie Lanzen emporgereckten Masten, benutzten die bleichen Kalksteinhäuser als Stufen, hüpften den Hügel hinauf und sahen gemeinsam mit der Notre-Dame de la Garde über das Meer. Hier war Bahlow gestern schon einmal gewesen und hatte die Inselfestung Château d’If entdeckt, dessen feuchte Kerker Dumas mit seinem Grafen von Monte Christo unsterblich gemacht hatte. Mit diesem Gedanken glitten Bahlows Augen in die Höhe und zogen in einem großzügigen Bogen über dem glitzernden Meer davon. Aus weiter Ferne berichtete Kuider, die Expedition habe seit 1909 ihr Lager am rechten Ufer des Mbemkuru-Flusses aufgeschlagen, am Tendaguru-Berg. «Die Leitung obliegt Herrn Dr. Janensch, Kustos am Berliner Geologisch-Paläontologischen Universitäts-Institut und Museum. In unseren Augen ist er harmlos. Ihm geht ein Dr. Edwin Hennig zur Hand. Er ist Assistent an demselben Institute, ein Träumer, weitaus harmloser als Janensch.» Das wohltuende Sprudeln der Quelle erstarb. «Hören Sie mir überhaupt noch zu?»
Bahlow nickte hastig. Der Anisgeschmack des Absinths hatte seine Mundhöhle mit grünem Samt ausgekleidet. Seine Hände verschränkten sich auf dem Tisch zu einer aufmerksamen Wiege.
«Sie graben dort in Kronland, was bedeutet, dass die Eingeborenen auf dieser Fläche keine Felder bewirtschaften oder anlegen dürfen. Aber es lag freilich nicht an den Saurierfunden, dass das Gouvernement dieses Gebiet so überaus rasch und bereitwillig zum Kronland erklärte, so bedeutsam diese Funde für die Paläontologie auch sein mögen.»
«Ach», bemerkte Bahlow.
Kuider bedachte ihn mit einem seltsamen Blick, ehe er die einschläfernde Rede erneut aufnahm. Verstand Bahlow richtig, ging es nun um irgendwelche einflussreichen Kreise, welche die Expedition ursprünglich hatten verhindern wollen, aber diese Kreise schienen dann doch nicht – doch nicht was? – die Expedition verhindert zu haben? «Denn», fuhr Kuider verständlicher als zuvor fort, «das hätte erst die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit geweckt. Lassen wir sie nur ihre Knochen ausgraben, dachte man sich.» Über diesen plötzlichen Wechsel ins Szenische musste Bahlow herzlich lachen. «Agent dieser Kreise», sprach Kuider ungerührt weiter, «ist Herr Besser von der Niederlassung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft in Lindi. Ein äußerst gefährlicher Mann. Auf ihn müssen Sie besonders aufpassen.»
«Aufpassen?»
«Auf Herrn Besser müssen Sie Ihr Augenmerk richten!», wiederholte Kuider, und der Entomologe nickte benommen. Ungefragt brachte ihm der Kellner einen dritten Absinth. War der Mann, der dort drüben an einer niedrigen Mauer lehnte, nicht Strigaljow? Er redete auf einen jungen Burschen ein, der verdächtig dem Kellner glich. Bahlow wollte Kuider diesbezüglich informieren, doch der redete, redete, redete. «Sie wohnen in Lindi bei Bilderbeck, einem Ägyptologen, er weiß über alles Bescheid, er ist einer von uns.» Einer von uns, höhnte es in Bahlows Kopf, einer von uns! Wer waren diese wir, die alles wussten, alles besser konnten? «Dort holt man Sie ab. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Ihrem Dossier. Hier!» Eine flache Ledermappe erschien in Bahlows Hand. «Und das werden Sie auch benötigen.» Palais Royal, Carreau du Temple, Jardin des Plantes.
«Was ist das?»
«Ein Stadtplan von Paris. Sie werden ihn brauchen.»
«Einen Stadtplan von Paris in Afrika?»
«Das hat schon seine Richtigkeit. Hier!»
Bahlow nahm das dritte Geschenk entgegen, ein Tuch, öliges Zeitungspapier, der beunruhigend lange Lauf einer Luger. «Packen Sie um Gottes Willen die Waffe weg!» Ein Pappschächtelchen, aha, Patronen! Sie glänzen so schön im Sonnenlicht. «Weg damit!» Alle sind sie unfreundlich zu mir, Bahlow stand auf, eine kräftige Hand griff seinen Ärmel. «Sie wissen, dass Ihre Zeit befristet ist?»
«Meine Zeit?»
«Alles hängt davon ab, wie schnell die Post durchkommt. Ihr Verbündeter ist der Süd-Monsun.»
«Der Süd-Monsun», überlegte Bahlow. Endlich fiel ihm ein, was er Kuider schon die ganze Zeit über hatte fragen wollen. «Wieso ich?», trumpfte er auf.
«Von Herder hat Sie uns empfohlen.»
«Von Herder?» Bahlow wankte davon, versuchte sich im Gedränge der Rue de la Canebière zu verflüchtigen, kroch am Boden umher, klammerte sich an ein Hosenbein, jemand schleppte ihn eine steile Treppe hinauf, und als er am frühen Abend erwachte, packte er die Luger in den Koffer, faltete die zerknitterte Straßenkarte von Paris zusammen, mit der er sich zugedeckt hatte; es wurde dunkel. Bahlow saß am Fenster, den schmerzenden Kopf in die Hände gestützt. Ein abgekartetes Spiel, dachte er. Sie lassen mir nicht den Hauch einer Chance! Es klopfte an der Tür, einmal, zweimal, dreimal. «Sind Sie da?» Bahlow hielt die Luft an, gab keine Antwort.
Wenn das eigene Leben eine Geschichte ist, sei sie nun von einem oder von mehreren mysteriösen Unbekannten geschrieben, so muss es darin auch Perioden geben, in denen man zwischen den Zeilen lebt, und in diesen Zeitläuften, wenn der weiße, leere Raum endlos zu werden droht, erwartet man ungeduldig den Beginn des nächsten Kapitels. Bahlow verbrachte die ersten Tage auf hoher See in der Kabine, während das Schiff den Halbbogen eines W’s in die Wellen des Mittelländischen Meeres zeichnete, und als er endlich aus dem geschwollenen Bauch des Dampfers emporstieg, um einen ereignislosen Tag mit einem Spaziergang auf dem Vordeck zu beschließen, befuhren sie bereits die Straße von Sizilien. Hier setzte das Schiff zum zweiten Bogen des W’s an, der aber bald, sie befanden sich auf Höhe von Kreta, abflachte, um in bedenklichen Schnörkellinien abzusinken: Wie ein wollüstiger Molluske saugte Afrika den Dampfer in den Suezkanal.
Bahlows Kabine lag über dem Maschinenraum, und längst war das zermürbende Stampfen der Kolben ein fester Bestandteil der Träume geworden. Schlief er nicht, beschäftigte er sich inständig mit dem Dossier, als könnte er dadurch das peinigende Versagen am Quai du Port wettmachen. Ich werde abwarten, nahm er sich vor, und nichts, dachte er oft, spricht dagegen, sich selbst beim Leben zu beobachten, ganz so, als läse man einen Roman. Kuiders Dossier enthielt seitenweise maschinenbeschriebenes Papier, Landkarten, Zeitungsartikel, auch Notate in selbstbewusst ausbordender Schrift, und bald wusste Bahlow, dass es sich bei den Dinosaurier-Lagerstätten nicht um Land- bzw. Sumpfablagerungen wie in Nordamerika handelte, denn bei den Grabungen in Deutsch-Ostafrika habe man auch Muscheln, Reste von Fischen und fossile Vögel gefunden. Deswegen sprach Professor Dr. Branca, der Direktor des Berliner Geologisch-Paläontologischen Universitäts-Instituts und Museums, die Vermutung aus, hier sei «Verschiedenartiges» (ein Ausdruck von Hennig) in einem brackigen oder salzigen Küstengewässer zusammengeschwemmt worden. Zwar befänden sich die Knochen durch den Wasserabschluss in weitaus besserem Zustand als ein auf der Landoberfläche verwester Kadaver, aber die Chancen, jemals ein vollständiges Skelett zu finden, schätzte der Expeditionsleiter Dr. Janensch als höchst gering ein: Vor Jahrmillionen hat das Wasser alle Skelette auseinandergerissen und die Knochen in alle Himmelsrichtungen verstreut. Anfangs glaubte Bahlow an ein Missverständnis, doch nach und nach stellte sich heraus, dass die Knochen tatsächlich aus dem afrikanischen Boden ragten. Und gab es da nicht eine dunkle Erinnerung an einen Mann, der über einen Knochen stolperte? Einen Mann, der gerne Portwein trank? Bahlow wünschte, er hätte nie von dem verfluchten Absinth gekostet!
In der Nachbarkabine ertönten Volkslieder, plötzlich rummste es, und danach war es lange still, bis die Stimme genau dort wieder einsetzte, wo sie ein unbestimmtes Vorkommnis unterbrochen hatte; und während es nebenan das Wa-hand-ern sang, widmete Bahlow sich wieder dem Dossier. Irgendwelche Hebungen und Senkungen des Erdbodens, re-he-hecht-er Müller sein, hatten also die Schicht mit den Fossilfunden nach oben geschoben, die Schichten korrigierte er sich streng, denn die Tendaguru-Expedition grub in drei unterschiedlichen Etagen, nebenan kehrte Stille ein, grub sozusagen in drei Saurier-Stockwerken, die harte Sandsteinbänke mit reichlich maritimer Fossil-Fauna voneinander trennten. Schon auf den schmalen Negerpfaden, die von dem Sockelplateau des Tendaguru in die Mbemkuru-Niederung hinabführten, war es aufgefallen, dass die knochenführende Saurierschicht nicht nur die Oberfläche des Sockelplateaus zusammensetzte, sondern noch zweimal in tiefern Lagen angetroffen wurde, jedes Mal in der Oberflächenform eine Terrainstufe mit Steilabsturz nach Westen bildend. Es schien, als sei das Land nach dieser Richtung in Staffeln abgesunken und habe so terrassenförmigen Aufbau erlangt. Diese Auffassung musste aber alsbald weichen … Der Stewart brachte das Abendessen. Bahlow verbarg den rasch abgenommenen Tropenhelm hinter dem Rücken. Im Spiegel gefiel ihm der verwegene Helm, und er verkleidete sich täglich damit als Abenteurer und Entdeckungsreisender, aber vor einem Fremden – und gar vor einem Stewart! – wäre er sich albern vorgekommen.
Die Firma hatte ihn mit allem eingedeckt, was er benötigen würde: Reisegepäck, entomologische Ausrüstung, Nachschlagewerke, Bestimmungsbücher, und da die zur Verfügung gestellte Kleidung von wirklich herausragender Qualität war, hatte Bahlow seine eigene Garderobe eines Nachts Stück für Stück aus dem Bullauge geworfen, das auf die schaukelnde Leere hinausschaute. Es war wie ein Abschied, die alten Hüllen trieben davon, er würde neu beginnen, beobachten, berichten, mein Freund ist der Süd-Monsun. Nach einigen Tagen erschöpfte sich der Volksliedvorrat; der musikalische Mitreisende ging zu Kirchenliedern über; und die dünne Wand tönte vom Ruhm und der Gerechtigkeit Gottes, derweil Bahlow Abschriften von Hennigs Korrespondenz durchging. Nicht einige wenige, einander nahe verwandte Formen, sondern eine ganze äußerst mannigfachige Fauna der Kreidezeit liegt in deutsch-ostafrikanischer Erde verborgen, schrieb Hennig seiner Braut. Sie war, vermutete Bahlow, erheblich jünger als Hennig. Dieser erzählte seinem «Mausebärchen» nie von Dinosauriern, sondern stets von «Schreckens-Echsen». Das Gesicht unter dem Tropenhelm blickte in den Spiegel und sagte: «Schreckens-Echse!» Und wieder: «Schreckens-Echse!» Es lachte gellend. Informativer (aber nie weniger schwärmerisch) fielen Hennigs Kurznotizen aus, die er in regelmäßigen Abständen im Archiv für Biontologie der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin veröffentlichte. Unter der Tropensonne entspann sich eine Ausgrabungstätigkeit, wie sie noch nicht im Dienste der jungen paläontologischen Wissenschaft gestanden hatte!, jubelte es hier zum Beispiel, und Bahlow erfuhr, indes der Musikant nebenan offenbar Selbsterfundenes zum Besten gab, die Sammlung des amerikanischen Milliardärs Carnegie (der vor einigen Jahren dem Kaiser, wie Bahlow sich zu erinnern glaubte, Gipsabgüsse vollständiger Skelette zum Geschenk gemacht hatte) sei durch die Ostafrika-Funde rasch übertrumpft worden. Der Abguss des amerikanischen sog. Diplodocus im Berliner Museum zeige zwar eine Länge von 25 Metern, eine Höhe von 4–5 Metern, und der Oberarmknochen messe ganze 0,95 Meter, aber der Oberarm des größten Tieres vom Tendaguru umfasse nicht weniger als 2,10 Meter! Es sind zwar nur Einzelteile, hatte jemand (Kuider?) unter diesen Artikel geschrieben, aber dieser «unerwartete Schatz» (der Unbekannte spottete hier über eine Formulierung Hennigs aus einer anderen Publikation) macht die Geologisch-Paläontologische Abteilung des Berliner Museums den berühmten nordamerikanischen Sammlungen ebenbürtig!
Beobachten, berichten, aber auf was habe ich denn überhaupt zu achten? Bahlow nahm die Mahlzeiten weiterhin in der Kabine ein. Er fühlte sich zunehmend wie ein Schauspieler, der sich ohne Textbuch auf eine schwierige Rolle vorbereiten soll. Nachts träumte er von gewaltigen Urwesen, die sich in seichten Küstengewässern in Fetzen rissen; bei einem Kostümfest in der Messe hatte er einen kurzen Auftritt in Tropenmontur (als er bemerkte, dass nicht nur er auf diese Idee gekommen war, zog er sich in die Kajüte zurück); ansonsten verlief die Seereise ohne nennenswerte Vorkommnisse, es sei denn, man wertete die stetige Zunahme der Außentemperatur als Besonderheit. Unter die Rubrik Vermischtes wäre vielleicht aufzunehmen, dass sich Bahlows Äquatortaufe wegen der rüden Zurschaustellung seemännischer Derbheit als nicht enden wollender Alptraum gestaltete, dass das mörderische Klima des Roten Meeres ihn zweieinhalb Tage lang mit leichtem Fieber ans Bett fesselte, und dass ihm, als das Fieber endlich nachließ, auffiel, dass er nicht wusste, wem er überhaupt Bericht erstatten sollte. Der Zimmernachbar hatte quietschenden Damenbesuch oder einen Herzanfall, ab Dar es Salaam begann Bahlow mit der Chinin-Prophylaxe, und schon ratterte die Ankerkette von der Winde: Dicke Manntaue verbanden das Schiff mit dem afrikanischen Festland.
Drei kichernde Stewarts trugen das Gepäck an Deck, beteuerten, ihm auch weiterhin zu Diensten zu sein, wie komme er denn sonst an Land – und lösten sich in Luft auf wie Flaschengeister. Minutenlang stand Bahlow inmitten seiner Habseligkeiten. Er schwitzte. Unter dem rechten Arm klemmte der lange Stab eines Fangnetzes. Schließlich entschied er sich dafür, erst die sperrige Holzkiste an Land zu bringen, welche unentbehrliche Dinge wie Gläser, Präparierplatten, den zerlegten Lichtselbstfänger und Flaschen mit Essigäther enthielt. Dann den Seesack und die Reisetasche. Zuletzt die Hutschachtel (Tropenhelm!) und die Rolle feinsten Maschendrahtes.
«Zu viel Gepäck?», scherzte es hinter seinem Rücken. Die Stimme erkannte Bahlow auf Anhieb! Sie gehörte zweifelsohne seinem musikalischen Kabinennachbarn, der sich ungeniert an Bahlows Hilflosigkeit weidete. Der schafsgesichtige Herr stellte sich dicht neben ihn und riss einige flaue Witzchen über gewisse Leute, die ihren ganzen Hausrat mitnehmen, wenn sie verreisen.
«Ich bin Entomologe», entschuldigte sich Bahlow.
«Na, dann viel Spaß mit Ihren Käfern!», verabschiedete sich der andere, und Bahlow sah nicht ohne Neid, wie triumphierend er dabei sein kleines Köfferchen schwenkte. Licht. Grell. Die Eindrücke verschmolzen zu einem Flimmern. Jenseits der glitzernden Wellengipfel verschwand der Witzbold im Menschengedränge des Kais. Bahlow ging in die Hocke, umfasste die Kiste mit beiden Armen, richtete sich ächzend auf. Nach der langen Schiffsreise schien der rissige Boden zu schwanken. Die Kiste senkte sich auf den atmenden Lehm, er sah schlanke, hochgewachsene Massai in rotbraunen Baumwolltüchern, rötlich gefärbte Zöpfe, das Haar quer von Ohr zu Ohr gescheitelt, vorne hing eine Strähne in die Stirn und klemmte unter einem Band aus Kaurimuscheln. Bahlow hatte keine Zeit, sich völkerkundlichen Betrachtungen hinzugeben, stürzte das Fallreep wieder hinauf, um den Seesack und die Tasche zu holen. Am liebsten wäre er jedoch zurück in die Kabine geschlichen, um dort ein Nickerchen zu machen, hätte sich gerne in den Eingeweiden des Schiffes versteckt, Tage, Wochen, für immer, er griff den Seesack, sah zum Ufer hinüber: Zwei junge Burschen machten sich an seiner Kiste zu schaffen.
«Heh!», schrie er und taumelte an Land. «Heh!»
Die Burschen hielten inne, sahen ihn ausdruckslos an. Bahlow fuchtelte mit dem Fangnetz vor ihren Gesichtern herum. Ungerührt hoben die Burschen die Kiste an. «Heh! Das ist meine Kiste!»
«Das geht schon in Ordnung, Doktor Bahlow.»
Bilderbeck stellte sich vor und gab Anweisungen in Kisuaheli, woraufhin die Boys die Kiste sorgsam absetzten und davoneilten, um sich Bahlows restlichem Gepäck anzunehmen. Bilderbeck grinste den Entomologen an – solange, bis dieser sich unbehaglich fühlte. «Heiß hier», bemerkte Bahlow. Bilderbeck grinste ins Leere. «Gottseidank weht eine leichte Brise», meinte Bahlow.
«Eine leichte Brise, jaja, gewiss!» Bilderbeck strich sich sandfarbenes, fettiges Haar aus der braun gebrannten Stirn. «Gottseidank! Brise. Da haben Sie recht. So! Das wäre dann wohl Ihr gesamtes Gepäck!» Einige Worte auf Kisuaheli an die Träger, dann vertraulich zu Bahlow: «Sie haben den Halleyschen Kometen um eine knappe Woche verpasst. Er hing vom 25. April bis zum 26. Mai über den Palmen. Ein solches Schauspiel! Sie ahnen es nicht! Er wurde mit jedem Tag größer.» Bilderbeck wiegte den Kopf, als könnte er es noch immer nicht fassen, den Himmelskörper mit eigenen Augen erblickt zu haben. «Am 19. Mai nahm er fast zwei Drittel des Himmels ein. Wie ein gigantischer Scheinwerfer! Sein Schweif erstreckte sich über unseren Zenit. Das Gouvernement hat durch seine Bezirksämter, Akidate und Jumbenschaften die eingeborene Bevölkerung gewarnt, dass keine Hungersnöte oder ähnliches damit verbunden seien, aber dennoch …» Der Boden schlingerte, schwankte. Bisweilen warf Bahlow einen Blick über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass ihnen die Boys tatsächlich mit dem Gepäck folgten und sich damit nicht ins dichte Gebüsch am Straßenrand schlugen. Strandkasuarinen und Palmen überschatteten die breiten Straßen Lindis, gelegentlich erhellte das weiße Leuchten eines Hauses im Kolonialbaustil das satte Grün wie ein jäher Magnesiumblitz. Bilderbeck sei Ägyptologe, hieß es in Kuiders Dossier erstaunlich kurz angebunden, habe ab 1903 am Wörterbuch der ägyptischen Sprache mitgearbeitet, 1905 Examen Rigorosum, 1906 Dissertation, ab 1909 Außenagent der Firma Staudinger & Bang-Haas in Lindi. Es verwunderte Bahlow kaum, dass die Insektenhandlung einen Ägyptologen für sich arbeiten ließ. Vermutlich entzifferte er die Hieroglyphen auf Schmetterlingsflügeln. Bahlow wollte die spaßhafte Bemerkung gerade anbringen, denn Bilderbecks unglaubwürdiger Bericht über den Halleyschen Kometen hatte sich längst in der schwarzen Unendlichkeit des Weltenraumes verflüchtigt, und sie gingen schweigend nebeneinander einher, doch da deutete der Ägyptologe mit dem Sjambok auf ein Gebäude, das wie die Kreuzung zwischen einer Festung und einem maurischen Palast aussah. «Das Bezirksamt. Ich bedauere, Ihnen nicht mehr von Lindi zeigen zu können, aber wir sollten so wenig Zeit wie möglich auf den Straßen verbringen. Gerüchten zufolge, ach! Ich möchte Sie nicht beunruhigen.»
«Sie tun es aber justament.»
«Also gut. Es sind einige Fälle von Pest aufgetreten.»
«Pest?», lachte Bahlow ungläubig.
«Jaja», sagte Bilderbeck mit einem schiefen Lächeln. «Aber sie schlachten die Ratten ab. Schlagen sie mit Knüppeln und Holzschuhen tot. Sie kriegen das natürlich in den Griff. Erst drei Tote, und wir haben die drei bereits isoliert, als deren Fieber stieg. Im Inderviertel natürlich.»
«Und Sie meinen …?»
«Ungefährlich. Kein Grund zur Besorgnis!»
«Die Pest», murmelte Bahlow. «Die Pest in Lindi!»
Eigentlich zum Piepen, in welch krudes pseudoafrikanisches Geschehen man ihn hier versetzt hatte. Die Pest! Lächerlich! Pestkranke in Lindi! Ein Komet! Was für ein gewaltiger Mummenschanz! Und das ausgerechnet dann, wenn er ankam. Beiläufig schob man ihm diese Informationen zu. Ganz unauffällig, versteht sich. Schwarze Boys trugen das Gepäck. Selbstverständlich Palmen. Wessen Text war seine Welt geworden?
Das Schwanken der Sandstraße, das sich selbst bei dem mehrminütigen Fußmarsch nicht legte, brachte Bahlow auf bodenständigere Gedanken. In Kiel, erinnerte er sich, hatte er als Kind oft über die Matrosen auf Landgang gestaunt. Mit kraftvoll breitbeinigem Staksen waren sie vom Hafen gekommen. Er hatte damals vermutet, sie hätten sich diesen Gang angewöhnt, um auf einem schwankenden Schiffsdeck das Gleichgewicht wahren zu können. Aber nun begriff er, dass man so und nicht anders gehen musste, um nicht auf einem widerspenstigen Erdboden zu stürzen. Selbst die Dielen in Bilderbecks prachtvollem Haus bewegten sich unter den Sohlen!
Nachdem die Boys mit dem Gepäck im Obergeschoss verschwunden waren, fragte Bahlow, der nicht beabsichtigte, weiterhin als Komparse mitzuspielen, den man nur blöde anzugrinsen brauchte: «Ich erbitte mir nun eine präzise und umfassende Auskunft. Was habe ich hier zu tun?»
«Wie meinen Sie das?»
«Man hat mir gesagt, ich würde weitere Instruktionen …»
«Ach, so», unterbrach Bilderbeck hastig. «Darüber reden wir später. Sie wollen sich doch vorher sicherlich frisch machen. Nach der ermüdenden Reise und dem Fußmarsch …»
«Nein, eigentlich nicht. Könnten Sie mir nicht jetzt sofort …»
«Nun gut, aber dann lassen Sie uns wenigstens dabei einen geeisten Tee auf der Veranda nehmen.» Bilderbeck ging voraus, drehte sich plötzlich um: «Sie haben doch nichts gegen geeisten Tee?»
«Nein», beeilte sich Bahlow zu bemerken. «Natürlich nicht. Wieso sollte ich?»
Ein weiß livrierter Boy brachte einen Krug Eistee und stellte zwei hohe Gläser auf den runden Tisch zwischen den Korbsesseln. Bahlow wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der Boden unter dem Sessel stampfte und rollte, als befände sich unter Lindi ein riesiger Maschinenraum, dessen Turbinen in betäubender Synchronizität zu allen Gedanken standen. Bahlow stieg einigen dieser dröhnenden Gedanken nach, und bald nahmen sie die Gestalt davonhuschender Schemen an und lockten ihn in staubige, selten begangene Korridore. Türen zu fast vergessenen Erinnerungen schwangen auf. In einem Raum erwartete ihn die mit Kork ausgeschlagene Schachtel seiner ersten Käfersammlung. Eine knarrende Stiege führte von dort hinauf zu einer Wiese, auf der sich ein verstörter Knabe über eine Sandwespe beugte, deren Stachel sich in den Leib einer Raupe gesenkt hatte. Die wehrlose Raupe wand und verdrehte sich, aber die gebogenen Kieferzangen der Ammophila sabulosa hielten sie unbarmherzig im Nacken gepackt. «Macht Ihnen das Klima zu schaffen?»
«Es ist ungewohnt», sagte Bahlow. Der wollüstige Todeskampf der Raupe verschwamm, und er bemühte sich, seiner Stimme einen weltmännischen Klang zu geben. «Vor allem ungewohnt, weil die Luft so …» Verzweifelt suchte er nach dem mot juste. Rechts befanden sich Worte wie «warm» und «heiß», linker Hand wurde es «feucht» und «drückend», die Sandwespe zerrte die gelähmte Raupe zu ihrer Bruthöhle. Mit jedem Schritt kam Bahlow weiter von dem Pfad ab, an dessen Ende das gesuchte Wort erstrahlte wie der Name Gottes, das gesuchte Wort, das, soweit er erkennen konnte, mit einem dampfenden «sch» begann, geräuschlos schwangen weitere Türen auf, er sah ein lachendes Mädchen auf einer Schaukel, machte erschrocken kehrt und erreichte über Leitern und Wendeltreppen das Hauptgebäude. Derweil trank sein regloser Körper einen Schluck Tee und labte sich am leichten Wind, der vom Meer herüberwehte. Aus der Ferne erklang die Schiffsglocke; der Dampfer würde bald ablegen. Wie viele Tagesreisen waren es zum Tendaguru? Drei bis fünf? Hatte er das richtig behalten? Drei bis fünf Tage im Dschungel? Er dachte über das Wort «Urwald» nach, über unwegsames Gestrüpp, über Knochen, die aus der Erde ragten. Auf einmal erschienen ihm die vereinzelten Palmen, die sich auf der sandigen Grasfläche vor der Veranda erhoben, wie Späher einer feindlichen Macht. Je weiter sie vom Haus entfernt standen, desto enger rückten sie zusammen, bis die Schatten zwischen ihren Stämmen zu einem undurchdringlich grünen Dunkel wurden.
«Schwül?»
«Wie bitte?»
«Sie sprachen von der Luft.»
«Ja, schwül. Das ist das Wort, das ich gesucht habe.»
«Im Landesinneren ist es trotz der Meeresferne wesentlich angenehmer.»
«Freut mich zu hören. Darf ich?»
«Nur zu! Bedienen Sie sich!»
Bahlow schenkte sich Eistee nach. Schwül. Natürlich war die Luft schwül. Wieso entglitten ihm die Worte? Nahm seine Verwirrung etwa in dem Maße zu, in dem er seine Umgebung als wirklich anerkannte? Aber an diesem strahlenden, tiefblauen Himmel, der sich über Lindi wölbte wie eine umgedrehte Schüssel aus japanischem Porzellan, konnte man doch nicht zweifeln! Und hier, hier war seine Hand, unauffällig glitt sie über seine Brust, und hier, in seiner Brust, schlug sein Herz! Mit geheucheltem Interesse hörte er Bilderbeck zu, der anekdotenähnliche Begebenheiten aus dem Lindier Leben zum Besten gab. Sonnenbrände auf Glatzen, defekte Eismaschinen und bunte Abende im Bezirksamt. «Es gibt Lieder», behauptete Bilderbeck unvermittelt, «die begleiten einen, wohin man geht. Auch wenn man sie nur ein einziges Mal in seinem Leben gehört hat. Kennen Sie die Suleikalieder?» Bahlow gestand, sie nicht zu kennen. «Es gibt die Suleikalieder von Mendelssohn und die von Schubert. Die Mendelssohn-Vertonungen gefallen mir, ehrlich gesagt, besser. Darin muss der Sopran nicht so trällern.» Bilderbeck lachte laut auf. «Der Insekten frohes Völkchen! So heißt es im ersten Suleikalied! Der Insekten frohes Völkchen!» Bahlow lächelte vorsichtig. «Ah, Musik!», schwärmte Bilderbeck. «Musik! Das ist die wahre Sprache der Seele!»
Bahlow, der nicht wusste, wie er auf diese Offenbarung reagieren sollte, nippte am Tee; eine Eidechse huschte über die Holzveranda; fast gleichzeitig flog zwischen den Palmen ein exotisch bunter Vogel auf; und wieder erklang die Schiffsglocke. Nun löste man die Leinen, nun wurde das Fallreep eingezogen, und unaufhaltsam glitt die letzte Verbindung zu einem leidlich alltäglichen Leben auf den flirrenden Wassern der Bucht von Lindi davon – glitt hinaus auf den Indischen Ozean. Wie um Bahlows wehmütigen Gedanken das Pathos zu nehmen, stieß ihm der Tee auf.
«Möchten Sie vielleicht etwas anderes trinken?», fragte Bilderbeck, dem die unbehaglichen Schmatzer, mit denen sein Gast den gallig-sauren Geschmack in seinem Mund analysiert hatte, nicht verborgen geblieben waren. «Der arme Valdsky hat mir vor einer Weile mal eine Kiste exzellenten weißen Sherrys geschenkt.» Bilderbeck klatschte nach seinem Boy. In der Tat! Bahlow hatte selten einen so guten Sherry getrunken. Vermeintlich kennerhaft hielt er das funkelnde Glas gegen die Sonne und bemerkte großspurig: «Ich habe selten einen so guten, trockenen …» Er brach ab. Bilderbeck hörte nicht zu, sondern grinste selbstvergessen ins Leere. Dabei zupfte er in unangenehmer Weise an einem obszön großen Hautzipfel, der sich in der Mitte seiner Oberlippe befand. Fortwährend befingerte er diesen Zipfel. Er wirkte wie besessen davon, ihn langzuziehen, durchzukneten, anzunagen, und jedes Mal, wenn dies geschah, wandte ein peinlich berührter Bahlow den Blick ab. «Doktor Bilderbeck?» Besessenes Zupfen. «Doktor Bilderbeck?»
Wie aus einem Traume erwachend: «Ja?»
«Der Sherry ist ausgezeichnet.»
«Trinken Sie nur! Der Bursche wusste, was gut ist. Wenn Sie noch einen wollen – bedienen Sie sich!»
«Liebend gern!» Bereits der erste Schluck hatte den schlechten Geschmack vertrieben, soweit, so gut, aber das verzweifelte Bemühen, das Gespräch auf die Mission zu bringen, deren Durchführung Bahlow auf deutsch-ostafrikanischem Boden oblag, blieb weiterhin fruchtlos. Bilderbeck tat so, als hörte er die zunehmend ungeduldig werdenden Fragen nicht, und grinste blöde ins Leere, um aus diesen Absencen mit Vorträgen über abseitige Themen zu erwachen. So hatten sie heute schon den Halleyschen Kometen, das Erhebende der Musik und die Vorzüge einer fleischarmen Ernährung durchgenommen. Stellte Bahlow Fragen, vertröstete ihn Bilderbeck auf ein Später, das mit jedem Glas Sherry illusorischere Züge anzunehmen begann. Tapfer nahm der Entomologe einen neuen Anlauf. «In Marseille hat man mir gesagt, Sie gäben mir weitere Instruktionen. Sie haben vorhin einen Namen erwähnt. Valdsky. Ich weiß von Kuider … «
«Nicht so laut!», zischte Bilderbeck. «Was wissen Sie von Kuider?»
«Ist dieser Valdsky nicht der Missionar, der …»
«Was wissen Sie von Kuider?»
«Das, was ich Ihnen gerade zu sagen versuche. Valdsky soll …»
«Ach, hören Sie auf mit Valdsky!» Grimmig befingerte Bilderbeck seine Oberlippe. «Sie trinken hier seinen Sherry, also machen Sie ihn nicht schlechter, als er war!»
«Ich wollte keineswegs schlecht von …»