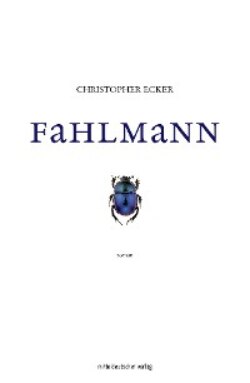Читать книгу Fahlmann - Christopher Ecker - Страница 8
ОглавлениеMoment, Moment, lassen Sie mich weitermachen! Das wollte ich gerade erklären! Im Wohnungsflur, gegenüber des Garderobenspiegels (Afrika und Europa verschwanden, wenn man sich Mitesser ausdrückte), hing eine Weltkarte. Ich hatte sie ursprünglich für Jens aufgehängt, aber eines Tages begann ich, jedes Land, das eine vertrauenswürdige Person bereist hatte (womit der Beweis für die Existenz glaubwürdig erbracht war), mit einem Kreuz zu versehen. Mutter flog mit einem Bekannten nach La Palma, brachte Fotografien mit, ein Fläschchen Sand – ich malte ein Kreuz auf die Islas Canarias (Esp.). Länder, die ich selbst bereist hatte, z. B. Frankreich oder Schweden, versah ich mit zwei Kreuzen. Mein Problem hieß Spitzbergen. Schon als ich die Weltkarte an die Wand geheftet hatte, war mir Spitzbergen zu groß erschienen. Es lag zu weit nördlich. Selbst die Form war fragwürdig, unpassend, und bald war mein Zweifel an der Existenz Spitzbergens ein Familienscherz geworden. Bestärkt in diesem künstlich erzeugten Spleen hatte mich ein Interview mit Philip K. Dick, worin dieser behauptet: Sie bauen nur so viel von der Welt auf, wie sie brauchen, um einen zu überzeugen, dass es sie (die Welt nämlich) auch gibt. Wissen Sie, das ist wie bei einer Low-Budget-Produktion: diese Länder, von denen man immer liest, wie Japan oder Australien (oder Spitzbergen! ganz besonders Spitzbergen!), die existieren gar nicht wirklich.
Da draußen ist gar nichts. Außer man entschließt sich, dorthin zu fahren, und in diesem Fall bauen sie alles schnell auf, die ganze Szenerie, die Gebäude und die Menschen, gerade noch rechtzeitig, dass man sie (die ganze Szenerie, die Gebäude und die Menschen nämlich) sehen kann. Sie (ignorieren sie den Falschbezug!) müssen wirklich sehr schnell arbeiten. Der Interviewer weiß nicht, ob ihn Dick auf den Arm nimmt, aber ich vermute, dass Dick das selbst nicht wusste. Das Publikum soll genauso wenig wissen wie ich selbst, ob ich Spaß mache oder es ernst meine, offenbarte Salvador Dalí einmal, und ich glaube heute, dass es sich mit meinem Spitzbergen-Tick ähnlich verhielt. Natürlich zweifelte ich nie wirklich daran, dass sich dort oben im Polarmeer ein Archipel befand, das aus den vier großen Inseln Spitzbergen, Nordostland, Edgeinsel und Barentsinsel sowie zahlr. kleineren Inseln bestand, auch zweifelte ich nicht im geringsten daran, dass dieses Archipel 1194 von Wikingern entdeckt und 1596 von W. Barentsz wiederentdeckt wurde (im Unterschied zu diesem niederländischen Seefahrer und Kartographen fand ich mein Spitzbergen zwischen Spitzahorn [Acer platanoides] und Spitzbogen), aber gerade weil Spitzbergen (zus. mit der Bäreninsel das norweg. Verw.-Geb. Svalbard) in keinem Lexikon fehlte, gefiel ich mir in der Rolle des Mittelpunkts einer geographischen Verschwörung. Richtig, Euer Ehren! Spitzbergen ist eine Metapher für die, geschwollen ausgedrückt, Vergeblichkeit allen menschlichen Trachtens.
«So schlimm war es doch gar nicht», meinte Großvater.
«Ich hab im Keller lesen müssen. Und keiner hat gelacht.»
«Ich habe gelacht. Was macht eigentlich dein Roman?»
«Der schneckt so vor sich hin.»
Großvater nahm die Brille ab, um damit in der Luft herumzufuchteln, was er nur tat, wenn ihm etwas besonders zu Herzen ging. «Das Tempo spielt doch keine Rolle! Das einzige, was zählt, ist, ob das Buch gut oder schlecht wird.» Er setzte die Brille wieder auf. «Wird es denn gut?»
«Da fragst du den Falschen. Mal halte ich es für extrem schlecht, dann wieder erfüllt mich ein fast peinlicher Stolz. Vielleicht liegt das daran, dass ich viel zu gut über meine eigenen Tricks und Schwächen Bescheid weiß, um mich noch selbst täuschen oder begeistern zu können. Ich finde das, was ich schreibe, weder spannend noch überraschend, obwohl ich die Leser damit fesseln und überraschen will. Ich schreibe eine Passage, die witzig sein soll, aber bereits beim Überarbeiten geht sie mir auf den Keks und kommt mir dumpf und abgeschmackt vor. Und ich wiederhole mich! Ich sage nur: Lieblingswörter! Manche verwende ich so exzessiv, dass ich das Knochenkotzen kriegen könnte. Und der Satzbau! Der ähnelt sich immer. Schreiben ist ein Herumpuzzeln mit Teilen, die man nur undeutlich sieht, ein Jonglieren mit glitschigen Puzzlestücken, die einfach nicht zusammenpassen wollen. Aber ich übertreibe. Ein überschätzter SF-Autor hat den Schriftsteller mal mit einem Tänzer in einem chinesischen Papierdrachen verglichen. Alle sehen einen wunderschönen Drachen durch die Straßen ziehen, aber der Tänzer im Inneren des Drachens sieht lediglich das Holzgestänge, das unbemalte Papier, das Pappmaché und den Arsch des Vordermanns.» Mister Mundgeruch steuerte auf uns zu, ich lächelte mild und drückte ihm, ehe er Verdacht schöpfen konnte, mein Tütchen hosentaschenwarmer Eukalyptusbonbons in die Hand. Abermals bewegten sich alle durch den Raum wie die allegorischen Figuren einer barocken Rathausuhr. Großvater trieb davon. Polkinger schob sich mir in den Weg und erklärte, mein größtes Talent sei das ironische Zitat. Es gibt außer dem Motto kein einziges Zitat in dem Gedichtband, du Kretin! «Mir hat Ihre Lesung gut gefallen.» Suuuper! «Wie schade, dass ich nicht kommen konnte», hörte ich Professor Capart ausrufen, und wieder geriet der Raum in Bewegung. Mein Publikum glitt wie auf Schienen dahin – and I awoke and found me here on the cold hill’s side.
Immer öfter stand ich alleine da, alleine im Raum, erschrak, wieso stehe ich alleine da, alleine im Raum, gab mir einen Ruck, Mut, Mut, näherte mich einem diskutierenden Grüppchen, der Paristeil ist der Hit, und prahlte, mit meinem Jugendfreund Marcus Schlumpf-Fallen im Wald gebaut zu haben. «Kleine, mit Reisig abgedeckte Gruben auf den mutmaßlichen Handelswegen der Schlümpfe.» Staunen. «Die Schlümpfe habens übrigens in sich!», erzählte ich einem irritierend aufmerksamen Herrn. «Sie tragen die Phrygiermütze der Jakobiner und dazu kurze Hosen. Sansculotten, Sie verstehen! Kennen Sie die Geschichte dieser Mütze? Das Antike Phrygien ist Ihnen doch sicherlich ein Begriff. Die Astronomen im Land des sagenhaften Königs Midas trugen gegerbte Stier-Hodensäcke auf dem Kopf. Aber jetzt muss ich mir noch ein Bier holen.» Je später es wurde, desto häufiger zog ich mich mit einem «Bester Alles!» aus Gesprächen zurück, die sich wie eine Schlinge um mein Denken zu legen drohten, manchmal rief ich aus: «Seltsam, aber so steht es geschrieben!» und, wenn ich mich recht entsinne, erzählte ich sogar Witze. Ein Ameisenbär geht ins Bordell, die Frau sitzt gerade in der Badewanne, da klopft der Klempner an der Tür. Und Bier. Viel Bier. Bier macht alles einfacher. Bier ist der flüssige Gott. Das ist heute auch noch so. Mit einem kleinen Unterschied. Damals musste ich, wenn ich zu viel getrunken hatte, auf der Couch schlafen und mich mit der Katzendecke zudecken. Heute kann ich so viel saufen, wie ich will, und keiner macht mir Vorhaltungen. Filmriss. Eine durchsichtige Jasmin setzte sich neben mich auf die Rückbank des Taxis. «Sie werfen ja gar nichts mehr ein», hatte sie bei meinem letzten Besuch in der Bäckerei Gallinger gesagt. Wir betrachteten die verplombte Sammelbüchse auf dem Tresen. «Das hab ich völlig vergessen!» Ich schlug einen scherzhaften Ton an: «Irgendwas muss mich hier wohl teuflisch ablenken.» Sie verstand nicht, ich sah an ihr vorbei in die Backstube: Unter riesigen Nudelhölzern hing ein kreisrundes Mehlsieb, das ein Draht-X in vier gleiche Teile schnitt; in einem Metalltrog lauerte eine zähe, klebrige Teigmasse; geräuschlos schloss jemand die Backstubentür von innen. Liebe Jasmin!, schrieb ich nach der Lesung heillos betrunken am Wohnzimmertisch.
Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie nicht. Ich weiß nur, wie Sie aussehen – in dieser gequälten Art ging es weiter, bis der Brief in dem markerschütternden Aufschrei gipfelte: Was für ein Mensch bist Du? Für mich unbemerkt war ich beim Schreiben zum Du übergegangen, egal, ich faltete das Blatt, küsste es und steckte es in einen frankierten Umschlag. Darauf schrieb ich: Jasmin Rimbach und die Adresse, die Heinz mir besorgt hatte. Und was für ein Mensch war ich? Ich klappte das Notizbuch auf und schrieb: Ich bin ein peinlicher Wichtigtuer, der jedem erzählt, der Große Schlumpf sei die Apotheose der Französischen Revolution. Ich bin einer, den das Urteil zweier Unbekannter auf einer VHS-Toilette an den Rand des Wahnsinns treiben kann. Jemand, der Inge gerne einer vielleicht noch minderjährigen Bäckereimieze glühende Liebesbriefe schreibt. Nein, ich würde den Brief nicht abschicken, durfte es nicht tun, auf gar keinen Fall. Ich legte mich auf die Couch, war hundemüde, aber kaum hatte ich mir Oms Decke bis zum Kinn hochgezogen, sah ich Großvater verloren inmitten meines Publikums sitzen und war wieder hellwach. Wieso hatte ich mich nicht länger mit ihm unterhalten? Und wieso hatte ich ihn mitten im Gespräch stehen lassen? Irgendwie machte ich alles falsch. Und natürlich warf ich den Brief am nächsten Tag in den Briefkasten.
6Heinz hatte dem Sattel der Vespa einen Müllsack übergestülpt: eine schlaffe Mütze, deren Zipfel traurig bis zum Hinterrad hinabhing. Trübes Unterwasserlicht erfüllte den Hof. Das Notizbuch lag auf der Fensterbank, daneben bewunderte eine dampfende Tasse ihr Spiegelbild, das unter einem beschlagenen Fleck auf der Scheibe schwamm und gelegentlich empor zu meinem durchscheinenden Gesicht schwebte. Hinter Phantomtasse und Phantomgesicht schraffierte schräger Regen den Luftquader zwischen Haus und Beerdigungsinstitut. Heinz und Onkel Jörg waren nicht zu beneiden! Den Kopf gesenkt, damit ihnen der Regen nicht in die Augen schlug, luden sie leere Särge in den Transit, fuhren davon, kamen wieder, trugen volle Särge ins Lager, und jedes Mal, wenn das Knirschen der Autoreifen ihr Kommen ankündigte, trat ich einen Schritt in den Raum zurück: Um diese Zeit brauchte mich niemand am Küchenfenster zu sehen. In drei Stunden käme Jens aus der Schule, und noch immer hatte ich mich nicht dazu aufraffen können, nach oben zu gehen und mit dem Schreiben zu beginnen. Das lag an diesem Morgen natürlich an den Nachwehen der Lesung.
Vorhin, nach dem Frühstück, hatte mich Susanne gefragt, wie es gelaufen sei. Ich antwortete: «Ganz in Ordnung!», aber sie wollte es genau wissen und bedachte mich mit ihrem speziellen Du-kannst-mir-ja-viel-erzählen-Blick. «Die Lesung war ganz in Ordnung», gab ich klein bei. «Bis auf die Gedichte. Bis auf die Leute. Bis auf die Lesung.» Mein Lachen klang gequält. «Großvater war auch da. Ich muss ihn nachher anrufen. Irgendwie hab ich ihn im Getümmel aus den Augen verloren.» Jens war im Badezimmer, kristallklares Blassblau, das Licht der Küchenlampe fiel in Susannes Augen, brachte die Iris zum Leuchten. Fast andächtig bewunderte ich die Strahlenkränze dunkler Linien, die an die dichte Speichenharfe eines Fahrrads erinnerten. «Du hast schöne Augen», sagte ich, strich ihr die Haare aus der Stirn, Susanne umarmte mich, das kam für uns beide unerwartet, wir hielten uns umschlungen, ich spürte ihren Herzschlag an meiner Brust und vergrub das Gesicht in frisch gewaschenem Haar. «Wie hast du geschlafen?», flüsterte Susanne neben meinem Ohr. «Geht so», log ich. – «Ich hab dich gar nicht ins Bett kommen gehört.» – «Es war spät.» – «Schreibst du heute?» – «Ich werds versuchen», sagte ich, bezweifelte aber, dass es nach dieser Nacht klappen würde. Die Vorstellung, im Kopf fremder Menschen ein dubioses Schattendasein zu führen, hatte mich bis vier Uhr früh wachgehalten, dann erst war der Schlaf gekommen: in kurzen, flüchtigen Stippvisiten. Immer wieder erwachte ich, sah auf die Uhr, geisterte durch die Wohnung, Susanne schlief, der Brief an Jasmin lag gut versteckt unter dem Fußabstreifer, Jens schlief, und selbst Om hatte sich am Fußende des Kinderbetts zu einer schwarzen Pelzkugel zusammengerollt, deren Ohren unwillig zuckten, wenn ich neidisch ins Zimmer spähte. Und nun war ich endlich alleine. Den Brief hatte ich vorm Frühstück eingeworfen. Morgen bekäme Jasmin Post von einem anonymen Verehrer.
Susannes Bademantel hing über dem Stuhl, auf dem sie gesessen hatte, stützte sich mit schlaffen Ärmeln auf den Fliesen ab; die Spüle bog sich unter schmutzigem Geschirr; ich bückte mich nach der Zeitung, der beim Sturz auf den Fußboden die Eingeweide in Form bunter Hochglanzprospekte aus dem Bauch gequollen waren. Rote Marmeladensiegel übersäten die Tischplatte. Jens hatte den Rest seines Brötchens zu kleinen Stückchen zerpflückt, damit keinem auffiel, dass er kaum etwas gefrühstückt hatte. Er konnte ja nicht ahnen, dass sein Vater die butter- und marmeladeverschmierten Teile auf dem Teller zu einer fast kompletten Brötchenhälfte zusammensetzen würde! Wenigstens hat er seinen Kakao ausgetrunken. Die Mohrenkopfbrötchen seines geschäftstüchtigen Hausmeisters verfluchend, stellte ich mich wieder ans Küchenfenster, ich, der Verfasser eines von der Kritik kübelweise mit unverdientem Lob überschütteten Gedichtbands, ausgebrannt, müde, ohne Energie zum Schreiben anspruchsvoller Prosa. Hoffentlich dachten diese ernsten Menschen, die mir gestern so andächtig gelauscht hatten, nicht mehr an mich! Sie haben mich schon vergessen, sagte ich mir, ich verblasse in ihren Gedanken wie das Gegenteil einer Polaroid-Fotografie. Dennoch fühlte ich mich, wie man sich wahrscheinlich fühlt, wenn man eines Tages feststellt, seit seiner Geburt ein Bewohner Spitzbergens zu sein. Ich steckte eine Zigarette an, die nicht schmeckte, und blätterte hinten im Notizbuch, wo ich Zitate aufgeschrieben hatte wie: Und dann will es mir scheinen, als ob man uns doch zu viel zugemutet hätte, als ob wir uns niemals so recht von Herzen mehr freuen könnten. Diese Sentenz stammt von einem deutschen Literaten und Helmsammler, dessen Namen an der Uni zu nennen akademischem Selbstmord gleichgekommen wäre. Das zweite Fundstück, das ebenfalls zu diesem Tag zu gehören schien, hatte Pessoa seinem traurigen Lissabonner Hilfsbuchhalter Bernardo Soares in den Mund gelegt: Wie Diogenes den Alexander habe ich das Leben nur gebeten, es möge mir aus der Sonne gehen. Ich bewegte mich in Gedanken um diese Sätze herum, zu viel zugemutet, aus der Sonne gehen, Hügel, Inseln, ich füllte die Zwischenräume mit Sand, bis die Gipfel der beiden Sentenzen (Worte wie Herzen oder Sonne) verschwunden waren und sich die Wüste einer existentiellen Traurigkeit in die Küche hinein erstreckte. Existentielle Traurigkeit. Das steht wirklich im Notizbuch. Ohne Anführungszeichen, wie so oft ohne Quellenangabe, vielleicht sogar von mir, beziehungsweise von einer früheren Version meines Ichs, einem flüchtigen Bekannten, den ich bereits vor langer Zeit aus den Augen verloren hatte.
Schon damals glitschte mein Charakter aus den zupackenden Händen wie ein Aal: Einerseits beklagte ich die Ereignislosigkeit meines Lebens, andererseits wünschte ich mir, ohne mir dessen bewusst zu sein, nichts sehnlicher als eben diese Ereignislosigkeit. 1. Es ist, als schöbe sich eine Glasplatte zwischen mein Ich und mein Ich. 2. Ich bin derjenige, auf dessen Seite sich der Beobachter (ich) zufällig befindet. 3. Mein Ich pendelt zwischen gegensätzlichen Polen hin und her, und doch bin ich nicht das Äquatorische, das dazwischen liegt, sondern zum Zeitpunkt A bin ich X (A), und zum Zeitpunkt B bin ich X (B). 4. Es ist gefährlich, zu lange über sich selbst nachzudenken, Ausrufezeichen, Tinte trockenpusten, Notizbuch zu. Das Ich ist eine Falle in einem selbst.
Meinen Freunden verschwieg ich solche Überlegungen (gefährlich in ihrem weinerlichen Pathos und ihrer Banalität). Wir fanden es ungehörig, das eigene Seelenleben voreinander umzustülpen wie einen Gummihandschuh. Wie hätten sie wohl auf solche Offenbarungen reagiert? Achim hätte gelacht, und Winkler hätte meine Bekenntnisse ungerührt zur Kenntnis genommen und mir dann übergangslos von seinem neuesten literarischen Projekt berichtet: «Es geht um belebtes Geschirr …» Oder er hätte Übergescheites zum «Topos des Doppelgängers» abgelassen, um dann die Handlung eines indizierten Splatterfilms zu referieren, wo man mit bloßer Gedankenkraft Gehirne zum Platzen bringt und mit herausbaumelnden Augäpfeln, aufgeschlitztem Unterleib und behängt mit schillernden Eingeweidegirlanden ein hysterisch kreischendes Blondinchen in der Badewanne heimsucht, um sie unter heftigen Blutstürzen mit safrangelbem Eiterstrahl zu schwängern.
In der Zeit vor meiner erzwungenen Abreise nach Paris traf ich mich hauptsächlich mit Achim und Winkler. Winkler kannte ich erst seit zwei Jahren, Achim seit frühester Kindheit. Er hatte zwar nur drei Straßen weiter gewohnt, aber unsere Freundschaft begann erst, als wir im Grundkurs Physik nebeneinander saßen und gleichwenig von den Formeln verstanden, mit denen Dr. Bostel die Tafel füllte; nichts vermag Menschen enger aneinanderzuschweißen als Nichtwissen. Außerdem gaben wir uns beide gerne die Kanne, Achim vertrug angeblich «vier Liter aufwärts», und eines Abends erlaubte ich ihm, mich in Mollingers Eck zu begleiten, in meine nahe Stammkneipe, die einer bushaltestellenlosen Seitenstraße voller Eisenwarenhandlungen und chemischer Schnellwäschereien das Recht auf Existenz verlieh. Mit diesem Besuch begann ein neues Kapitel meines Lebens. Achim hatte nicht geschwindelt, er vertrug tatsächlich so viel wie ich, trank nicht zu schnell, nicht zu langsam, und er quasselte keinen Schwachsinn, wenn man seine Ruhe haben und nur dumm herumkucken wollte. Von nun an trafen wir uns jeden zweiten Abend in Mollingers Eck, was die langweiligen Wochen unseres frauenlosen Kosmos angenehm rhythmisierte. An den übrigen Abenden vermieden wir es gewissenhaft, Alkohol zu trinken, und so verging die Schulzeit. Dann wohnten wir zusammen und tranken «an den Abenden dazwischen» sauren Weißwein von der Tankstelle, einen Wein, den vernünftige Menschen nicht mal zum Kochen verwendet hätten. Bei einem dieser Abende in unserer WG-Küche, wo zur Freude aller Besucher ein dichter Schimmelbart unter der Spüle wucherte, hatte Achim lallend verkündet, sein Biologiestudium zu schmeißen, um mir ab sofort «im Simpelstudiengang Germanistik» Gesellschaft zu leisten. Sind die Rahmenbedingungen unserer Freundschaft überhaupt wichtig? Ich denke nicht. Wichtig sind allein die großartigen Abende in Mollingers Eck! In spätpubertärer Begeisterung für Chandler hatten wir Molli überredet, Cocktails zu mixen, und nach anfänglichen Protesten wie: «Nur Schwule und Flittchen trinken so ein Klebzeugs!» wurde es eine Selbstverständlichkeit, einen Gimlet oder Whiskey Sour bestellen zu können, ohne schief angesehen zu werden: eine willkommene Abwechslung zwischen den Bieren!
Molli zapfte ein wunderbares, eiskaltes Bier, das Glas beschlug in der Hand, perfekte Schaumblume sowieso. Würde mir hier jemand ein derart gezapftes Bier servieren, ich bräche in Tränen aus. Der Name «Molli» ist übrigens irreführend. Unwillkürlich sieht man einen dicken, schlampigen, vermutlich unrasierten Mann in verdrecktem Rollkragenpulli und abgewetzten Cordhosen vor sich, aber bei dem wirklichen Molli handelte es sich um eine dünne, alterslose Erscheinung mit Stirnglatze und Nickelbrille, die man eher in einem Bioladen vermutet hätte als hinter dem Tresen einer Vorstadtkneipe mit Kegelbahn. Ich erinnere mich noch gut, wie liebevoll er die Glasränder mit frischgepresstem Limettensaft befeuchtete, bevor er sie in die weit aufgerissene Zuckerpackung tauchte. Das Rasseln der Eiswürfel im Shaker war ein vertrautes Geräusch in Mollingers Eck, und zwischen den Bieren genehmigten wir uns immer mal wieder einen Cocktail und behielten diese liebenswerte Tradition auch bei, als ich Achim und dem sauren Wein Adieu sagte und mit Susanne (und irgendwie auch mit Jens) in das Haus meiner Eltern zurückkehrte. Da wir gerade bei den Saufgeschichten sind: Jedes Jahr am 26. März traf ich mich mit Achim bereits nachmittags in Mollingers Eck, und um Schlag fünfzehn Uhr fünfzig begossen wir Chandlers Todestag – es geht doch nichts über gute Anlässe zum sanktionierten Trinken! Soupault berichtet, Joyce habe neben Hochzeitstag, Lichtmess, Heilige Drei Könige und Weihnachten auch die Publikationsdaten seiner verschiedenen Werke gefeiert. Wäre außer schWEINe-essIG etwas anderes von mir erschienen, etwas Ordentliches, Ernstzunehmendes, ein Band mit Erzählungen vielleicht, ein Roman, hätte ich liebend gerne auf diese Anregung zurückgegriffen, aber das Erscheinungsdatum eines Buchs zu feiern, in dem kaffeetasse johann zirpt im kaltbach steht, war wie in Hundescheiße zu treten und sich dabei wohlzufühlen. Und nun ist es höchste Zeit für einen Abstecher zu Molli.
«Noch ein Bier?», hatte Achim zwei Wochen vor der Lesung gefragt, der nun, nachdem er in rascher Folge drei WG-Mitbewohner verschlissen hatte, wieder sein altes Kinderzimmer in der Vorstadt bewohnte. «Gimlet?», fragte ich. Achim dachte nach. «Gimlet?», fragte ich wieder. «Noch ein Bier und dann nen Gimlet?», schlug er vor. «Okay», sagte ich. «Erzähl weiter! Was machen die Frauen.» Achim hatte Pech mit Frauen, seit wir befreundet waren. Zurzeit lief er einer Achtzehnjährigen hinterher; er würde sie nie erreichen. «Ich sitze mit ihr zusammen und stelle sie mir unentwegt nackt beim Squashspielen vor», gestand er flüsternd. «Wieso beim Squashspielen?», fragte ich. «Wieso nackt?», gab er zurück, und diese spaßhafte Bemerkung verriet mehr über ihn, als er ahnte. Erst kürzlich hatte ich Susanne gesagt: «Der hat sich schon so oft mit der Kleinen getroffen, dass jede Berührung unmöglich geworden ist. Sie erzählt ihm in irgendwelchen überfüllten Schülerkneipen von ihren Lehrern, ihren Eltern, von ihrem jüngeren Bruder, was für Musik hörst du, was sind deine Hobbys, und über diesem ganzen Geplapper wird jede Berührung unmöglich. Wenn sie zum vierten Mal nebeneinander im Kino sitzen, kann er ihr nicht mehr zufällig die Hand aufs Bein legen. Wenn sie zum zehnten Mal nebeneinander durch die Stadt gehen, kann er nicht mehr nach ihrer Hand greifen! Der Zug ist abgefahren.» Es passte also ins Bild, dass Achim die Vorstellung ihrer Nacktheit gleichermaßen beunruhigte wie belustigte, und so, wie ich die Lage einschätzte, würde er mir bald von einer neuen Schnalle berichten, bei der er sich große Chancen ausrechnete, und der ganze Zirkus ginge von vorn los.
Achims Unentschlossenheit zeigte sich auch in seinem Aussehen. Mal ließ er sich Koteletten wachsen, mal ein modisches Kinnbärtchen, mal versuchte er, seine vorstehende Oberlippe mit einem fadenscheinigen Schnurrbart zu kaschieren. Er sah sich unentwegt um wie ein schlechter Schauspieler, der in einem B-Picture einen Spion spielt, schien sich nie ganz wohl in seiner Haut zu fühlen, und der spöttische Ausdruck in den Mundwinkeln war weniger ein Indiz für Arroganz, wie viele meinten, sondern die Folge einer schmerzhaften Unsicherheit in alltäglichen Dingen. Je länger ich über ihn nachdenke, desto deutlicher sehe ich ihn vor mir: Zu kleine Nasenlöcher, Brille, das leicht fliehende Kinn mündet in einen kräftigen Hals mit ausgeprägtem Adamsapfel, Aknenarben. Zog er den Parka aus (ein Kleidungsstück, das er das ganze Jahr über trug), sah man, dass etwas mit seinem Hinterteil nicht stimmte. Es saß zu hoch, wirkte knöchern, war auffällig flach und ziemlich breit; ich verstehe nicht, was Susanne damals in Paris so anziehend an Achim gefunden hatte. Ob er ihr noch gefiel, nachdem er mit ihrer dauerkichernden Freundin das Weite gesucht und uns alleine und verlegen im Hotelzimmer zurückgelassen hatte? «Was machst du denn so», fragte Susanne nach einer Weile. – «Ich schreibe», sagte ich. – «Was schreibst du?» – «Abenteuergeschichten und so Zeugs.» – «Das find ich ja toll. Ehrlich? Kein Witz?» – «Ehrlich …» Und ganz und gar kein Witz!
Seit der Spritztour nach Paris hatte die Zeit ihre Spuren in Achims Gesicht hinterlassen: Falten, Krähenfüße, das Übliche. Außerdem waren seine Wangen ständig gerötet, und früher hatten sie sich nur in aufregenden Situationen verfärbt, an der Tafel im Physikunterricht zum Beispiel, oder als wir auf der Treppe vor der Sacré-Cœur endlich mit den beiden deutschen Mädchen ins Gespräch gekommen waren. Es ist beunruhigend, schreibe ich aus dem hilfreichen Notizbuch ab, mitansehen zu müssen, wie ein Freund altert, wie er fett wird, wie seine Gesichtszüge erschlaffen. Das ist fast so, als trüge man einen riesigen Spiegel mit sich herum, der einem unentwegt zeigt, wie schnell das eigene Leben dem Tod entgegentickt. (…) Allein die Angst, meiner eigenen Vergänglichkeit gewahr zu werden, ist der Grund, warum ich nie zu einem Klassentreffen gegangen bin.
«Geh doch mal mit ihr nackt Squashspielen», hatte ich Achim damals übrigens vorgeschlagen. Konzentriert zog er einem aufgeweichten Bierfilz die Haut ab und zupfte sie Fetzen um Fetzen in den Aschenbecher. «Danke für den Tipp.» Unsere Abende begannen üblicherweise maulfaul. Wir tranken, rauchten, beobachteten die Frauen vom JLB. Doch an jenem Abend, an den ich mich erinnerte, als ich an einem regnerischen Vormittag, genauer gesagt, an dem Vormittag nach der VHS-Lesung, am Küchenfenster stand (hier im Empire-Hôtel gebe ich vor, mich an diesem Vormittag an diesen Abend erinnert zu haben), an jenem Abend in Mollingers Eck also, ich mache es nicht absichtlich so kompliziert, das müssen Sie mir glauben, die Sache ist kompliziert, also an jenem Abend in Mollingers Eck dachte ich an nichts anderes als an Marsitzkys Brief, zwei Gedichte, schnell, schnell, der Brief schlug in meinem Kopf mit den Flügeln wie ein aufgescheuchtes Huhn, schnell, umflatterte es gackernd mein Denken, schnell, schnell, Marsitzky brauchte zwei neue Gedichte «im Stil Ihres schWEINe-essIG-Bandes für eine Anthologie neuer deutscher Literatur», schnell, schnell, gackerte das Huhn in der Weltmaschine, und geheim, geheim. Mit Achim konnte ich nicht über die Sache reden; er war fast ausgerastet, als ich meine bevorstehende Lesung in der Volkshochschule erwähnt hatte. «Trink aus!», sagte ich. «Ich freu mich auf nen Gimlet!» Rascher Überschlag: Drei Bier, jetzt nen Gimlet, dann noch drei, vier Bier, das ist okay. Trinke ich mehr, muss ich auf der Couch schlafen. «Du schnarchst, wenn du besoffen bist», hatte sich Susanne bereits im ersten Jahr unseres Zusammenlebens beschwert. «Und ich hab, weiß Gott, keinen Bock, von einem biergefüllten Aschenbecher angegrunzt zu werden.» Also grunzte der Aschenbecher, wenn er biergefüllt war, diskret auf der Couch, um gegen fünf oder sechs Uhr in der Frühe zu seiner Frau ins angewärmte Bett zu kriechen, wo er die Beine endlich wieder ausstrecken konnte.
«Luftballon», sagte Achim. – «Was?» – «Luftballon dabeihaben», sagte er. – «Versteh ich nicht.» – «Wenn man Saufen geht. Wie in den Bilderwitzen. Da kommen sie auch immer mit einem dicken Luftballon nach Hause.» Achim hatte den Bierdeckel zerrupft und schickte sich nun an, Streichhölzer einzeln aus der Packung zu nehmen, um sie in kleine Stückchen zu brechen, die er ordentlich nebeneinander auf dem Tisch aufreihte. Der Zuckerrand des Gimlets knirschte an meinen Zähnen, ich nahm einen großen Schluck und zeigte Molli, als er in unsere Richtung schaute, einen aufgerichteten Daumen, schnell, schnell, flatternder Brief auf dem Hühnerhof, zwei Gedichte, schnell, schnell. Später mehr davon. Ich muss aufhören. Brauche eine Pause. Hier bin ich wieder! Ich habe nachgedacht. So haut das nicht hin. Ich sitze mit Achim im Leeren. Zwar heißt diese Leere Mollingers Eck, hat also einen Namen, aber das bringt uns nicht weiter. Um die Leere zu füllen, muss ich das Innere der Kneipe beschreiben. Damit ich Sie und vor allem mich dabei nicht langweile, lege ich einfach eine Weltkarte über Mollingers Eck. Passen Sie auf! Das wird klasse!
Man betritt die Kneipe durch eine Tür am Nordpol, rechter Hand räkelt sich der Tresen (Nord- und Südamerika), dahinter geben offene Butzenglastüren den Blick auf Gläser und Humpen frei, langsam, langsam, wir haben Mollingers Eck eben erst betreten, noch bohren sich unsere Blicke in eine Wand aus Zigarettenqualm, dahinter brodeln Gespräche, Gelächter, und hinten ist der Übungsplatz, jemand mit einer vor Aufregung vibrierenden Fistelstimme sagt ein unanständiges Gedicht auf, da ballern die Kanonen, allmählich gewöhnen sich die Augen an den Qualm, die Ohren an den Lärm, alte Sau, du, der Körper an das Gedränge, Prost, Männer, klirrend vereinigen sich Gläser im Zenit des Stammtischs, links des polaren Eingangs verbirgt die Garderobe zwei Tische, Europa, Asien, Achim und ich sitzen immer am europäischen Tisch, der vorsichtige Achim mit dem Rücken zur Garderobe, im optischen Windschatten, ich mit freier Sicht zum Tresen, zum Stammtisch (Australien), du altes Ferkel, und zum Stehtisch, der sich mitten im Raum erhebt wie ein langstieliger Pilz oder, um im schiefen Bild zu bleiben, das ich unbarmherzig zu Tode reite, wie ein winziges, quadratisches Afrika auf einer Stelze; hier trinken die hübschen Frauen vom JLB nach dem Training Diätcola und Orangensaft; und um Ihnen auch wirklich alles zu zeigen, drehe ich den Kopf nach Norden, blicke aus dem Fenster. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemüht sich eine trostlose Laterne, die Auslagen der Eisenwarenhandlung Drach zu erleuchten, hin und wieder streichen die Lichtfinger eines Autos über die Fassade, dringen durch die Scheiben von Mollingers Eck, entziffern in unbeholfener Hast den Rauputz, begutachten die gerahmten Fotos der historischen Vorstadt, etwa das bräunliche Bild über dem Stammtisch, das unser Nachbarhaus inmitten einer Wiese zeigt, ein Foto aus den unvorstellbaren Zeiten vor den Fahlmanns. Philip K. Dick, der ungekrönte König in Sachen schleichender Paranoia, hätte darin eine Collage vermutet und mit dem Aufschrei: «Ich habs ja schon immer gewusst!» durch die Wand gefasst: Alles ist Täuschung, alles ist Trug.
«Man müsste wahre Namen für alle Berufe entwickeln.» – «Wahre Namen?», fragte ich. – «Der Imker. Er klaut den Bienen den Honig und stellt ihnen Zuckerwasser hin. Müsste eigentlich Bienentäuscher heißen.» – «Oder Kregel», warf ich ein. – «Was bitteschön ist ein Kregel?» – «Eine Berufsbezeichnung. Beruf: Kregel.» Den Kregel musste ich mir merken. «And never forget the good old», das nächste Wort bettelte danach, laut gerülpst zu werden: «BLUMENWURST!» So und nicht anders waren die Erstversionen meiner schWEINe-essIG-Gedichte entstanden. Ich spreche hier bewusst von meinen Gedichten; Achim hätte unser Herumgealber nie in halbwegs brauchbaren Text verwandeln können. Und außerdem hatte er ja darauf bestanden, nicht als Co-Autor genannt zu werden. Dass ihm das jetzt Kummer macht, ist nicht mein Problem. Die Hälfte des Honorars! Lies doch selbst in der VHS, du Faulbacke! Geld will er haben! Diese Schnapsidee ist bestimmt nicht auf deinem Mist gewachsen! Nicht aufregen, schnell, schnell, zwei Gedichte. «Kregel ist doch nicht schlecht», hoffte ich. – «Geht so. Warum fragst du?» – «Ich möchte, dass mein Sohn eines Tages ein Kregel wird.» Achim sah mich nachdenklich an, aber ich verschwieg ihm auch weiterhin, dass ich es gerade bewusst darauf anlegte, brauchbare Ideen, wenn möglich sogar Notizen, zu erbeuten; und tatsächlich entwickelte sich kurz darauf aus einem harmlosen Geplänkel ein großartiger Entwurf. Alles fing damit an, dass Achim stöhnte: «Ich brauch unbedingt nen Job. Aber einen, bei dem ich wenig arbeiten muss!» – «Werd doch Außenminister des Universums», sagte ich. – «Aber das Universum krümmt sich doch in sich selbst hinein.» – «Dann werd Drontenminister!», sagte ich und taumelte einige Stunden später heimwärts, einen vollgekritzelten Bierdeckel in der Hand: Wenn sich das Universum / In sich selbst zurückkrümmt, / Bin ich eigentlich Innenminister, / Dachte der Außenminister des Universums, / Der viel lieber Drontenminister wäre, / Denn dann hätte er / Überhaupt nichts zu tun. //
Bevor ich zu Bett ging, motzte ich diese auf der Kneipentoilette heimlich notierten Zeilen mit den sattsam bekannten Zaubertricks der Lyrischen Moderne auf, legte den Bierdeckel auf die Speichertreppe, die seither bestimmt an Alpträumen leidet, und tippte am folgenden Tag:
das universum es krümmt sich in
krümmt sich in sich selbst zurück in
krümmt es sich zurück also bin ich ja ich
innenminister wenn es sich zurück es sich
krümmt das universum meine ich in sich
in krümmt es sich so dachte der außen
minister des universums ach dronten
minister ach drontenminister ach wäre
viel lieber drontenminister bitte dronten
minister universum bitte bitte dronten
minister ach drontenminister dort unten bitte
Zusammen mit meinem zweiten Meisterwerk, ich sage nur: kregel, ich sage nur: BLUMENWURST, kam das Gedicht in einen Umschlag, z. Hd. von Herrn Rolf Marsitzky, Briefmarke drauf, Jens, könntest du mir bitte einen Gefallen, klar, Papa, und schon hüpfte er mit dem drontenminister die Treppe hinab. Ich freue mich sehr, dass Sie beim Zusammenstellen Ihrer Anthologie an mich gedacht haben … Oh, wie ich Marsitzky hasste! Diesen größenwahnsinnigen Scheißkerl mit seinem großspurigen Gehabe! Er hatte mich seinerzeit durch den Verlag geführt, als gehörte alles ihm persönlich, von der Sekretärin bis zum Fotokopierer, und dabei war er bloß der kleine Gott von nebenan, ein wie ein Primus wirkender Emporkömmling im Designeranzug, Lektor für deutsche Gegenwartsliteratur, in der Jury zahlloser Literaturpreise, ein ahnungsloses Arschloch mit Seepferdchenkrawatte, das in alles reinreden musste. So hatte es in der mond-schein-parade eigentlich heißen sollen:
oma kruse und h. c. affmann
betütelt im «chez darwin»
und nicht:
oma kruse und h. c. knolle
im kurhotel «thoelke»
«Chez klingt wie eine Verballhornung des Vornamens Charles», hatte ich Marsitzky vergeblich zu überzeugen versucht, «aber andererseits gemahnt es an einen Kneipennamen. «‹chez darwin›». Verstehen Sie? Das ist symbolisch. Affenhaus Welt. Die Welt ein Tollhaus. Nur deshalb heißt es gleich in der ersten Zeile h. c. affmann, wobei ich hier zwei weitere Scherze verborgen habe. Zum einen spiele ich damit …» – «Herr Fahlmann!», unterbrach Marsitzky ungerührt. «Ich denke, Sie haben nicht verstanden. Solche», er litt, «Scherze passen nicht zum Image unseres Verlagshauses. Ich kann Ihnen aber eine geistreiche Alternative vorschlagen.» Und so wurde «chez darwin» zum kurhotel «thoelke» – in meinen Augen der fürchterlichste Fehlschlag der Evolution. Nein, das möchte ich an dieser Stelle nicht vertiefen, möchte ich eigentlich nie vertiefen. Jedenfalls klingelte einige Tage, nachdem ich den drontenminister abgeschickt hatte, das Telefon, und Marsitzky begann grußlos: «Ihre Gedichte der weltbeste», Schlucken, «kregel und, äh, krümmungen des inneren außenministers reißen mich nicht vom Hocker.» Ich atmete Angst in den Hörer, und mein Lektor verlangte unwirsch zu wissen, was Dronten seien. «Vögel», erklärte ich verdutzt und bemühte mich, nicht herablassend zu klingen. «Ausgestorbene Vögel. Auf Madagaskar …» Plötzlich war ich mir nicht mehr sicher, ob die Dronten auf Madagaskar gelebt hatten, und fügte ein klägliches «oder so» hinzu. «Das versteht keiner», sagte Marsitzky. Mauritius? Haben die Dronten nicht auf Mauritius gelebt? «Soll ich die Dronten-Zeilen weglassen?», fragte ich. Natürlich haben die Scheißvögel auf Mauritius gelebt!
«Nein, Sie sollten das ganze Gedicht weglassen! Vergessen Sie, dass Sie es jemals geschrieben haben! Es hat nicht das Niveau der schWEINe-essIG-Texte.» Niveau! Seit wann haben die schWEINe-essIG-Texte Niveau? Kann Kotze sprechen? Ernährt sich ein Tasmanischer Nacktnasenwombat von Altmetall? Wer ist unser lustiger kleiner Hauptbahnhof? Die schWEINe-essIG-Texte und Niveau! Dass ich nicht lache! Am liebsten hätte ich Marsitzky gesagt, wie seine «niveauvollen» Gedichte entstanden waren. Ich holte tief Luft. «Ich könnte Ihnen eine kleine Erzählung …» – «Herr Fahlmann! Die … ja … das mit Ihren Prosatexten haben wir zur Genüge durchgekaut. Ich brauche Gedichte, die mindestens die Qualität Ihrer alten Arbeiten haben. Zwei Gedichte! Gehobene Qualität! Spätestens nächste Woche. Guten Tag.» Er legte so schnell auf, dass mir das unausgesprochene «Auf Wiederhören!» wie Blei auf der Zunge liegen blieb. Nächste Woche. Muss mir beim Saufen wieder Notizen machen. Nicht mal in Frieden saufen lassen sie einen! Gehobene Qualität. Stehe ich unter Druck, klappt nichts, drontenminister, und kaum ist der Druck weg, kregel, schreib ich vier Gedichte auf einen Schlag. Muss aufpassen, dass Achim nichts mitkriegt. Qualität! Wenn Marsitzky «Qualität» sagt, klingt das verdächtig nach Güteklasse A. Weiß der Arsch nicht, was Dronten sind! Natürlich haben die auf Madagaskar gelebt. Nein, Mauritius. Vor der Weltkarte. Zumindest in der Nähe von Madagaskar. Östlich davon. Kein Kreuz drauf. Klar. Kenne auch keinen, der dort war. Irgendwann muss jemand die Marsitzkys ausrotten, flugunfähige, nacktgesichtige Saumenschen.
«Was ist denn mit dir los?», fragte Susanne. Ich zeigte aufs Telefon. «Marsitzky.» – «Er wollte die Texte nicht?» – «Nein. Er will andere Texte. Güteklasse A.» – «Und was bedeutet das?» – «Viel Bier und auf der Couch schlafen!» Susanne hob die Augenbrauen, sagte aber nichts. Ihr Glück! Einmal hatte sie mich gefragt, ob es mir auf Dauer nicht langweilig würde, jeden zweiten Abend mit Achim in Mollingers Eck zu verbringen. «Ich denke nicht», antwortete ich, «dass mir das jemals langweilig werden wird!» Unser Platz hinter der Garderobe, heißt es im Notizbuch, gehört zu den wenigen Orten, wo ich mich wohlfühle und die ich Heimat nennen könnte. Heimat – sofort fällt mir mein Lesesessel ein: Nacht für Nacht erwartete er mich inmitten eines Lichtkreises, den die betagte Stehlampe mit dem großmütterlichen Schirm auf den Schlafzimmerteppich warf, sattgelbe Insel, auf dir treibe ich davon, ein Buch in Händen, die Tapeten verblassen, die Zeilen verschwimmen, Buchstaben verdichten sich zu Bildern, Raumschiffe, Serienmörder, und lediglich das Umblättern lässt die Wirklichkeit in Form einer schlafenden Schönen aufflackern, deren nackte Beine unter der Bettdecke hervorkommen, ovale Schattenteiche in den Kniekehlen. Susannes Haar ein auf dem Kissen liegender Fächer, neben dem Bett zerknüllte Söckchen, nahe der Tür ein abgestürzter BH mit verdrehten Schwingen – rasch blättere ich um und gleite kaum mehr Leib zwischen den Seiten davon.
Selbstverständlich fühlte ich mich auch in der Küche wohl, eine Tasse auf der Fensterbank, den Notizblock daneben, dieses Halbleben zwischen Schlaf und Arbeit am Fenster, dieses träge Fischen nach Erinnerungen, dieses manische Umkreisen der eigenen Identität. Montags und mittwochs ging es danach zum Sargschleppen, manchmal musste ich auch zur Uni, aber am angenehmsten waren, ehrlich gesagt, die Tage, an denen ich mich nach der dritten oder vierten Tasse nicht zum Schreiben durchringen konnte und mich wieder ins ausgebombte Bett legte. Lesesessel, Küchenfenster, Bett, eigentlich habe ich mich im ganzen Haus wohlgefühlt – sogar manchmal am Schreibtisch auf dem Dachboden, obwohl ich es dort mit einer vorwurfsvoll glotzenden, störrischen Schreibmaschine zu tun hatte, der es immer wieder gelang, die flüssigsten Gedanken in holzig daher klappernde Sätze voller Anachronismen und schamloser Rechtschreibfehler zu verwandeln. Ob ich mich in dem Haus so wohlfühlte, weil ich darin meine Kindheit und Jugend verbracht hatte? Ich stieg die Treppe hoch, und das vertraute Knarren einer Stufe verwandelte mich in einen Siebenjährigen; nachts schloss ich behutsam die Haustür auf, ein Jugendlicher, der sich bemüht, leise zu sein, damit die Eltern nicht merken, wie betrunken er ist; alle Gegenstände sprachen zu mir; im Herzen des Hauses wartete mein ehemaliges Kinderzimmer; und in den Aschenbechern auf dem Dachboden spukte der Geist meines Vaters. Für Susanne wären derartige Überlegungen Wasser auf die Mühlen ihrer Lieblingsthese: Du lebst zu viel in der Vergangenheit etc. «Und was ist daran schlecht?», hatte ich sie einmal gefragt. «Schlecht?» Sie überlegte. «Du lebst nicht in der Gegenwart.» – «Lebst nicht in der Gegenwart», äffte ich sie nach. «Was für ein Unsinn! Natürlich lebe ich in der Gegenwart. So wie du und Jens und Was-weiß-ich-wer-noch! Ich denk halt viel über das Vergangene nach. Daran ist nichts Verwerfliches. Das ist normal! Manche machen es sich leicht im Leben, andere etwas schwerer.»
Diese Plattheit in den Ohren erscheine ich auf der Straße vor meinem Elternhaus. Den Nachbarn ist es ein Dorn im Auge. Ich kenne jeden Riss in der Fassade, das fleckige Rot der Ziegeln, die lecke Dachrinne, unter der Jahr für Jahr die Mauersegler nisten. Die Straße, die ich nun in Gedanken westwärts gehe, führt schnurstracks in die Innenstadt. Gegenüber der Metzgerei Kundel steht eine Tankstelle aus den fünfziger Jahren, deren futuristische Mütze, ein steil emporschwingendes Stück Beton, sich gut auf dem Titelbild eines SF-Groschenhefts gemacht hätte. Der Tankwart grüßt, ich grüße zurück und komme wenige Minuten später an der Bäckerei Gallinger vorbei, Jasmin steht mit bloßen sonnengebräunten Armen hinter der Theke, wir brauchen ja nicht über Literatur zu reden, Kleines, deine Wimpern, die langen, deiner Augen dunkele Wasser, sie sieht mich nicht, ich beschleunige, renne fast. Hinter der nächsten Kreuzung rotten sich etliche Geschäfte zusammen, Obst und Gemüse Kleibon für Susanne, Getränkeboutique Nobbinger für Heinz, der weiße Klotz des Zebra-Markts für uns alle. Kauft man hier ein, sagt man: «Ich gehe ins Dorf.» Läuft man jedoch weiter in westliche Richtung, wie ich es jetzt in Gedanken tue, überschreitet man bald die unsichtbare Grenze, die «das Dorf» von «der Stadt» trennt. Sofort werden die Häuser mondäner, höher, rücken enger zusammen – in den überseeischen Mustern einer bedrohlichen Fremde. Ich muss umkehren! Hier gefällt es mir nicht. Also gehe ich zurück, biege nach etwa einem Kilometer in eine Seitenstraße, Staubwolken hängen über dem Gelände einer Baustoffhandlung, das Kreischen von Kreissägen kommt vom Schrottplatz, Brachland, dann wieder Häuser und endlich stehe ich, ein Pilger, dessen Reise ein jähes und beglückendes Ende nimmt, vor Mollingers Eck.
Ich entsinne mich mit Wehmut, wie Heinz mich an meinem fünfzehnten Geburtstag in seine Stammkneipe eingeführt hatte, die damals noch reichlich prosaisch Das Eck hieß. «Wer Haare an der Knolle hat», sagte er, als er mich seinen Saufkumpanen vorstellte, «darf auch einen heben!» Vater war nicht sonderlich begeistert, dass ich meine Samstagabende von nun an in einer Kneipe verbrachte, aber was wollte er tun, hatte ich doch in Onkel Jörg einen eifrigen Fürsprecher. Und so begann die Zeit des Taumelns, des In-den-Rinnstein-Kotzens, ich trinke mein erstes Bier auf ex, das Licht bricht sich in den Waben vorüberziehender Literhumpen, alles dreht sich, spielt Karussell, wie ein Möbiusband verbiegt sich der Heimweg ins Endlose, und mit dem Klappern des Frühstücksgeschirrs steigen befremdliche Bilder aus dem betäubten Kopfkissen. Dann kam die Zeit der Angst: Das Eck wechselt den Besitzer! Doch Mollis liebenswürdige Regentschaft übertraf alle Erwartungen. Seitdem sah man Heinz jeden Abend mit Nobbinger und Bäuchel am Tresen; er füllte die Aschenbecher, bestellte ein Bier nach dem anderen und kam jedes Mal, wenn ich mich mit Achim am europäischen Tisch besoff, auf ein Bierchen zu Besuch, ohne sich anmerken zu lassen, dass er meinen Freund nicht ausstehen konnte. «Nimm schon!», sagte er und stocherte mit der Zigarettenschachtel vor Achims Brust herum, erzählte einen Witz, zwei Witze, drei Witze, dann kehrte er zum Tresen zurück, von wo man ihn bisweilen eine Sauerei brüllen oder hemmungslos rülpsen hörte. Mal beneidete ich ihn um diese Unkompliziertheit, mal bekümmerte mich die gleichförmige Melodie seines Lebens, gestört durch den Missklang einer verborgenen Familie im Hintergrund. Für mich hatte Heinz immer zu unserer Familie gehört. Er aß mittags bei Onkel Jörg (Chilibohnen waren ihre Spezialität), und schon als Kind hatte es mich in Erstaunen versetzt, dass Heinz nicht Fahlmann hieß. Von ihm bekam ich die tollsten Geburtstagsgeschenke (Messer, Luftpistole, Wehrmachtshelm); als mich die Schachtsträßler auf dem Kieker hatten, holte er mich einen ganzen Monat lang mit der Vespa von der Schule ab; spucks aus, Junge, wie viel Dollar fehlen dir noch zu deinem Moped? Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich Heinz vermisse, und werde das ungute Gefühl nicht los, ihm meine Zuneigung zu wenig gezeigt zu haben. Aber damals lebte ich hinter Glas.
Widerwärtig alltägliche Probleme wie ein zur dämonischen Schreckgestalt aufgeblähter Marsitzky verstellten mir den Blick auf die wirklich wichtigen Dinge. Meine Freunde wussten nichts davon. Sie durften nie von meinen Schwierigkeiten mit Marsitzky erfahren. Winkler, weil es ihn nichts anging, und mit Achim redete ich hauptsächlich über Sex (allgemein), Biertrinken (speziell) und das lästige Studium – aber meistens machten wir Quatsch. Mit professionellem Geschick vertrieben wir unliebsame Tischgenossen, irgendwelche Trottel, die Achim von seiner Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr kannte, und die ihn «Flacharsch» nannten. Ein Dummes Gesicht setzt sich zu uns an den Tisch, Flacharsch und so weiter, hahaha, Herrenwitze, und plötzlich fragt Achim mich in beiläufigem Tonfall: «Was haben wir denn damals eigentlich gekriegt, als wir das Mittelmeer ausgehoben haben.» – «Fünfhundertvierundvierzig Mark die Stunde», sage ich. «?», macht das Dumme Gesicht. «Der Sack, der die Alpen aufgeschüttet hat, hat sechshundert Mark bekommen», fahre ich mit Bedacht fort und erkläre unserem neuen Freund herablassend: «Höhenzulage.» – «Die brauchen uns bald wieder», sagt Achim. «Die Verschalung ist undicht.» – «Das wird teuer», seufze ich. «Alles abpumpen, die Muscheln abkratzen, der Sand muss rundumerneuert werden, Unterbodenwäsche, dann Silikon in die Fugen – wird ein scheißteurer Spaß!» In dieser Art machten wir weiter, bis dem Dummen Gesicht die Sicherungen im Kopf zu qualmen begannen, und es genervt das Weite suchte. Besonders peinigend empfanden die Typen von der Freiwilligen Feuerwehr unsere offenkundige Unkenntnis in handwerklichen Universalien. Der Achter Schlüssel, die Zwölfer Nuss, die mächtige Hilti waren die schwarzen Trümpfe, die, falsch ausgespielt, die Hände des hartgesottensten Handwerkers zum Zittern brachten. Nur gegen Onkel Jörg gab es keine Allzweckwaffe.
Hönk, hönk, der Transit fährt vor, Onkel Jörg betritt Mollingers Eck, begrüßt die Anwesenden mit einer kreisenden Handbewegung, die einen Heiligenschein in den Zigarettenqualm über seinem Kopf zeichnet, zischt mit Heinz ein schnelles Bier am Tresen, tritt dann an unseren Tisch, mimt den Zerknirschten und versucht mit einigen Fragen, den Grad meiner Trunkenheit zu ermitteln. Achims Gesicht ist längst zur Grimasse erstarrt, aber so verdiene ich mein Geld! Im Nachhinein hat sich immerhin eine Nachtfahrt mit Onkel Jörg gelohnt, jene Fahrt nämlich, als ich mich aus heiterem Himmel an Sonettkränze erinnerte. Bestehen aus fünfzehn Sonetten, rekonstruierte ich, während die Sargkanten den Putz von den Wänden eines Treppenhauses schabten, der Schlussvers des ersten Sonetts ist der Anfangsvers des zweiten und so weiter. Mich interessierte vor allem das Meistersonett, das sich aus den ersten Zeilen der vierzehn Kranz-Sonette zusammensetzte. Erste Worte! Nun wusste ich, was ich Marsitzky schicken würde! Letzte Worte! Die erste Zeile des ersten Gedichts der mond-schein-parade bildet die erste Zeile meines Gedichts erste worte; die zweite Zeile des zweiten Gedichts der mond-schein-parade bildet die zweite Zeile; die dritte Zeile des dritten Gedichts bildet die dritte Zeile und so fort …
erste worte
unfug mit dem feuerlöscher
oben am jong bösch
peilt gott lotrecht im eimer
komm mal mit mein kleines
duseln nattern durch krummbüsche
steh kopf, schwammenwald!
schwester inge! ihr busen!
deine kleine raupe
Bei den letzten worten verfuhr ich umgekehrt: Die letzte Zeile des letzten Gedichts der mond-schein-parade bildet die erste Zeile, die vorletzte Zeile des vorletzten Gedichts bildet die zweite, die vorvorletzte Zeile des vorvorletzten Gedichts die dritte Zeile – mochte Marsitzky daran verrecken!
letzte worte
deine kleine raupe
oh sagt’s mir wenn ihr’s wisst
très joli! pierre oiseau:
plätten maulwurfshügel maulwurfshügel
nack-tack-tack so dunkel
hat tee in der tube (7 liter und mehr)
oben am jong bösch
unfug mit dem feuerlöscher
Die kleine Raupe beschloss die ersten worte, die kleine Raupe eröffnete die letzten worte, krümmte sich und bildete einen weichen Kreis. «Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles», sagte die Raupe; und damit steckte sie die Wasserpfeife wieder in den Mund und schmauchte weiter. Auch der unvorhergesehene, aber durchaus willkommene Umstand, dass die letzte Zeile der letzten worte nicht nur identisch mit der ersten Zeile der ersten worte war, sondern auch – oh, Wunder! – mit der ersten Zeile des Eröffnungspoems der mond-schein-parade, gab den ersten beiden Gedichten meiner Nachkregelphase ein spielerisches, fast magisches Flair. Bestürzt über den Stolz auf diese lyrischen Bastelarbeiten brachte ich sie noch in der Nacht zum Briefkasten. Am Fenster. Schlechtes Wetter. Genau … Ich stehe am Fenster. Ich rieche den Geruch der Wohnung, ein Wasserhahn tropft. Mittlerweile hatte der Wind gedreht, peitschte Regen gegen die Scheibe und machte unser Haus zum Unterseeboot, das sich in einer versunkenen Stadt verfranzt hat; gluckernd füllte sich die Thermoskanne; Zeit verging; Großvater rief an: «Hast du die Lesung gut überstanden?»
«Mehr oder weniger», sagte ich.
«Du hast ausgezeichnet gelesen.»
«Danke.»
«Genieß es doch einfach als Schauspiel!»
«Das sollte man tun», murmelte ich, hatte aber keine Lust, mit ihm über meine literarische Karriere zu reden, erste worte, letzte worte, ich war gespannt, wie Marsitzky meine Spaßpost aufnehmen würde, und hoffte fast, er würde seiner Sekretärin einen kühlen Brief diktieren, so nicht, Herr Fahlmann, eine knappe Mitteilung, die unsere demütigend einseitige Verbindung beendete. «Das sollte ich wohl tun», sagte ich und lenkte das Gespräch mit einem ungeschickten, aber bestimmten Ruck vom Hauptgleis Fürchterliche Lesung auf ein Nebengleis: «Was liest du zurzeit?»
«Vera christiana religio. Eine Schrift von 1771.»
«Du liest religiöse Traktate?»
«Nicht direkt», lachte Großvater. «Das Buch ist kurios. Momentan erfahre ich zum Beispiel, dass es zwei jenseitige Londons gibt.»
«Jenseitige Londons?»
«Ein London der Hölle und ein London des Paradieses. Das ist mit allen Städten so.»
«Soso», bemerkte ich befangen, «das ist ja wirklich kurios.» Ich gab mir Mühe, noch ein wenig mit Großvater zu plaudern, aber irgendwie fehlte mir der rechte Schwung. Als ich auflegte, starrte mich Om fassungslos an. Ich starrte zurück, er ließ sich seitlich umfallen, streckte einen Hinterlauf in die Höhe und widmete sich voller Behagen einer schamlosen Intimhygiene. Ich sah ihm eine Weile dabei zu, ging dann in die Küche zurück, legte die tropfende Filtertüte behutsam auf den Unrat, der den Deckel des Mülleimers anhob, schraubte die Thermoskanne zu und stellte mich wieder ans Fenster. Dahinter ging das Leben weiter: Heinz und Onkel Jörg luden einen leeren Sarg in den Transit, einen Wulstsarg mit gekernter Blattschnitzung in Eiche, altdeutsch, 3.530,– DM, gehobene Mittelschicht. Kürzlich hatte ich Winkler belehrt: «Wenn jemand einen Sarg bestellt, sieht man sofort die Wohnung des Bestellers vor sich.» – «Man kann vom Sarg auf die Wohnung schließen?» Winkler steckte sich einen Zigarillo an. «Klingt logisch.» Konzentriert betrachtete er die glimmende Spitze. «Wie sind eigentlich eure Preise?» Ich berichtete von unserem billigsten Modell, dem Einfachen Kiefernsarg. «Damit niemand auf die Idee kommt, seine Verwandten darin beerdigen zu lassen, haben wir den Sarg im Katalog mit dem listigen Zusatz zur Feuerbestattung versehen. Er kostet 1.228,– DM. All unsere Preise verstehen sich zuzüglich unvermeidbarer Fremdkosten wie städtischer Gebühren (Friedhof, Sterbeurkunde, Träger) und einer Todesanzeige, deren Formulierung mir obliegt. Ich habe einen Ordner angelegt, da steht alles drin – vom simplen Hier ruhen die irdischen Reste meines zu früh entschlafen Gatten bis zum blitzgescheiten Hodie mihi, gras tibi für den Herrn Doktor Schlauberger.
Außerdem», zitierte ich aus unserer Werbebroschüre, um Winkler zu beeindrucken, «beinhalten die Preise innerörtliche Überführung, Sargausstattung (Decke, Kissen, Standardbekleidung), Einbetten, Erkennungskreuz, Deckelkreuz, Deckelstrauß, Erledigung aller Formalitäten und Besorgungen sowie Betreuung vor, während und nach der Trauerfeier, was natürlich völliger Stuss ist. Betreuung nach der Trauerfeier! Ich weiß nicht, was Onkel Jörg sich dabei gedacht hat! Etwas teurer als der Einfache Kiefernsarg ist unser Kiefernsarg, hier muss man schon 1.825,– DM berappen. Wesentlich kostspieliger sind altdeutsche Eichensärge und besonders die schicken Designersärge in italienischer Bauart. Ein Nussbaumsarg kostet 4.395,– DM, ein Mahagonisarg 5.330,– DM, aber der absolute Spitzenreiter ist ein Geschoss mit Wänden aus 6 cm starkem Nussbaumholz für satte 8.145,– DM, ein Prachtsarg, in dem sich, laut Katalog, die hohe Kultur eines noblen Stils spiegelt.» Das Thema begeisterte Winkler, aber bei jemandem, der glasige Augen bekam, wenn er von indizierten Splatterfilmen sprach («Einmalige Gelegenheit! US-Export!»), deutete eine unschuldige Frage wie «Was bitteschön ist ein Erkennungskreuz?» auf mehr als nur höfliches Interesse hin. «Eine Art Tafel», antwortete ich, «die anzeigt, wo der Tote liegt, bevor man den Grabstein aufstellen kann.» Winkler machte eine ungeduldige Handbewegung, und ich führte aus, dass man mit dem Aufstellen des Grabsteins einige Wochen warten müsse, bis sich der Boden gesetzt habe.
Ob es normal ist, dass Menschen, zu denen man kein herzliches Verhältnis hatte, in der Erinnerung rascher zur Karikatur werden? Heute nämlich scheint mir der Schauspieler, der im Schattentheater meines Gedächtnisses den Winkler gibt, ein gnadenlos übertreibender, drittklassiger Schmierenkomödiant zu sein. Er bewegt sich schwerfällig; seine näselnde Sprechweise vermittelt den Eindruck ständigen Gekränktseins; er hängt in den Polstern des Wohnzimmersessels wie eine schlaffe Puppe, die sich bemüht, gleichzeitig wissend, gelangweilt und desinteressiert auszusehen. Auf der Suche nach der Bierdose krabbelt seine Hand spinnengleich über die Dielen … erst der Sessel hat Gestalt angenommen … auf einem Puzzlestück des Holzfußbodens … rotbraune Wellenlinien umgeben langgezogene Ovale … die Maserung ähnelt den Abbildungen von Höhenschichten in einem Schulatlas … unter den vorderen Sesselfüßen erkenne ich die Bierdeckelstapel, mit denen wir die leichte Neigung des Hauses ausgleichen – und da heben sich die Kulissen des restlichen Wohnzimmers aus dem Nebel, verlieren ihre Durchsichtigkeit und gehen vor Anker, während fleckige Dielen unter dem Sessel hervorschießen und am Bühnenrand auf eine hölzerne Scheuerleiste prallen, von der seit unserem Einzug die Farbe blättert. Man kann ihn bisweilen steuern, diesen rätselhaften Mechanismus des Erinnerns. Nun sehe ich das Wohnzimmer wieder klar vor mir, sehe Winkler, der mit dem Rücken zur geschlossenen Flurtür Hof hält; links von ihm führt eine angelehnte Tür in die Küche; ihm gegenüber steht die Couch, auf der ich mit übereinandergeschlagenen Beinen sitze – am jähen Abgrund des Orchestergrabens. In der Ecke hinter Winklers rechter Schulter nehmen die Blätter eines deckengreifenden Ficus benjamina dem ungeduldig hüstelnden Publikum den Blick auf meine «seriösen» Bücher; ein Platzanweiser mit weißem Haar deutet in nicht nachvollziehbarer Erregung auf Susannes Schreibtisch (rechter Bühnenhintergrund); davor erhebt sich der schwarze Turm der Stereoanlage; und vorne, fast schon auf der Vorbühne, rankt sich Topfefeu zum blinden Auge des Fernsehers hinab. Die Blumenampel ist fast so alt wie Jens (Susanne hat den Makramee-Kurs ein halbes Jahr nach seiner Geburt besucht um ihrer Schwangerschaftsdepression Herr zu werden) …
WINKLER Du musst Vorell lesen!
FAHLMANN Wen? Sinnend betrachtet er die Sacknaht am Filter seiner Zigarette.
WINKLER schnaubend: Vergiss es! Lies weiter Karl May!
FAHLMANN Ich lese nie Karl May!
WINKLER Karl May ist klasse!
Ich rieche den Qualm seines Zigarillos, sehe schwarzes, kurzes Haar, eine spitze lange Nase, er sieht wie ein dicker Igel aus, nein, Tiervergleiche sind nicht erlaubt, streichen wir den Igel. Winkler scheint einer Boulevardkomödie entsprungen zu sein: schmuddeliger Stoppelbart, Lederkette mit faustgroßem Mandala-Anhänger, offenes Hawaiihemd. Beugt er sich vor, sieht man speckige, spitze Brüste mit langen Haaren um die Warzen. «Karl May ist klasse!» Er springt auf, zieht die ständig rutschende Hose hoch und bückt sich so abrupt nach der Bierdose, dass sein Cord-Gilet emporfliegt, um ihm fledermausgleich in den ausrasierten Nacken zu flattern. Den eingedosten Fang gepackt plumpst Winkler in die Polster zurück, nimmt einen Schluck, unterdrückt einen Rülpser der Mittelgewichtsklasse und behauptet unvermittelt: «Connery trinkt als James Bond Dom Pérignon, der arme Roger Moore muss dagegen mit Bollinger Vorlieb nehmen. Aber was will man schon von einem Mimen erwarten, der ein Kassengestell auf der Nase hat!» – «Trägt Moore in den Bond-Filmen eine Brille?» – Winkler studiert die Nachtansicht von Paris über der Couch und ignoriert meine Frage. Nur selten gelang es mir, ihn so geschickt aufs Glatteis zu führen wie mit Roger Moores Brille. Meistens lauschte ich widerspruchslos. Winkler war zwar ein Schwindler, aber ein guter, und ich mochte seine Lügenmärchen. Angeblich war er Mitglied in Vereinen wie Von Herder Airguns Ltd. oder der International Bond Community. «Das sind doch die reinsten Idiotenclubs!», hatte sich Susanne nach Winklers erstem Besuch ereifert. «Und höchst wahrscheinlich geht er da nur hin, weil ihn dort alle ‹Tom› nennen. Wie kann ein erwachsener Mann ernsthaft verlangen, dass ich ihn ‹Tom› nenne?» – «Du brauchst ihn ja nicht ‹Tom› zu nennen.» – «Ich werd mich hüten! Hast du gesehen, wie er mich unentwegt angestarrt hat? Er hat immer versucht, mir in die Ärmel zu glotzen.» Verlegen gab ich vor, es nicht bemerkt zu haben. «In die Ärmel! Das ist doch krank! Warum glotzt der mir in die Ärmel?» Ich versuchte, Susanne in die Ärmel zu glotzen, um es herauszufinden. «Dein Freund Thomas Winkler ist nicht mehr ganz fix in der Birne!
Außerdem ist er ein Klugscheißer. Nenn mich einfach Tom! Was für ein Scheißkerl! Und jetzt fang du nicht auch noch mit der Glotzerei an! Da gibts nix zu kucken! Ich sollte ihn nicht ‹Tom›, sondern ‹die Amöbe› nennen!» Zu Susannes Ehrenrettung muss jetzt zweierlei gesagt werden: Sie nannte ihn nie in seiner Anwesenheit «die Amöbe», und es fiel einem wirklich nicht leicht, ihn zu mögen, wie er da schwitzend im Sessel saß und leere Bierdosen zerdrückte. Sogar Om konnte ihn nicht leiden. Pingpongbälle, die ihm Winkler zuwarf, waren uninteressant, und selbst die Kordel, die Winkler in Pfotenreichweite baumeln ließ, war langweilig. Susanne stank es außerdem, dass Winkler Zigarillos rauchte (seltener Zigaretten) und noch am nächsten Tag als Rauchgespenst in den Vorhängen hing. «Wenn die Amöbe da ist, qualmst du munter mit!», warf sie mir oft vor, denn das Wohnzimmer war normalerweise Rauchfreie Zone; ich rauchte nur in der Küche oder auf dem Dachboden – in der ständigen Hoffnung, dass Jens es nicht mitbekam. «Ich kann meinen Gästen wohl kaum das Rauchen verbieten!» – «Deinen Gästen!», spottete Susanne. – «Und da Winkler ohnehin raucht, kann ich getrost mitpaffen. Es spielt keine Rolle, ob es nach einer oder zwei Zigaretten mehr oder weniger riecht.» – «Ich will nicht, dass die Amöbe mit Jens spricht.» – «Das will ich auch nicht.» – «Was findest du an ihm?» – «Er ist klug», sagte ich und war heilfroh, dass sie nichts von seiner Vorliebe für harte Horrorfilme wusste. «Er ist belesen. Er hat Witz. Und ich schätze ihn, weil er schreibt. Wohlgemerkt, weil er schreibt, nicht wegen der seltsamen Sachen, die er schreibt, obwohl sein neustes Projekt von faszinierender Dreistigkeit ist. Um es kurz zu machen: Ich rede mit ihm gern übers Schreiben.»
Nicht selten kaute ich mit ihm stundenlang die Perspektive meines Romans durch, die mir viel zu eng an die Hauptperson geknüpft zu sein schien. «Ich weiß nicht, was du hast! Das ist doch hervorragend», meinte Winkler. «Dadurch kommt die Paranoia deines Helden oder seine vermeintliche Paranoia, wie auch immer du das später auflösen willst, besser zur Geltung. Ohne Einblick in ihr Seelenleben werden alle anderen Figuren zu möglichen Verschwörern. Durch diesen Kniff wird dein Buch viel spannender. Ach», rief er in einem seiner merkwürdigen Anfälle plötzlicher Theatralik, «warum kann ich nicht einfach eine kleine spannende Geschichte erzählen! Einen Roman über Piraten im 18. Jahrhundert, eine Science-Fiction-Novelle über Paralleluniversen oder eine simple, kleine Gespenstergeschichte à la M. R. James! Warum ist mir dieser Weg verstellt?» Mit Bedacht hüllte er sich in die Aura des Geheimnisvollen, des Genialischen; er lebte hinter einer dicken Glaswand, und wir verständigten uns mit Gesten und Klopfzeichen. Ich wusste nicht, wovon er lebte, tippte aber auf reiche Eltern oder eine Erbschaft, denn abgesehen vom Dosenbier brachte er mir jedes Mal eine Schachtel Senior Service mit. «Virginia Tabak. Lasse ich mir aus Norddeutschland schicken. Die Briten waren dort nach dem Zweiten Weltkrieg stationiert und haben die Freundlichkeit besessen, uns ihre köstlichen Zigaretten zurückzulassen.» Einziger Schwachpunkt der Geschichte war, dass es Senior Service auch in hiesigen Tabakläden gab, aber ich hütete mich, ihm das Ergebnis meiner telefonischen Recherche zu unterbreiten, denn die geschenkte Schachtel hielt in der Regel bis zu seinem nächsten Besuch vor, wenn er, zwei Sixpacks unter den Armen, ein verstörtes Lächeln im Gesicht und ohne nach rechts und links zu sehen, durch den Flur in die Küche stürmte, um die Dosen im Gemüsefach des Kühlschranks zu verstauen.
«Sellerie! Das darf doch nicht wahr sein! Der ganze Kühlschrank stinkt nach Sellerie!» Dann saßen wir uns im Wohnzimmer gegenüber, er zündete einen Zigarillo an, und ich wartete gespannt darauf, mit welch erfrischend abseitigen Themen er mich heute wieder befremden würde. Ich traf Winkler stets alleine. Nur ein einziges Mal hatte ich gegen diese Regel verstoßen, und jener Abend, an dem ich mit Achim, Winkler und Susanne die Van-Hoddis-Medaille feiern wollte, wurde mein privates Spitzbergen. Achim machte sich über Winklers Begeisterung für James Bond lustig; Winkler machte sich über Achim lustig, weil der nicht wusste, wie Bond seinen Wodka Martini trinkt; Achim rülpste das Vater Unser; Susanne fühlte sich von meinen «obergeilen Spannerfreunden» belästigt, machte mir im Flur eine Szene und ging früh ins Bett. Danach versuchte der stolze Medaillengewinner den Abend zu retten, indem er missratene Jugendwerke vorlas. Ich ließ das Blatt sinken: «Da kann ich höchstens sechzehn gewesen sein!» – «Na und? So schreibt unser Freund James Bond immer noch. Die-die», Achims Gesicht hatte sich alarmierend gerötet und sein gespaltener Kehlkopf fuhr wie ein Besessener Knorpellift, «die Briten und insbesondere die britischen Geheimagenten, sind völlig verschwult.» Winkler steckte sich ungerührt einen Zigarillo an. «Mensch, Tommi!», rief Achim. «Rillo rauchen, das ist doch das Allerschärfste! Mensch, Tommi, du bist schon ne tolle Nummer!» Winkler sah mich nachdenklich an. «Meint der mich?» – «Klar mein ich dich», sagte Achim, «den guten alten Onkel James Schwul!» Ich räusperte mich beklommen. «Ihr benehmt euch wie … wie …» Beide sahen mich an.
«Wie wer oder was?», fragte Winkler. Vor Schreck vergaß ich, was ich hatte sagen wollen, und verkroch mich in einem selten gelüfteten Winkel meines Kopfs unter einem Treppenabsatz. Fassen wir zusammen: Winkler hielt Achim «für zu blöd, um sich mit ihm ernsthaft zu unterhalten»; Achim hielt Winkler für einen «billigen Aufschneider», doch hier trübten wohl Neid und Missgunst seinen Blick, denn Winkler war ein großer Aufschneider, ein Meister der Täuschung und der Selbststilisierung. Als ich ihn beispielsweise fragte, wieso ein Verein, der sich dem Andenken Sherlock Holmes’ widmet, den kryptischen Namen Von Herder Airguns Ltd. trage, zog Winkler sich nicht nur elegant aus der Schlinge, sondern verwandelte diese gleichzeitig in eine engmaschige, köcherähnliche Knüpfarbeit. Um seine zentrale These zu rekonstruieren und sie, was ich mir schon vor langer Zeit vorgenommen habe, eingehend zu prüfen, steht mir zum Glück ein englischsprachiger Sherlock-Holmes-Sammelband aus der bemerkenswert gut bestückten Hotelbibliothek zur Verfügung. Beginnen wir mit den Airguns. In der Erzählung The Final Problem heißt es:
«You are afraid of something?» I asked.
«Well, I am.»
«Of what?»
«Of air-guns.»
«My dear Holmes, what do you mean?» (469 f)
Holmes fürchtet, von seinem Widersacher Professor Moriarty ermordet zu werden, aber weshalb der Detektiv solche Angst vor air-guns hat, wird in The Final Problem nicht geklärt, denn hier stürzt er, Moriarty (Hoppla! Fast hätte ich Marsitzky geschrieben!) umklammernd, in einen awful abyss (near the fall of Reichenbach), und zwo, drei, vier, vergehen die Jahre, bis Doyle auf die hartnäckigen und zunehmend verzweifelter werdenden Proteste seiner treuen, zutiefst betrübten Leserschaft reagiert und seinen verstorbenen Helden wiederauferstehen lässt:
«Holmes!» I cried. «Is it really you? Can it indeed be that you are alive? Is it possible that you succeeded in climbing out of that awful abyss?» (486)
Holmes, erfährt Watson bass erstaunt in The Adventure of the Empty House, täuschte seinen Tod lediglich vor, um seine Feinde in die Irre zu führen. Schnitt. Baker Street 221 B, Außen, Nacht. Unser lieber Watson erblickt hinter einem erleuchteten Fenster ein so lebensechtes Holmes-Modell, dass er seinen glucksenden Freund berühren muss, weil er einer Sinnestäuschung zu erliegen glaubt:
«Good heavens!» I cried. «It is marvellous.» (489)
Eine Büste ist’s, die unseren Freund so erfolgreich täuschte, eine Wachsbüste, angefertigt von Monsieur Oscar Meunier aus Grenoble. Meiner Meinung nach ein bemitleidenswert schlecht ausgedachter Name. Wieso nennt ihn Doyle nicht Meunier Oscar Monsieur? Oder schlicht und ergreifend Monsieur Monsieur? Und was macht die gute Mrs. Hudson? Sie bringt die Wachsbüste alle Viertelstunde in eine neue Position, denn Holmes weiß, mit welch listigen und ausgekochten Gesellen er es heuer in London zu tun hat. Da! Eine Gestalt! Sehr böse! Ein Schuss! Ein SchuSS – dramatischer Trommelwirbel – aus einem LuftGeWehr! Pressluftfanfare, splitterndes Glas, und prompt zieht Holmes den Schuldigen aus seiner Pfeife: Niemand anderen als Colonel Sebastian Moran, den zweitgefährlichsten Mann Londons. Und diese Waffe? Holmes, seien Sie vorsichtig! Grundgütiger Himmel, diese gefährliche Waffe!
«An admirable and unique weapon (…), noiseless and of tremendous power: I knew Von Herder, the blind German mechanic, who constructed it to the order of the late Professor Moriarty. For years I have been aware of its existence, though I have never before had the opportunity of handling it.» (493)
Über die Seiten des Buchs, aus dem ich mit ungezügeltem Genuss zitiere, schwebt ein sepiafarbenes Bild: Inmitten malerischer Nebelschlieren kniet Holmes vor Lestrade und überreicht ihm im Schein einer Londoner Straßenlaterne das Luftgewehr, als wollte er damit den Ritterschlag empfangen. Watson, der auffallend Pu dem Bären ähnelt, nimmt in rührender Erleichterung einen großen Topf Honig aus seinem Arzttäschchen, während der trottelige Lestrade (gespielt von einem zu Hochform auflaufenden Peter Sellers) seinen Zeigefinger nicht mehr aus dem Lauf der vermaledeiten Büchse kriegt. «Mein lieber Lestrade, ich würde Ihnen gerne mit einem Pfund Butter aus meinen eigenen Vorräten aushelfen, um Ihren so misslich verklemmten Finger aus der stählernen von Herderschen Umklammerung zu befreien, hätte sich die gute Mrs. Hudson nicht damit ihre Knie eingerieben, um sich der bemerkenswert naturgetreuen Büste am Fenster meines Zimmers mit behutsamsten Rutschbewegungen nähern zu können, ohne von der Straße aus entdeckt zu werden. Oh, sehen Sie nur, die Büste hat sich wieder bewegt! Watson, gehen Sie doch bitte hinauf und richten Sie der treuen Seele aus, dass der Fall abgeschlossen ist!» Ich komme vom Kurs ab. Die These! Die zentrale These! Her mit der zentralen These! Winkler hatte damals behauptet: «Doyle wollte Sherlock Holmes nie sterben lassen! Bereits in The Final Problem hat er alle Weichen für ein Fortleben seines Helden gestellt. Bei der abstrusen Bemerkung über Luftgewehre handelt es sich um nichts anderes als ein perfekt funktionierendes, gut geöltes Hintertürchen.» Ich sehe, wie ein zufriedener Holmes Inspektor Lestrade «the famous air-gun of Von Herder» (496) für das Scotland Yard Museum übergibt. «Soweit, so gut», sagte ich. «Aber ich verstehe nicht ganz, wieso ein Holmes-Club den Namen einer potentiellen Holmes-Mordwaffe trägt?» Winkler sah mich an, als hätte ich wissen wollen, was ein Hühnerei ist. «Holmes kann nur getötet werden, wenn er lebt», sagte er, «und somit feiert der Name Von Herder Airguns Ltd. Holmes’ Wiederauferstehung.» – «Aber der Schuss galt doch einer Attrappe.» Winkler zuckte die Achseln und sagte abfällig, ich sähe das zu eng.
Ich glaubte ihm nicht, dass es einen Verein namens Von Herder Airguns Ltd. gab, und bezweifele es noch heute. Vereine heißen «International Bond Community» oder «Pater Brown Fanclub Boblingen», notierte ich, glaube ich, am Vormittag nach der Lesung. Der Name «Von Herder Airguns Ltd.» ist einfach zu gut! Ich klappte das Notizbuch zu und nahm mir vor, irgendwann einmal nachzuprüfen, ob bei Doyle überhaupt Luftgewehre und Wachsbüsten vorkamen. Inzwischen hatte die wütende Intensität des Regens nachgelassen, und weil die Thermoskanne fast leer war, ging ich, schwipp-schwapp, eine halbvolle Tasse in der Hand, geradeaus schauen, alter Trick, klappt immer, nach oben. Am Schreibtisch erwarteten mich die üblichen Probleme. Niemand kaufte mir Außerirdische ab. Also musste ich ihr Auftreten so lange wie möglich hinauszögern. Bei Außerirdischen sahen alle rot. In den buchlosen Zeiten vor Marsitzky hatte mir mal ein Lektor, dem ich Erzählungen geschickt hatte, empfohlen: «Schreiben Sie doch mal einen historischen Roman!» Ich entgegnete erstaunlich schlagfertig: «In meinen Augen ist ein Roman über das alte Rom genauso phantastisch wie ein Roman über eine Superzivilisation von Methanatmern auf dem Bruzzmond Öbel IV.» Nein, das stimmt nicht. Ich entgegnete nichts. Diese schlagfertige Antwort fiel mir erst später ein. Nein, das stimmt auch nicht. Die Antwort fiel mir eben ein. Weiter! Dachboden, Dachboden, diesmal würde ich alle an der Nase herumführen. Schreiben, schreiben, ich muss schreiben, ein Klopfen: Jens, schon heimgekehrt aus der Schule, beendete meine erfolglose Jagd nach dem ersten Wort, indem er mir einen Brief in die Hand drückte, den Onkel Jörg in seinem Briefkasten gefunden hatte:
Lieber Herr Fahlmann!
Vielen herzlichen Dank für Ihre Texte «erste worte», «letzte worte».
Ich muss sagen, dass sie mir nicht nur ausgesprochen gut gefallen haben, sondern dass sie auch ausgezeichnet dem angedachten Konzept unserer kleinen Anthologie entsprechen. Ich ziehe sogar in Erwägung, Ihre wundersam autopoetische Zeile «oben am jong bösch» zum Titel des Bandes zu machen. Da dies ja auch in Ihrem Interesse liegen dürfte, gehe ich davon aus, dass Sie mit dieser Entscheidung mehr als nur einverstanden sind.
Ich habe mich sehr gefreut, so bald und so niveauvoll von Ihnen zu hören, und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus Frankfurt
Ihr Rolf Marsitzky
7Die Schauerleute wussten zwar von zwei Weißen zu berichten, die gestern mit dem Dampfer aus Dar es Salaam gekommen seien, konnten über deren Verbleib aber nur abenteuerliche Vermutungen anstellen. Auch im Bezirksamt vermochte man Dr. Edwin Hennig nicht zu helfen. Ein Kranz hilfsbereiter Gesichter umgab den Korbsessel, in dem er saß, Mutmaßungen wurden geäußert, Befürchtungen, und nach einigen Gläsern Tee auf der Veranda leuchtete allen Bessers Ratschlag ein, es wäre wahrscheinlich das Vernünftigste, am Hafen auf den «verlorenen Sohn» zu warten, eine Empfehlung, die Hennig jedoch nicht davon abhalten würde, das Bezirksamt gegen Mittag ein zweites Mal aufzusuchen, da man dort einen ausgezeichneten Eistee servierte. Wäre er dieser Bahlow, hatte Besser, der hiesige Vertreter der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft spekuliert, fremd in Lindi, und niemand nähme ihn in Empfang, würde er sich unverzüglich an die Kaiserliche Verwaltung wenden. Und falls ihn obskure Gründe daran hinderten, suchte er spätestens am folgenden Tag den Hafen auf, denn dort und nur dort – «Gesunder Menschenverstand, meine Herren!» – würde ihn der Abgesandte der Expedition erwarten, um ihn zum Lager am fernen Tendaguru zu geleiten. Und so wartete Hennig geduldig am Hafen, obwohl er es mittlerweile sogar in Betracht zog, dass der Entomologe das Schiff verpasst hatte und demzufolge überhaupt nicht an Bord gewesen war. Schläfrig auf einem Taurollenthron sitzend verfolgte Hennig, wie man Kisten zimmerte, um sie sogleich mit den Erträgen der Grabungsarbeiten zu befüllen. Am Tendaguru wickelten die Arbeiter die Knochenteile in gummiertes Tuch, in Drahtgaze, in Gipsverband, fütterten die Zwischenräume mit Gras oder Lehmerde aus, verstärkten die unförmigen Klumpen mit einem Exoskelett aus Bambus und Seil, doch erst hier, am Hafen von Lindi, wurden die wertvollen Funde in Kisten verstaut. Deren Baumaterial stammte aus Europa: Als hölzerne Nachfahren Bartolomeu Diaz’ hatten hunderte von Fichtenholzbrettern das Kap der Guten Hoffnung im Lagerraum eines tiefliegenden Seglers umschifft und türmten sich nun auf afrikanischem Boden zu gewaltigen Klippen, die man unter den empörten Schreien der Möwen Latte um Latte abtrug, um sie unter monotonem Gesang und nicht minder monotonen Hammerschlägen zu unschönen, aber robusten Transportkisten zu verarbeiten.
Nahe des Tauthrons versenkten zwei kräftige Packer des Wangoni-Stammes (ihre Rücken glänzten samten wie Ebenholz) das Teilstück eines versteinerten Oberarmknochens in einer Kiste, doch der gesamte Knochen, ein durch die Imprägnierung von Kalk und Kieselsäure bemerkenswert schweres Prachtstück, das der Gott des Zufalls und der Erosion in vierzehn Trägerlasten zerlegt hatte, würde mindestens sieben Kisten füllen: ein akademisches Geduldsspiel für die daheimgebliebenen Kollegen des Geologisch-Paläontologischen Universitäts-Instituts und Museums. Hennig schloss die Augen, Salzgeruch (die See), Teergeruch (das Tau). Auf die rötlich durchleuchteten Lider fiel bisweilen der wohltuende Schatten eines vorbeihastenden Arbeiters. Die hell schnarchenden Sägen und beharrlich tickenden Hämmer verwandelten den Kai allmählich in ein geheimnisvolles Telegraphenamt mit dornröschenhaft schlummernder Kundschaft, schonend zeigte man Hennig den Schalter, rückte das Formular unter der Feder zurecht – unvermittelt stieß ihn das Gelächter einer Möwe in eine kulissenhaftere Schicht seines Bewusstseins, wo man Dreispitz trug und danach trachtete, die Nichtexistenz der Terra australis zu beweisen. Lange Tage hatte er wartend im Kapitänslogis zugebracht, aber endlich lockte ihn das Freudengeheul der Mannschaft an Deck. Er stürzte an die Reling und erblickte den Landschwarm der Gesellschaftsinseln. In schmalen Einbäumen durchglitten singende Südseeinsulaner das leuchtend klare Meer, die Hämmer und Sägen waren verstummt, Hennig blinzelte, ausgelassenes Gelächter erfüllte den Hafen. «Massa Ennig!», rief einer der Kistenbauer. «Ich habe den verschollenen Europäer (mzungu) entdeckt!» Er zeigte mit dem Hammer auf ein volksfestartiges, tanzendes und jubelndes Tohuwabohu, das sich auf den Hafen zuwälzte.
Wamuera-Weiber mit Lippenscheiben und tätowierten Gesichtern stießen Kreischlaute aus, Kinder lachten, Suaheli-Männer (Hennig erkannte sie an dem kasmu genannten Ohrschmuck) sangen ein Spottlied, das die dümmlichen Gurrlaute einer brünstigen Taube zu imitieren schien. «Baba kufa», gurrten sie, «mama kufa, nyumba (miomba?) kufa, mimi nimebakia peke yangu tu, tu, tu, tututu.» Tu bedeutet eigentlich nur, aber in diesem Fall ergab das keinen Sinn, und Hennig vermutete eine reine Lautmalerei. Vater ist tot, übersetzte er ins Unreine, Mutter ist tot, mein ganzes Nest (oder der Onkel?) ist tot, nur ich bin ganz allein übrig geblieben, tu, tu, tu, tututu. Wahrscheinlich hieß es nyumba, das Nest, denn was interessierte die einsame Taube das Schicksal ihres Onkels!
Im Zentrum des Aufruhrs befand sich eine weißgekleidete Gestalt, und als der Menschenkreis kurz aufklaffte, sah Hennig, wie ein halbes Dutzend Wandonde-Weiber (jede einen glitzernden mboli im linken Nasenflügel) einem verschreckten Europäer rhythmisch an den Tropenhelm schlug, «tu, tu, tu, tututu», sangen die Suaheli-Männer dazu, ein nackter Junge entwendete dem Fremden den Kescher, «baba kufa, mama kufa», ein Schuss brachte sie alle zur Räson.
«Genug!», schrie Hennig in barschem Kisuaheli. Er beauftragte drei Arbeiter, das Gepäck des mzungu sicherzustellen, drei weitere, die aufgepeitschte Menge auseinanderzutreiben, feuerte, den Kolben auf den Oberschenkel gestützt, ein zweites Mal in die Luft, reichte seinem Boy das rauchende Gewehr und ging, die Augen mit der hohlen Hand beschirmend, dem Europäer entgegen. «Mein Name ist Hennig, und falls Sie Doktor Bahlow sind», dieser nickte matt, «darf ich Sie hiermit als Entomologen unserer Expedition in Afrika willkommen heißen. Ich sollte Sie eigentlich schon gestern abholen, aber nun ja …» Tu, tu, tu, tututu. «Es ist mir überaus peinlich», ratlose Geste, «aber wir haben den Dampfer erst heute Vormittag erwartet.» Schwebte, brannte, drehte sich: Auf dem verkohlten Holzscheit stand: Dr. Edwin Hennig. Kenne ich, dachte Bahlow, und aus einer glimmenden Schicht seines Gedächtnisses schoben sich weitere Teilstücke des an Bord verinnerlichten Dossiers, geboren 1882, Assistent am Berliner Geologisch-Paläontologischen Universitäts-Institut und Museum, rotglühende Schriftzeichen auf schwelendem Holz. «Ich bin, ich bin der …» Bahlow starrte seinen Retter an. Strohblond, braungebrannt wie ein Zigeuner, schwärmerische Gesichtszüge. Harmlos, hatte ihn Kuider am Quai du Port genannt, und das war wohl das treffende Epitheton, denn in Hennigs Auftreten lag eine anrührende, fast jungenhafte Ernsthaftigkeit. «Wir scheinen am Tendaguru ein kleines Problem mit dem Datum zu haben», erläuterte er mit unsicherem Lächeln. «Der liebe Gott hat uns wohl einen Tag geschenkt. Gestern ist bei uns heute, wenn Sie verstehen, was ich meine», Bahlow verstand seit geraumer Zeit gar nichts mehr, «und was in Lindi heute ist, ist am Tendaguru erst morgen. Ich hoffe, Sie hatten keine allzu großen Unannehmlichkeiten!» Unannehmlichkeiten? In gedankenverlorener Begeisterung packte Bahlow die Hand des anderen, schüttelte sie und hielt sie ungebührlich lange fest, wobei er wiederholt seinen Namen sagte und Hennig verständlich zu machen suchte, wie sehr dessen Hand an die eines ihm bekannten Masseurs erinnerte, und wie diese sich anzufühlen pflegte, sobald das warme Minzöl in die Haut eingezogen war. Bahlow gab Hennigs Rechte erst frei (nach einem letzten, entschiedenen Druck), als uhrwerkgleiches Gehämmer einsetzte.
Zeitgleich nahmen die Sägen ihr asthmatisches Todesröcheln wieder auf, jemand sang leise: «Tu, tu, tu, tututu», doch nur noch einige Kinder umringten die beiden Weißen; der eine ein bwana mkubwa, ein Vielkönner, ein Erdaufwühler, ein Schießgewehrchef, der andere ein poghuli, ein schwankendes Gespenst mit ausgestrecktem rechtem Arm und einem Gesicht so rot wie ein Affenhintern. Kiste, Fangnetz, Seesack, Reisetasche, die Träger brachten das Gepäck. «Wo zum Teufel ist mein Draht? Die Rolle Maschen… – ach, da kommt sie ja!» Dosmöhr, zofuß, dörknochan, im dröhnenden Maschinenraum unter Bahlows Sohlen berichtete Hennig von langen Seefahrten, beschwerlichen Fußmärschen, einem gigantischen Oberarmknochen, wozu brauchen Sie so viel Maschendraht? Verstehen Sie mich, Doktor Bahlow? Draht, Doktor Bahlow? Der Angesprochene vermochte der dahinplätschernden Rede keinen Sinn abzugewinnen. Die Worte verdampften in der flirrenden Luft, kaum dass sie seine Ohren erreicht hatten. Gelang es dennoch einem bis zu den Zähnen bewaffneten Wort, sich zu den uneinnehmbaren Festungen der Gehörgänge durchzuschlagen, zerfiel es auf der Stelle in rätselhafte Silben, die wie geschmolzenes Wachs auf das glühende Stück Erz tropften, in das sich sein Gehirn verwandelt hatte. Bilder. Bilder. Zu viele Bilder. Höher, Onkel Carl, höher! Jemand hielt ihm eine Flasche an die Lippen. Wasser. Er trank gierig. Danach war einiges klarer. So überraschte es Bahlow kaum, dass Hennig aussah, wie man sich einen Verfasser euphorischer Kurznotizen für das Archiv für Biontologie vorzustellen hat. Lediglich die Sommersprossen und das Y-förmige Grübchen im Kinn unterschieden den wirklichen Hennig von dem Phantom, das in der Kabine über dem Maschinenraum von «Schreckens-Echsen» und «Jahrhundert-Funden» berichtet hatte, aber ansonsten schmiegte sich die Wirklichkeit dicht an Kuiders Dossier. Wahrscheinlich, dachte Bahlow, ist darin jede meiner eigenen Bewegungen vorgezeichnet. Und folgt die Hand, die mir den rutschenden Tropenhelm aus der schweißfeuchten Stirn schiebt, nicht der Sandspur eines geheimnisvollen Plans? Muss ich nicht jedes Mal, wenn Hennig zu Boden blickt, unmögliche Gebärden und Handbewegungen vollführen, um die Welt wieder zu meinem Text zu machen? Für einen Moment glaubte Bahlow den bösartigen Puppenspieler zu erkennen, an dessen unsichtbaren Schnüren er hing, tellergroße Augen hatte der Allmächtige, kurze Haare, eine große Nase. «Du hast mich in einen lächerlichen Tropenanzug gezwängt und mir einen übergroßen Helm aufgesetzt», klagte die Bahlowpuppe, aber sogleich griff ihr Hennig in die straff gespannten Fäden und sagte beschwichtigend: «Sie sollten sich ausruhen. Kommen Sie! Hier ist Schatten. Sie haben sich mit Ihrem Gepäck ja völlig verausgabt! Hier. Hier können Sie gut sitzen. Hier, bitte! Ich hole Sie in einer Stunde wieder ab.» Fügsam setzte sich Bahlow auf eine Kiste. Hennig legte den Kopf schief. «Wo haben Sie eigentlich … «
«Wo habe ich was?», schnappte Bahlow.
Hennig schüttelte lächelnd den Kopf, als hätte er vergessen, was er fragen wollte. «Ruhen Sie sich aus!» Der Naseweis will natürlich wissen, wo ich die Nacht verbracht habe, aber Bilderbecks Name wird nicht über meine Lippen kommen! Niemals! Grimmig musterte Bahlow den neugierigen Paläontologen. Schlichter Strohhut (kein Helm!), eine helle Baumwollhose, die in staubigen Stiefeln steckte, über den Gürtel hing ein bis zum Sternum aufgeknöpftes Hemd. Hennig streckte die Hand aus, Bahlow wich erschrocken zurück, Hennig wandte sich kopfschüttelnd ab, ging davon.
Bei zwei Packern blieb er stehen, redete, gestikulierte. Der Schatten einer Möwe schwamm über seinen schweißdunklen Hemdrücken, stürzte ab, glitt rochengleich über den Lehmboden und beschrieb einen weiten Kreis um ein Holz-X aus zwei übereinanderliegenden Brettern. Die Welt ist eine Geschichte, weil sie aus meinen Worten besteht, dachte Bahlow in der verhassten Stimme seines Lateinlehrers. Meine Worte stehen vor den Dingen und verbergen sie. Meine Worte stehen zwischen mir und der Welt. Und trotzdem werde ich morgen meinen ersten Bericht niederschreiben, um darin alles aufzuzeichnen, was wichtig ist. Aber was ist wichtig? Was muss ich beobachten? Worauf muss ich mein Augenmerk richten? Auf mich? Ja, das ist wichtig! Und auf alles, was um mich herum geschieht. Das ist auch wichtig! Auf der rissigen Lehmhaut des Kais scheint sich beispielsweise alles um Kisten zu drehen. So könnte man das durchaus im Bericht darlegen. Dort baut man Kisten zusammen, umhüllt einen Luftwürfel mit Holzbrettern, hier füllt man verschnürte Pakete in Kisten, trägt sie davon, nagelt Deckel drauf, etikettiert sie, und neue Kisten, und neue Kisten. Als Kuider ihn nicht ansah, bestellte Bahlow einen weiteren Absinth. Vielleicht sollte ich die Jacke ausziehen und die Ärmel des Hemdes hochkrempeln. Hier in Afrika legen nur, ein erdbebenähnliches Gelächter erschütterte sein Gehirn, Holzkisten Wert auf Etikette. Mädchen in Männerhosen, über den Gürtel hängende Hemden, ein aufgeregter Telegraphist stürzte auf Bahlow zu, berührte ihn mit einem riesigen, tickenden Nussknacker am Oberarm, was wollen Sie von mir, Mann, Hennig hielt ihm eine Zeitung hin, das Telegraphenamt löste sich mit einem leisen Zischlaut auf, verschwand, Bahlow griff die Zeitung und versuchte, die Schlagzeilen zu entziffern.
«Nein», lachte Hennig mitleidig. «Für Ihren Helm.»
Bahlow verstand nicht.
«Als Futter.»
«Haha! Futter für meinen Helm!»
«Damit Ihr Helm nicht rutscht!»
Beschämt ließ Bahlow die Zeitung sinken.
«Fühlen Sie sich jetzt besser? Hier im Schatten?»
«Ein wenig. Bin dieses Klima nicht gewöhnt. Kann kaum denken.»
«Heben Sie sich das Denken für später auf, wenn Sie mit Ihren Forschungen beginnen. Nehmen Sie regelmäßig Ihr Chinin?» Bahlow wollte die Frage bejahen, doch da war niemand mehr, um die Antwort zu hören. Hämmer. Sägen. Ach, da kam Hennig wieder. «Schlucken Sie das! Nein, nicht ausspucken! Runterschlucken! Ja, so ist es gut.» Hämmer. Sägen. Ach, da kam Hennig wieder. «Sind Sie nun in der Verfassung, aufzubrechen?» – «Ja, warum denn nicht? Aufbrechen? Sofort, bitte! Auf, auf! Mein Tatendrang ist nicht zu bremsen! Aufbrechen? Bitte, ja, sofort!»
Kaum zwanzig Minuten später bildeten die beiden Weißen den Zwillingskopf einer fünfzig Mann starken Trägerkarawane, die den Staub von Lindis Straßen aufwirbelte, unsortiert dahinschritt und erst am Dschungelrand zu einer anmutigen Schlange wurde, die sich durch ein von Kasuarinen flankiertes Öhr auf einen schmalen Pfad zwängte. Die Träger waren barfuß, hatten bunte knielange Tücher um die schmalen Hüften geschlungen, und wenn Bahlow sich umsah, glänzte kaum einen Meter von ihm entfernt ein schwarzer, tätowierter Brustkorb. Die Wamuera erkenne man an den Tätowierungen, Hennig redete und redete, die vier Sargträger, die Bahlows Kiste auf zwei dicken Bambusstäben trugen, seien Wangoni, kleine Zöpfe sprossen in irritierender Willkür aus kahlen Schädeln, Hennig schwärmte von nie geahnten Erfolgen, klagte, es sei nicht leicht, mit von Geinitz auszukommen, kam übergangslos auf die Schönheit der Natur zu sprechen und begleitete die Rede mit fahrigen, linkischen Gesten. «Die großartigen Sonnenuntergänge! Sie werden begeistert sein! In der Südsee soll es ähnlich prachtvolle Sonnenuntergänge geben. Kürzlich habe ich etwas in einer Reisebeschreibung gelesen …»
Bahlow, dessen Tropenhelm gesättigt war und angenehm still saß, unterdrückte ein Schmunzeln; Hennig schien ein ernsthaftes Problem mit James Cook zu haben. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit führte der junge Mann den augenscheinlich pathologisch verehrten Entdeckungsreisenden ins Feld. Hier-und-da habe Cook etwas Vergleichbares erlebt, in dieser oder jener Situation hätte sich Cook so-und-nicht-anders verhalten, überhaupt werde Cook von dem-und-dem verkannt. «Überhaupt wird Cook von allen verkannt!», rief Hennig aus, und Bahlow begann zu argwöhnen, dass man sich vielleicht niemals an das unbarmherzige afrikanische Klima gewöhnte, ein Verdacht, begleitet von jenem süßen Triumph des Schülers, der seinem Lehrer eine Lektion voraus zu sein glaubt: Hennigs Tic war nämlich in dem ansonsten so umfassenden Dossier mit keinem einzigen Wort erwähnt worden. «Oh, sehen Sie nur!» Aus den Baumkronen beobachteten sie kleine Charles Darwins; langgezogene, flache Wolken glitten durch den tiefblauen Himmelsteich über einer Lichtung; nicht jene unförmigen Galeonen des Nordens (den schwarzen Bauch voller Regen), sondern elegante, schnelle Einbäume. James Cook wollte wissen, was es Neues in der Heimat gebe. Bahlow fielen nur Banalitäten ein. Im Juli letzten Jahres überflog Louis Blériot den Ärmelkanal in 37 Minuten. Theobald von Bethmann Hollweg hatte von Bülow als Reichskanzler abgelöst. Ein winziges Insekt kreuzte den Pfad und Bahlows Überlegungen. Er bückte sich nach der Rarität, einem Exemplar der Familie der Psociden, deren Kenntnis in Europa mehr als nur lückenhaft war.
Bei dieser Art schien es sich um eine Varietät der europäischen Pterodela pedicularia L. zu handeln, ah, das ist ja interessant! Der Ramus radialis und die Media in beiden Vorderflügeln und im rechten Hinterflügel verbindet eine kurze Querader, und am Vorderflügel, wieso am helllichten Tage, Pterodela fing man nachts mit dem Lichtselbstfänger, wieso sehe ich so scharf ohne Lupe, ohne Mikroskop, eigenartige Abnormität im rechten Vorderflügel, die Analis in ihrer halben Länge mit dem Cubitus verwachsen, oder liegt hier etwa ein Exemplar der Gattung Psyllipsocus vor, wieso am helllichten Tage, wieso ohne Mikroskop, ein Riesenexemplar der Familie der Scarabaeidae stieß an seine Stiefelspitze, Bahlow berührte die Flügeldecken mit der Daumenkuppe, drückte, der Käfer ging mit zitternden Beinchen in die Knie, ein Schatten fiel auf Bahlows Hand.
«Was haben Sie denn da Schönes aufgespürt?», fragte Hennig.
«Gute Fanggründe», murmelte Bahlow stirnrunzelnd, ließ den Käfer entkommen, und die Karawane, die hinter ihnen in ehrfürchtigem Staunen erstarrt war, ein Käfermann, ein Käfermann, setzte sich wieder in Bewegung. Was gab es Neues in der Heimat? Bahlow dachte angestrengt nach. Vor seiner Abreise hatte ihm ein inzwischen in Hildesheim lebender Freund etwas Kurioses erzählt. Nein, eigentlich kein Freund, korrigierte sich Bahlow, sondern ein ehemaliger Internatsgenosse, ein seltsamer Bursche, der immer damit geprahlt hatte, er habe Knies, was sich nach langem Forschen der Mitschüler als weiße Schmiere unter dem Preputium entpuppt hatte. Knies! Ob er Hennig vom Knies erzählen sollte? Besser nicht. Vielleicht hatte Hennig selber Knies, und es wäre ihm unangenehm, darüber zu reden. «Hildesheim hat ein Selbstwähltelephonamt», sagte Bahlow.
«Ein Selbstwähltelephonamt?»
«Man kann dort seine Ortsgespräche selbst wählen.»
«Na», Hennig versuchte beeindruckt zu klingen, «die Heimat hat für uns verlorene Söhne sicherlich noch einige Überraschungen in der Hinterhand. Aber warten Sie erst einmal ab, bis wir Ihr neues Zuhause erreicht haben! Sie werden erstaunt sein, Doktor Bahlow! Der Urwald um Lindi täuscht. Bald beginnt die Obstgartensteppe, und außer dem hohen, dichten Gras und dem Bambus wird die Landschaft keinen sonderlich tropischen Eindruck mehr machen. Lichter Waldbestand, dünne Stämme, alles recht kümmerlich, aber für die Grabungsarbeiten durchaus von Vorteil. Der Name ‹Obstgartensteppe› ist überaus bezeichnend für diese Vegetationsform. Nur vereinzelt ragt eine Akazie oder eine Borassuspalme über die übrigen Wipfel empor, und nur selten verdichtet sich das Pflanzenkleid in einer kaum wahrnehmbaren Mulde zu zusammenhängendem Gebüsch oder Bambusgestrüpp.» Bahlow hörte aufmerksam zu und dachte in einem Anflug von Rührung daran, dass Hennig seine Braut «Mausebärchen» nannte. Kurz darauf fielen ihm die «Schreckens-Echsen» ein, er gluckste verhalten, zügelte aber auch weiterhin das Verlangen, sein Wissen preiszugeben oder von Bilderbeck und dem überdimensionalen Nussknacker zu erzählen, ein Bedürfnis, das merkwürdigerweise die Atmosphäre heiterer Aufgeräumtheit begünstigte, in der die beiden Männer nebeneinander einherschritten. «Die Eingeborenen», erzählte Hennig, «unterscheiden hier drei für das praktische Durchkommen verschiedene Vegetationsformen: yangwa = offene Grassteppe oder auch lichter Hochwald, mwitu = dichter, meist undurchdringlicher Busch oder Dornbusch und pori, das zwischen beiden die Mitte hält, also etwa Baumgrassteppe oder wie hier: Obstgartensteppe.»
Diese Unterscheidung der Vegetationsformen schien Bahlows eigenen Lebensweg widerzuspiegeln: Alles hatte mit der yangwa einer sorglosen Kindheit begonnen, dann durchstachen erste Barthaare die Oberlippe, Vorboten des grässlichen pori, und einige Jahre später mündete der ganze Schlamassel im Garten des von Herderschen Anwesens in eine undurchdringliche mwitu, zu der auch dieses Dornengestrüpp der Geheimnistuerei zu gehören schien, in das ihn erst Kuider in Marseille, dann Bilderbeck in Lindi gestoßen hatten. Einen verschwundenen Mann suchen! Beobachten! Berichten! Wem sollte er denn Berichte schicken? Der Firma nach Dresden-Blasewitz? Zu Händen von Herrn Kuider? Aber der hatte nicht gerade den Eindruck erweckt, für die Firma zu arbeiten. Und auch Bilderbeck arbeitete wohl kaum für die Insektenhandlung Staudinger & Bang-Haas. Aber für wen dann? Für jemanden, der sich als Otto Staudinger ausgab? Selbst die Spatzen pfiffen es von den Dächern, dass der 1830 geborene Mitverfasser des Catalogs der Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes vor zehn Jahren verstorben war! Oder doch nicht? Bahlow kam ein ungeheuerlicher Verdacht, und er musste kurz stehen bleiben, ehe er die Kraft hatte, weiterzugehen. Ob man die Seiten seines Lebens zwischen den zerfledderten Umschlag eines Groschenheftes geklemmt hatte, damit er als Nick Carter dem berüchtigten Verbrecherkönig Carruthers im Todesdschungel Deutsch-Ostafrikas das Handwerk legte? Mit der kleinen Einschränkung allerdings, dass sein Carruthers Valdsky hieß und seit vier Monaten verschollen war. Dem Dossier waren Photographien beigefügt. Auf jeder sieht der hagere Missionar mit den eingefallenen Wangen und der prachtvollen Hakennase am unbekannten Photographen vorbei und lächelt unglücklich den Daumen des Betrachters an.
Mit einem Mal begriff Bahlow, wieso ihm Bilderbeck Valdskys Sherry aufgenötigt hatte: Nur so konnte der Verschwundene den Suchenden entlohnen, noch bevor dieser die Suche aufnahm. In genau jenem Augenblick, als Bahlow den ersten Schluck von Valdskys Sherry getrunken hatte, war er zu einem Teil von Valdsky geworden – und Valdsky zu einem Teil von ihm. Valdsky hatte ihn also, obwohl er abwesend war, mit dem trockenen, weißen Sherry getauft. Bahlow nahm sich vor, den ersten Bericht mit einer scharfsinnigen Analyse dieser Theorie zu beschließen, der Pfad machte einen scharfen Knick und schleuderte seine Gedanken in eine andere Richtung. Viehzeug. Raschelnd. Zwitschernd. Bahlow erkundigte sich nach der hiesigen Tierwelt, zu der, wie sich herausstellte, Elephanten (törö), Flusspferde (selten), Nashörner (gefährlich), Riesenkatzen (haha, Riesenkatzen!), Giraffen (Bahlow merkte an, wie sehr er sich darauf freue, diese Bierlaune Gottes leibhaftig zu sehen) und Vögel gehörten, wunderbare Vögel! «Dieser ungeheure Farbenglanz der Vogelwelt!», rief Hennig aus. Sehr unangenehm dagegen seien die Schlangen. «Kürzlich spielte sich in Doktor Janenschs Hütte die nächtliche Jagd zwischen einer Schlange und einem Frosch ab, wobei es dem Frosch nur durch ein beherztes Einschreiten Janenschs gelang, mit dem Leben davonzukommen. Einmal lauerte auf der Schwelle unseres Pavillons eine Puffotter. Lachen Sie nur! Sie werden früh genug erfahren, wie wenig ich spaße! Und fast täglich finden wir in den Hütten der Arbeiter Speischlangen, eine Spezies, die es versteht, ihr Gift schon aus gewisser Entfernung dem vermeintlichen Feind ins Auge zu schleudern. Doch kommen wir zu den Insekten.» Bahlow zwang sich, aufmerksam zuzuhören. «Skorpione, Hundertfüßer, Termiten, Beißameisen, Heuschrecken und enorme Raupen gibt es am Tendaguru in Hülle und Fülle, doch mit der Zeit gewöhnt man sich an alles, sogar daran, dass man regelmäßig Stinkwanzen als Buchzeichen findet, im Rockärmel, im Teewasser und Motten in der Suppe und Termiten an den Ledergamaschen und Schlupfwespen im Zelt und Ameisen im Bett und Kakerlaken in den Koffern. Weitere Plagegeister aufzuzählen, verbietet mir der gute Ton. Aber das ist nur ein Tropfen auf den sprichwörtlichen heißen Stein im Vergleich zu der Asselplage, an der Cook auf seiner dritten und letzten großen Fahrt litt. Die Asseln fraßen die Vorräte, nagten Löcher in die Segel, zerfransten das Tauwerk, ja, die Asseln fraßen sogar die Tinte von Cooks Aufzeichnungen …»
Unterdessen hatte die Karawane ihren Weg nordwärts an der Bucht entlanggenommen und überstieg nun (etwa in der Linie der Telegraphenleitung) die sich eng an die Küste schmiegende Mauer des lehmigen Kitulo-Rückens. Redete Hennig nicht, pfiff er vor sich hin, unbekümmert und falsch wie ein Kind. Überall krabbelte es, summte es, saß im Gras, putzte sich die Fühler, huschte hierhin, flog dorthin, Bahlow konnte kaum erwarten, den Lichtselbstfänger aufzustellen, der in der Reisekiste jede Unebenheit des Weges mit vorwurfsvollem Geklirre kommentierte. Hoffentlich erzählte die Kleine niemandem, dass er sie berührt hatte. Aber Bilderbeck musste ihn ja mit Valdskys Sherry betrunken machen! Ob es wohl an dieser Taufe liegt, dass es mir nicht vergönnt ist, in mein afrikanisches Abenteuer einzutauchen wie in einen Badezuber heißen Wassers, um nach Herzenslust darin herumzuplantschen? Bahlows Schritte verloren die Selbstsicherheit, unter seinem rechten Auge begann ein Muskel zu zucken, er brauchte Abstand, um kritisch beobachten zu können, schonungslosen Abstand zu der dicklichen nassgeschwitzten Person, die mit offenem Mund den Ausführungen eines jungen Schwärmers folgte. «Wie ein Käferlein am Boden eines Kornfeldes, so zieht der Mensch durch diese Wäldermassen, ohne Kenntnis dessen, was ihn umgibt, ohne die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, ohne auch nur die allernächste Umgebung beim Marsche überblicken, ja zur Zeit der Grasherrschaft oft selbst ohne den Boden unter den Füßen sehen zu können.» Hennig ließ noch mehrere solcher wohlformulierten oder auswendiggelernten Sentenzen vom Stapel, bis sie nach einigen, schier endlosen Marschstunden ihr Lager in Yangwani aufschlugen und die weite Talaue, die sich zwischen dem Kitulo und den dahinter gelegenen höheren Plateaus des Lindi-Hinterlandes erstreckte, mit ihren hellgrauen Zelten überzogen.
Um sich die Zeit bis zum Abendessen zu vertreiben, schlug Hennig Schießübungen auf Sodaflaschen vor, derweil sich die Träger mit Ringkämpfen oder Musik unterhielten, wobei besonders der Gesang der Wangoni, eines überaus musikalischen Zulustammes, wie Bahlow ungefragt erfuhr, den europäischen Ohren zusagte. Bahlow warf Hennigs Boy das Gewehr zu, dieser lud es, reichte es Hennig, und eine Sodaflasche zerspritzte zu einem Regenbogen aus Glas. «Guter Schuss!», meinte der glücklose Bahlow. Beiläufig: «Was wurde eigentlich aus diesem … ähm … Missionar?»
Hennigs Boy lud das Gewehr und reichte es dem Entomologen.
«Sie meinen Valdsky? Er ist verschollen. Wahrscheinlich tot. Als er verschwand, hielt ich mich, wenn ich mich recht entsinne, in Lindi auf, und als ich zum Lager zurückkehrte, war er nicht mehr da, was jedoch, um ehrlich zu sein, niemanden sonderlich traurig stimmte, denn Valdsky, selig, war ein schwieriger Zeitgenosse. Hatte ständig Meinungsverschiedenheiten mit von Geinitz.» Unwillkürlich berührte Bahlow den speckigen, durchgeschwitzten Briefumschlag, den er diesem überbringen sollte. «Es kam zu Handgreiflichkeiten! Herr Besser von der Niederlassung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft hielt Valdsky von Anfang an für einen Aufschneider. Vielleicht hat ihn, doch dies ist nur eine Gedankenspielerei, von Geinitz enttarnt, und Valdsky sah sich gezwungen, das Weite zu suchen.» Was für ein ausgezeichneter Eistee im Bezirksamt serviert wurde!
Bahlow legte an, zielte und schoss daneben. «Ein Aufschneider?», hakte er nach.
«Behauptet jedenfalls Herr Besser, der über gute Informationsquellen verfügt. Er ist Protegé Seiner Hoheit des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg.» Aha, daher weht also der Wind! Schon streifte die vorsichtige Tangente seiner Nachforschungen die einflussreichen Kreise, von denen Kuider gesprochen hatte! Hennig legte an. «Besser wirft ein wachsames Auge auf von Geinitz. Unser», spotttriefend, «Sicherheitsbeauftragter denkt nämlich, er wäre der Leiter unserer Expedition. Von Geinitz ist ein unangenehmer Kadett, wir ertragen ihn wie eine Grippe, aber Sie», wieder zerbarst eine Flasche, «werden ihn früh genug kennenlernen. Sitaki kusoma kitabu! Haben Sie Hunger?»
«Sehr!», log Bahlow, der seine ungenügenden Schießkünste kein weiteres Mal unter Beweis stellen wollte. Nach dem Abendessen (es gab Brot, Dosenfleisch und Sodawasser) zog ihn das angsteinflößende Gefühl, genau das zu tun, was man von ihm erwartete, hinaus in den flüsternden Dschungel. Unter dem pantomimisch dargestellten Vorwand, austreten zu müssen, entfernte er sich von den frech grinsenden Wachtposten und lehnte gut hundert Meter vom Lager entfernt das Gewehr an einen Baumstamm, dessen Rinde sich Segment um Segment in den violetten Abendhimmel schob wie ein aufrecht balancierender Regenwurm. Die Römer, erinnerte Bahlow sich, hatten die gut elf Zentimeter langen, fingerdicken Larven des Hirschkäfers als Delikatesse betrachtet, und weil die Larven nur in vermodertem Eichenholz gedeihen, hatten die exotischen Gaumenfreuden nicht abgeneigten Eroberer Eichenstrünke und ganze Baumstämme in die feuchtdunklen Waldstücke ihrer nördlichen Provinzen geworfen, weil sie dort ein hohes Hirschkäferaufkommen beobachtet hatten.
Dicht neben Bahlows rechtem Stiefel erklomm ein Käfer das schrundige Riff einer freiliegenden Wurzel, ein großes Exemplar der Gattung Meloe, circa 35 Millimeter lang, ein Weibchen mit dickem, langem Hinterleib. Bahlow griff den Käfer mit behutsamen Pinzettenfingern, hob ihn hoch, merkte kaum, dass es wieder geschah, und schon strich seine Zunge über den sandig glatten Panzer, und schon verhakten sich behaarte Beinchen zwischen seinen Zähnen. Die Käfer dieser Gattung haben so dicke Hinterleiber, dass bei ihnen eine spezielle Art der Präparation erforderlich ist. Im Gegensatz zu fast allen übrigen Koleopteren, die man einfach austrocknen lässt, muss man den Exemplaren der Gattung Meloë den Hinterleib aufschneiden, die schillernden Innereien entnehmen und den Hohlraum mit Watte ausstopfen; ansonsten verfaulen die Käfer, da ihre Chitinhaut sehr dünn ist. Vorsichtig trennten Bahlows Schneidezähne den Halsschild vom Hinterleib, er spürte Bewegung im Mund, Feuchtigkeit, tastende Beinchen, Fühler, seine Zunge glitt über den feinen Schlitz der Flügeldeckennaht, und er begann wie auf einen geheimen Befehl hin zu kauen. Modrig, erdig, im Geschmack an vergammelte Miesmuscheln erinnernd oder mehlige Kartoffeln mit Knies.
Ohne erkennbaren Zusammenhang musste Bahlow an seinen Lateinlehrer denken, diese gefürchtete Autorität, die ihn in das von Herdersche Haus eingeführt hatte. «Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur anni!», hatte der Alte oftmals in zornigem Spott ausgerufen. «Na, meine Herren? Von wem mag das wohl sein?» – «Horaz!», antwortete die verängstigte Klasse wie ein Mann.
Ach, flüchtig entgleiten die Jahre …
«Herr Doktor Bahlow?»
Ertappt schluckend: «Ja?»
«Ach, hier sind Sie. Ich habe mir Sorgen gemacht.»
«Ich», Bahlow zupfte ein Käferbein von der Unterlippe, «war nur», Wind kommt auf, «wo selbst die Könige», blättert weiter, erstirbt. Als der Entomologe aus einem wirren Traum von unterirdischen Gängen und Kammern erwachte, schlug sein Herz nicht mehr. Die Geräusche der Steppe umwogten das Zelt wie jenseitiges Gelächter. Bahlow horchte einige Minuten vergeblich in sich hinein und betastete das Handgelenk, doch da war kein Puls. Bestürzt richtete er sich auf. Die Segel- und Taschenklappen seines Herzens hatten die Arbeit eingestellt; kein Blut strömte mehr durch die Arterien und Arteriolen. Rasch befreite er sich vom Moskitonetz, rutschte auf den Knien zum Zelteingang und schlug die Plane zurück. Gelbes Mondlicht beleckte seine pelzigen Oberschenkel und die schattige Grube der Scham, in der eine verschreckte Hirschkäferlarve schlief. Hennig, dessen feldherrliches Zelt kaum einen Steinwurf entfernt stand, veranstaltete gerade mit Hilfe einer flackernden Petroleumlampe fröhliches Schattentheater, indem er (wie um Bahlows Leid zu verhöhnen) die bucklige Gestalt eines schreibenden Gnoms auf die mottenfleckige Plane warf. Bisweilen hielt das schwarz gefiederte Abbild einer dämonenhaft vergrößerten Klaue inne, dachte nach und huschte daraufhin wieder emsig über das unsichtbare Papier. Bahlow räusperte sich, prompt hob Hennig den Schattenkopf, lauschte. Bahlow hielt den Atem an, bis der bohnenförmig gebogene Schädel wieder im Buckel des Kobolds eingesunken war. Nein, darüber durfte er nicht reden. Was sollte er Hennig denn erzählen? Entschuldigen Sie, aber ich fühle mich auf einmal so tot? Nein, das war höchstens ein Adnex für den Bericht. Darüber durfte man nur schreiben, niemals reden! Bahlow biss sich in den Unterarm und registrierte dankbar, wie ein stetig anwachsender Schmerz aus dem seitlich geöffneten Oval drang, das die Zähne in die Haut prägten. Na, also! Empfände ein Toter Schmerzen? Wohl kaum. Also bin ich nicht tot. Doch diese Schlussfolgerung hatte einen Haken, an dem ein verfaulter Köder hing: Was, wenn dies alles eine schreckliche, der Vorhölle verwandte Abart der Unsterblichkeit wäre? Der Schatten in Hennigs Zelt wuchs ins Unermessliche, räkelte sich, vollführte einige grazile Tanzschritte, die Bahlow an der Geistesverfassung des Paläontologen zweifeln ließen, und löschte die Lampe. Ich bin tot, dachte Bahlow, ich bin in der Hölle. Erst fahren sie mich unter einem unbarmherzig weißen Himmel über den Styx, dann holen mich irre Teufel am Hafen ab. Einer schleppt mich zu seiner Tochter, der andere zu James Cook, der breitbeinig auf dem Tendaguru hockt und die Sterne in seinen Riesenfäusten zerquetscht. Knackendes Geäst, flüsterndes Gras, der Dschungel kicherte und zirpte, in immer kürzeren Abständen fielen Bahlow die Augen zu, doch erst als seine Beine völlig zerstochen waren, kroch er zurück unter das schützende Moskitonetz, um mit auf der Brust gekreuzten Armen im herzschlaglosen Meer der Nacht davonzutreiben. Loch. Unter uns. Schwarz. Tief. Nicht reinfallen! Obacht! Am jenseitigen Rand des Loches angekommen, schob sich ein luftiger Teppich aus Vogelgezwitscher unter Bahlows Füße, der Schlaf glitt auf die hohe See zurück, der Schiffbrüchige erreichte das Ufer und schüttelte die Stiefel aus, in denen mehrere Stinkwanzen und ein Hundertfüßer eine erschöpfende Orgie gefeiert hatten. Die Stinkwanzen entwichen, der perplexe Hundertfüßer stellte sich nach einigen Sekunden tapsigen Umherirrens tot, ein starres, beinbewehrtes Stöckchen, das Bahlow zertrat, ehe er das Zelt verließ.
Natürlich schlug sein Herz, hatte es die ganze Zeit über getan, aber dennoch kehrte der Lebenswille (ein entpuppter Falter, dessen Flügeladern sich nur allmählich mit Blut füllen) erst zurück, als er sich am Ufer eines brackigen Tümpels reinigte. Mit dem Lebenswillen kam die Angst. Plötzlich erinnerte Bahlow sich nämlich daran, dass Hennig ihm erzählt hatte, wie häufig man neben den üblichen Antilopen- und Schweinespuren die Fußabdrücke von Leoparden oder Löwen in Lagernähe finde.
Er kehrte in einem Zustand mitteilsamer Auflösung zu den Zelten zurück; Hennig erwartete ihn mit einer zerbeulten Blechkanne und einer Tasse ohne Henkel. «Hier, trinken Sie einen Kaffee. Sie sehen aus, als ob Sie im letzten Augenblick dem Schlund eines Löwen entkommen wären! Zucker? Zu stark?»
«Auf gar keinen Fall. Nehmen Sie keinen Kaffee?»
«Ich habe schon. Sie sollten einen bewaffneten Boy mitnehmen, wenn Sie sich vom Lager entfernen.»
«Unglaublich, dass es Leute gibt, die ihr Leben ohne Kaffee fristen!» Bahlow leerte die Tasse, die Zelte wurden abgeschlagen und verstaut, dann marschierten sie weiter.
«Eine Frage, Doktor Bahlow! Haben Sie sich jemals mit der Paläontologie beschäftigt?»
«Nicht näher …» Er kratzte sich unauffällig am Oberschenkel. «Meine paläontologischen Kenntnisse beschränken sich auf die Beobachtung von Silberfischchen in Pariser Hotelbadezimmern.»
«Na, immerhin!», sagte Hennig, und Bahlow beeilte sich hinzuzufügen, er habe durchaus vor, seine Defizite in dieser jungen Wissenschaft («in dieser im Vergleich zum untersuchten Gegenstand bestürzend jungen Wissenschaft») mit Hennigs freundlicher Hilfe wettzumachen.
«An mir soll es nicht liegen», lachte Hennig, und die Art, wie er Bahlow dabei ansah, ließ diesen argwöhnen, dass er dem jungen Mann leid tat. Seltsam. Er tat Hennig leid. Das muss man sich erst einmal vorstellen! Er, der mittlerweile eine Monographie über James Cook hätte schreiben können, tat Hennig leid! Und gleichzeitig tat ihm Hennig leid, eigentümlich, die Überlegungen bogen sich zum Kreis, dieser begann zu rotieren, und ehe Bahlow schwindlig werden konnte, brachte er den Kreis zum Stillstand, indem er ihn in Gedanken energisch durchstrich. Gleichzeitig blieb auch Hennig stehen und zog den Kompass zu Rate. «Es geht immer nach Nordosten.» Die Nadel zitterte unter dem streng prüfenden Blick. «Nur ein Narr könnte den Tendaguru verfehlen.»
«Und was ist das?», fragte Bahlow und deutete mit der Wasserflasche auf eine Schirmakazie, in deren flachgedrückter, schiefer Krone seltsame Früchte baumelten.
«Nester des Webervogels.»
«Vogelnester?»
«So ist es», lachte Hennig.
«Schön», sagte Bahlow. «Und ich dachte schon …»
«Was dachten Sie?»
«Nichts», murmelte er. Dieser niederländische oder war es ein flämischer Maler, der diese Kreaturen, als sie am Strand spielten, schwarzweiße Reproduktionen in einem illustrierten Journal, am Strand, der eine Eule fliegen ließ, die Hitze lähmte das Denken am Strand, seine Füße marschierten im Rhythmus gedachter Lieder, eine Eule fliegen ließ, bei jedem Schritt blinkten Silben im Kopf auf, un, be, klei, det, am, Strand, ahh, ohh, uhhh, Bahlow erlief Worte, ganze Sätze, die Zeilen eines vulgären Gassenhauers, und nur in den kurzen Pausen zwischen Kehrreim und nächster Strophe war die ferne Stimme seines Begleiters zu vernehmen. Gelegentlich wurde es jedoch, und das war sehr schlimm, totenstill, und Bahlows Gedanken segelten auf den stygischen Gewässern einer bangen Gewissheit voraus. Dennoch war es nicht zu leugnen, dass man ihn sah. Hennig sah ihn. Die Neger sahen ihn. Und es war ebenfalls nicht zu leugnen, dass sein Herz schlug. Und wie es schlug! Nanu? Was hatte diese Aufregung zu bedeuten! Humba, humba, täterä! «Was sagen die?»
«Sie wollen, dass Sie mitkommen», übersetzte Hennig.
Von nun an riefen die Träger fast viertelstündlich Bahlow herbei, um ihm einen Käfer oder ein großes Insekt zu zeigen und danach strahlend zu beobachten, wie der Käfermann es durch einen eleganten Schwung des Fangnetzes seiner stetig wachsenden Sammlung einverleibte. Nur selten hörte man noch Gelächter oder ein leise gesungenes baba kufa, mama kufa. Und weiter, weiter. Fuß vor Fuß. Wassertrinken. Uff! Und weiter, weiter. Fuß vor Fuß. Wassertrinken. Uff! Nachdem zwei seichte Zuläufe des Namgaru durchschritten waren, marschierte der kleine Trupp zwischen dem Likonde- und dem Notoplateau hinaus in das freie, weite Land der Obstgartensteppe. Mit Bahlows Gesicht tat sich derweil Erstaunliches. Als Kinder hatten sie die Ohrenquallen, die der Ostwind in die Förde drängte, aus dem Meer gefischt und sich damit erbitterte Schlachten geliefert. Hätte man ihm damals hingegen eine mit einem Stock geschleuderte Feuerqualle ins Gesicht geworfen, danke sehr, ich habe genug gesehen, Bahlow gab Hennig den Taschenspiegel zurück, das abgestandene Wasser des Tümpels hatte seiner ohnehin entzündeten Gesichtshaut übel mitgespielt.
«Verzeihen Sie! Ich hätte Sie vor stehenden Gewässern warnen sollen.»
Bahlow rang sich ein Lächeln ab. «Nun habe ich es selbst herausgefunden. Der Sonnenbrand tut sein Übriges.» Sein Unsriges? Unsriges fernem Heimats? Bahlow ergriff ein schmerzhaftes Heimweh nach Kiel, dieser kühlen, in Dunst und Sprühregen gehüllten Stadt, auf deren breiten Chausseen der Seewind regierte. Als er – oh, wie lange das nun schon her war! – das Hauptpostamt verließ, hatte der salzige Ostwind alle Wolken vom Himmel gewischt, und wie die Straßen damals dampften! In Kiel brauchte man keinen Kompass, in Kiel kannten die Füße ihren Weg, wählten Abkürzungen, erinnerten sich an Schleichpfade, blieben artig stehen, damit man die Auslage eines Tabakladens gebührend bewundern konnte. Und weiter, weiter. Fuß vor Fuß. Wassertrinken. Uff!
Am vierten Tag des Marsches verschwand der Kompass in Hennigs Brusttasche, um daraus nicht wieder aufzutauchen, denn inmitten des Flachlandes erhob sich der Tendaguru, trotz seiner geringen Höhe eine deutliche Landmarke; und in den frühen Morgenstunden des fünften Tages erreichten sie das Gebiet der Grabungen. Bahlow bot sich ein Bild der Verwüstung. Zu beiden Seiten des Pfades zogen sich mannstiefe Gräben hin, kreuzten den Weg unter durchhängenden Holzbrücken, bildeten ausgeschachtete Schlaufen und Kreise, die sich allein den Vögeln als Buchstaben einer geheimnisvollen, in den Erdboden gegrabenen Schrift offenbarten. Zog die Karawane aus Lindi vorüber, sahen die Arbeiter aus den Gruben auf und stützten sich auf ihre Hauen und Schaufeln. Hennig begrüßte die Aufseher gutgelaunt und auf Kisuaheli. Bahlow ließ es bei einem unverbindlichen Nicken bewenden, visierte dabei den einen oder anderen Neger an, doch bald wurde sein Nicken vager, unsicherer, und schließlich gab er es ganz auf. «Da staunen Sie, was?» Der Pfad umschlang einen gewaltigen Haufen neben einer etwa fünf Meter tiefen, stufenförmig angelegten Ausschachtung, die Wände schräg, mit Bambusgeflecht verschalt. Am Boden der Grube, einer mit rötlichem Sand gefüllten Wunde, hockte ein gutes Dutzend Arbeiter mit bloßen, schimmernden Oberkörpern. Sie legten das steinerne Rückgrat eines Dinosauriers frei, bewegten Hammer und Meißel zum rhythmischen Gesang des Aufsehers. Zwischen den Wirbeln kamen schmale lange Messer und kleine Handbesen aus bunten Vogelfedern zum Einsatz. «Die herausgewitterten Knochenstücke sind, obwohl durch Sonne und Regen zersplittert und zersprengt, wichtige Wegweiser», dozierte Hennig cooklos. «Wie die Spitze eines Eisberges zeigen sie uns an, wo sich etwas verbirgt. Dort, wo die eigentlichen Saurierschichten die Oberfläche bilden, ist der Pflanzenbewuchs glücklicherweise kümmerlich: Es herrschen armselige, kaum mehr als mannshohe, unregelmäßig gewachsene Bäumchen vor. Selbst das Gras ist dort erheblich niedriger und lässt zwischen seinen Büscheln den bloßen Erdboden sichtbar bleiben – ein Vorteil für die Grabungsarbeiten. Stellen Sie sich nur vor, eine gierige, paläontologisch interessierte Akazie würde mit mächtigem Wurzelwerk die Wirbelsäule einer Schreckens-Echse umklammern, um sie nie mehr herauszugeben!» Wer war dieser Dr. Akazie? Über ihn stand nichts im Dossier. Und wieso rückte er die Fundstücke nicht heraus? Was war das nur für ein Saumensch? Bahlow wollte nachfragen, doch da stieg Hennig jubelnd in eine Grube hinab. Die Hitze, der Schweiß, alles kam Bahlow seltsam vertraut vor, so, als nähme im Kissen, wenn man sich abends ins erschöpfte Bett wirft, der Traum der vorherigen Nacht Gestalt an, flirrende Erinnerungen, daunenweich, er sah jemanden über einen Ast stolpern, der aus dem Boden ragte, wohl einen Betrunkenen, denn den Mann umgab eine grünliche, nach Anis riechende Wolke. Wahrscheinlich eine Szene aus einem Buch, das ich vor Jahren gelesen habe, irgendein belangloses Abenteuergarn, an das ich mich nur dunkel erinnere, unerheblich, das Bild, das vor seinem inneren Auge erschienen war, verschwand in grellem Licht, kitzelnd, störend, ein Schweißtropfen nahm Anlauf und sprang von Bahlows Nasenspitze hinab zu den Arbeitern in die Grube, es sei normal, dass die Verwirrung in Wellen komme, hatte Hennig versichert. Das spreche für leichte Malariaanfälle, die den Kranken, wie er aus eigener Erfahrung wisse, meist in Schüben zermürbten. Und was solle er tun? Sich auf die Chinin-Prophylaxe verlassen und abwarten, auch sein Gesicht würde schon wieder werden. Ich muss übel aussehen. Aus den Gräben und Gruben heraus mustern mich besorgte Augen. Erklimmt da nicht ein alter Bekannter den Pfad? «Wir beschäftigen zurzeit», hub Hennig sogleich zu sprechen an, «vierhundert Arbeiter und schätzen, dass im Jahre 1911 das Gebiet der Grabungen in seiner Nord-Süd-Erstreckung einen vollen Breitengrad umfassen wird. Uns bietet sich die einmalige Gelegenheit, das wundersam vielgestaltige Leben in aller Gründlichkeit zu erforschen, das sich hier am Rande des Kreidemeeres abgespielt haben muss. Da trotteten stumpfsinnig jene Ungeheuer mit einem mehr als zwölf Meter langen und bis zwei Meter dicken Hals, mit Beingestellen, die alles gewohnte Maß übersteigen, da tummelte sich die große und kleine Drachenbrut bis hinab zum winzigsten Eidechslein, da zogen Herden gepanzerter Schreckgestalten daher, mit mächtigen Stacheln auf Rücken und Schwanz, da eilten auch kleine, flinke Saurier menschengleich auf den Hinterbeinen erhoben, da flogen andere durch die Luft, da gab es gefürchtete fleischfressende Räuber und Giganten, die ihnen lebend allein ihrer Größe wegen entgehen mochten und die ihren Riesenleib von Pflanzen und kleineren Seetieren ernährten. Kaum darf das herrlich reiche Tierleben des heutigen Afrika sich an Mannigfaltigkeit mit dem messen, das hier vor uns aufsteigt. Wollen Sie?» Dankend lehnte Bahlow ab. Nach dem Frühstück hatte sich Hennig die Taschen mit Kandiszucker gefüllt und kaute und knirschte seitdem unablässig darauf herum. «Für Sie als Entomologen wäre die Urzeit ein schönes Jagdrevier!» Mit diesem Ausruf schwang sich die Vision, die Hennig auf mächtigen, geschuppten Flügeln davontrug, erneut hinauf in die luftarmen Gefilde, wo er die Nachbarschaft der großen Poeten genießen konnte. «Stellen Sie sich nur einmal die fünfzehn Zentimeter langen Schaben der Farnwälder des Karbons vor! Oder Libellen mit sechsundsechzig Zentimetern Flügelspannweite!» Bahlow verspürte das drängende Verlangen, Hennig zu erschlagen. «Das ist ja ungeheuerlich», bemerkte er gepresst. Hennig füllte den Mund mit Kandis und knirschte und redete und redete und knirschte, während die Karawane dem Tendaguru immer näher kam. Wieso gibt mir Kuider einen Stadtplan von Paris mit? Vor der Abfahrt hatte Bahlow den Plan in der verriegelten Schiffskabine überprüft, aber ihm war darauf nichts Ungewöhnliches aufgefallen; er fand die Place de la République … sein Zeigefinger glitt die Rue du Temple hinab … sein Daumen verharrte auf der Île de la Cité, umspült von den Wellen der Seine …
Damals war ihm zum ersten Mal der Verdacht gekommen, alles könnte ein Scherz sein oder ein fürchterlicher, mit großem Aufwand inszenierter Racheplan, wie er nicht grässlicher in einer von Nägeles kleinen Geschichten zu finden wäre. Bahlow träumte nur noch selten von Nägele; und tat er es, traf ihn beim Erwachen mit voller Wucht die Erkenntnis, dass sein Freund das Zeitliche gesegnet hatte. Natürlich war es schmerzhaft, von einem verstorbenen Freund (oder seinem Vater selig) zu träumen, aber noch schmerzhafter empfand Bahlow das Wissen, dass das eigene, träumende Gehirn der einzige Ort der Welt war, der diesen ehemals lieben Menschen noch Zuflucht bot. Nur in diesen peinigenden Träumen, deren Wiederkehr dunklen Gezeiten folgte, hörte er Nägeles Stimme, nur hier roch er den Qualm des Zigarillos und sah, wie sein Freund beim Reden unentwegt die spitze lange Nase befingerte. Der Traum-Nägele trug ungepflegte Kleidung mit herzförmigen Flickstücken auf den Ellenbogen, verdiente keine müde Mark mit seinen verdrehten Erzählungen, hockte Tag für Tag in seiner Dachstube als General einer Armee leerer Weinflaschen und verblüffte Bahlow mit Erkenntnissen wie: «Der Normalzustand des Menschen ist das In-der-Ecke-Kauern!» Lebte Nägele noch, hätte Bahlow ihm von seinen Ängsten erzählt. «Nägele», hätte er gesagt und mit dem Weinglas einen vagen Bogen beschrieben, «mein einziges Ziel ist es, dem Buch zu entkommen.» Im Geiste rannte er bereits über das staubige Bücherbord, war er doch im benachbarten Band ein gerngesehener Gast der von Herders. Nach dem Tee schlenderte er rauchend über die Wiese, erblickte ihr weißes Kleid zwischen den Bäumen, ein schaukelndes Metronom, höher, Onkel Carl stößt sie an, und höher, Onkel Carl, und höher. «Wie bitte?», fragte Hennig.
«Ich habe nur laut gedacht», sagte Bahlow und konzentrierte sich wieder auf Hennigs Monolog, am Tendaguru, am Tendaguru, Leben und Wirken einer deutschen Forschungs-Expedition zur Ausgrabung vorweltlicher Riesensaurier in Deutsch-Ostafrika, am Tendaguru, Bahlow erwartete die Ankunft im Lager mit zunehmendem Grausen, am Tendaguru, er würde zu erschöpft sein, um sich höflich betragen zu können, höher, Onkel Carl, höher, der grauenhafte Zustand meines Gesichtes, außerdem bin ich unrasiert, nicht mehr höflich, nicht heute, schlafen, nur noch schlafen. Wahrscheinlich träume ich dann wieder von dem verfluchten Nägele, von Paris, von einer aufgegrabenen Welt, in der aufrecht gehende Maulwürfe hausen, und sie auf der Schaukel, und ich, und ich, ich fang dich auf, spring, ich hab solche Angst, Onkel Carl, spring, mein Engel, spring, und weiter, weiter. Fuß vor Fuß. Wassertrinken. Uff! Wir haben es bald geschafft! Bald, bald, und weiter, weiter, doch als sie am späten Nachmittag ihr Ziel erreichten, stellte Bahlow mit bitterer Resignation fest, dass ihr Ziel noch nicht ihr Ziel war: Zwar hatten sie den Tendaguru erreicht, aber der wollte nun bestiegen werden.
Qual: Ein schmaler Fußweg wand sich die Ostflanke des absurd niedrigen, bewaldeten Hügels hinauf zu einem Dörfchen, das die Arbeiter mit ihren Familien bewohnten. Hühner flohen mit bösem Gackern, setzen Sie sich, eine angeleinte Meerkatze zupfte an Bahlows Jackenzipfel, nackte Kinder torkelten um die Kiste, auf der ein poghuli saß und das geschwollene Gesicht in den Händen vergrub. Blinzelte Bahlow zwischen den Fingern hindurch, sah er, wie Hennig sich mit einem hochgewachsenen Neger unterhielt, der europäische Kleidung trug. «Kommen Sie, es sind nur noch wenige Meter!» Hennig zog den Entomologen weiter, der sich wiederholt nach seinem Gepäck erkundigte und den Versicherungen, es sei bei Oberaufseher Boheti bestens aufgehoben, keinen Glauben schenkte. «Ich stelle Sie erst im Pavillon vor, dann zeige ich Ihnen Ihre Hütte», sagte Hennig zum dritten Mal. «Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass diese ehemals dem armen Valdsky gehört hat.»
Bahlow seufzte, das mache ihm nicht das Geringste aus. Wieso auch? Da Valdsky ihn mit seinem Sherry getauft hatte, war es nur folgerichtig, dass er, der Getaufte, die Hütte des Täufers bewohnte. Ob es wohl eine Schaukel hinter der Hütte gab? Und einen Garten? Nach dem Tee, als er rauchend über die Wiese, höher, Onkel Carl, höher, ich fange dich auf. Auf einem Vorsprung unter der vollen Höhe des Tendagurus blieb Bahlow ergriffen stehen. In erfrischender Asymmetrie hatten sich hier eine Handvoll grasgedeckter Bambushütten und ein gutes Dutzend Materialzelte am Hang versammelt und spielten Europäerlager; der Gipfel des Hügels trug einen Fez. «Sehr nett!», schnaufte Bahlow und erinnerte sich, dass die Schönheit der Aussicht schon in Kuiders Dossier lobend erwähnt worden war. Soweit das Auge reicht, hatte Hennig im ersten Jahr der Expedition seiner Braut geschrieben, schließt sich Baumkrone an Baumkrone, ein lückenloses Kleid. Was dort an Eingeborenen-Feldern und -Dörfern, an reichem afrikanischem Tierleben verborgen sein mag, das ahnt das Auge trotz aller Fülle nicht (…). Ein einziger grüner Teppich ist über Berg und Tal, Plateau und Tiefebene gebreitet … «Stimmt genau!», flüsterte Bahlow ehrfürchtig. «Ein einziger grüner Teppich ist über Berg und Tal, Plateau und Tiefebene gebreitet!»
Hennig sah den Entomologen an und pflichtete ihm nach einer Weile mit einem verdächtig heftigen Kopfnicken bei.
«Und nach der Vorstellung zeigen Sie mir die Hütte?»
«Natürlich.»
«Ich muss mich einen Augenblick hinlegen.»
«Aber Sie können doch nicht … Stehen Sie auf, Doktor Bahlow!»
Der verschränkte trotzig die Arme vor der Brust.
«Mit Verlaub: Sie können nicht auf dem Boden liegen bleiben!»
Und ob er das konnte! Aber weil Hennig keine Ruhe gab, erhob sich Bahlow murrend, und Hand in Hand nahmen sie die letzten sanft ansteigenden Meter in Angriff, die das Europäerlager vom Gipfel des Tendaguru trennten. «Willkommen in unserem Wohn- und Speisezimmer!», sagte Hennig. Im Pavillon saß ein dicker Mensch, unschwer als Doktor Janensch zu identifizieren, Kustos am Berliner Geologisch-Paläontologischen Universitäts-Institut und Museum. Janensch schaute hinter einer Zeitung hervor, begrüßte Hennig mit einigen saloppen Bemerkungen und musterte sodann den Entomologen durch eine kleine, randlose Brille. «Guter Gott!» Janenschs Augen weiteten sich in froschähnlichem Erstaunen. «Was haben Sie denn mit Ihrem werten Gesicht angestellt?» Bahlow winkte unwillig ab; der Dicke brach in Gelächter aus, wabbelnde Kinne, wogender Trommelbauch. Auf seiner aufgedunsenen Nase und den Hängebacken entspann sich ein Netzwerk bläulicher Adern und deutete im Zusammenspiel mit den schlaffen, teigigen Gesichtszügen auf einen bekennenden Hedonisten hin, der sein Glas gerne bis zur Neige austrank. Über einem verschwitzten Hemd trug der Expeditionsleiter eine fleckige Jacke mit weitoffenen, gähnenden Brusttaschen; vor ihm auf der umgedrehten Kiste, die den Tisch in dieser afrikanischen Posse spielte, lag ein Schlapphut. Natürlich tragen sie alle Hüte! Bahlow nahm den Tropenhelm ab und hielt sich mit beiden Händen daran fest. Einige Tage vor der Abreise aus Kiel hatte er mit stiller Freude den Chauffeur eines Adler Phaeton beobachtet, der in ohnmächtiger Verzweiflung das Lenkrad seines qualmenden, querstehenden Automobils umklammert hielt, das den Kutschverkehr in einem Gässlein völlig zum Erliegen gebracht hatte. «Na, also!» Janensch obsiegte im Ringkampf mit der Zeitung, faltete sie zusammen (Bahlow glaubte kyrillische Schriftzeichen zu erkennen) und legte sie neben dem Hocker auf den Holzboden. Dann streifte er die Glacéhandschuhe ab und verkündete selbstgefällig, er pflege beim Zeitunglesen stets Handschuhe zu tragen (Hennig kratzte sich unbehaglich im Nacken), da ihm die Berührung des rauen Zeitungspapiers das geistige Pendant einer Gänsehaut beschere. Janensch freute sich über Bahlows Gesichtsausdruck, dann ebbte das glucksende Gelächter ab, ebenso Bahlows Verwirrung. Er lenkte mit dem Tropenhelm wieder geradeaus, und Janensch eröffnete eine halbwegs zivilisierte Konversation mit: «Sie sind also der Entomologe?»
Wer sonst? Bahlow nickte unwirsch.
«Sind Sie schon lange Außenagent der Firma?»
Bahlow schüttelte den Kopf, gab sich Mühe, höflicher zu sein, und fügte in schläfrig gedehnter Sprechweise hinzu: «Mein erster Auftrag.»
«Wer hat Sie eingearbeitet, wenn die Frage erlaubt ist?»
«Niemand. Ich bekam den Auftrag und reiste ab.»
«Über Marseille?»
«Ja.»
«Haben Sie den Aufenthalt in Marseille genossen?»
«Ja.»
«Dort jemanden von der Firma getroffen?»
«Nein. Ich habe dort nur meine Ausrüstung erhalten.»
«Aha», sagte Janensch und wurde ohne Vorbereitung albern. Er riss flaue Witze über die «Chitin-Prophylaxe», die der Entomologe keinesfalls vergessen dürfe, machte wiederholt kryptische Anspielungen auf Federvieh, nötigte Hennig und Bahlow ein Gläschen selbstgebrannten Zuckerrohrschnapses auf, der nach Erbrochenem schmeckte, lachte erneut über die «Chitin-Prophylaxe», amüsierte sich über Hennigs Probleme mit dem Datum und noch mehr über die halbgeflüsterte Enthüllung, sie hätten seit mehreren Wochen an den Sonntagen gearbeitet. «Wenn heute morgen ist und», angestrengtes Nachdenken, «gestern übermorgen», Schenkelklopfen, «deshalb fühle ich mich heute wohl so alt! Übrigens: Schönen Helm haben Sie da.» Der Expeditionsleiter war Bahlow in höchstem Maße unsympathisch. Janensch mit dem dicken Hintern gehörte zur Familie der Ptinidae, er war ein Niptus hololeucus, ein unangenehmer Diebskäfer, dem die goldgelbe Behaarung aus dem kragenlosen Hemd quoll. Bahlow ließ sich einen zweiten Schnaps einschenken. Er verachtete diese Frohnaturen, die jedes Gespräch mit dem Schmetterlingskescher durchstreiften, allzeit auf der Suche nach Witzworten und Doppeldeutigkeiten. Bahlow trat an das Geländer des Pavillons. Wie immer, wenn die Konturen gegen Abend undeutlich und doch scharf zugleich werden, schien die Welt bis zum Bersten mit Bedeutung aufgeladen. Plateaus mit roten Abstürzen überlagerten sich in kraftvoll geschwungenen Halbbögen am Horizont. Bahlow sah über das grüne, westliche Tiefland hin, wo die Sonne bald die fernen Berge mit purpurner Glut überziehen würde, der Auftakt der prächtigen Farbsymphonie eines afrikanischen Sonnenunterganges. Was geschähe wohl, wenn er Janensch so fest in den speckigen, braungebrannten Unterarm bisse, dass ihm dessen dummes Blut heiß in die Augen spritzte? Nein, Nägele war tot, solche Dinge geschahen nur in seinen Geschichten. Tot! Nägele ist tot! Tot, tot, tot! Glücklicherweise waren Salinski, der Lepidopterologe, und Oberstleutnant von Geinitz, der Sicherheitsbeauftragte, nicht anwesend. Ich gebe wohl kaum ein vorteilhaftes Bild ab!
Er lehnte sich an die hüfthohe Bambusverkleidung. Nach einer Weile hatte es sogar Janensch begriffen, ließ Bahlow von nun an in Frieden und begann mit dem bestürzend servilen Hennig ein Streitgespräch über Photoapparate, dessen Ursprung offensichtlich in den kreidezeitlichen Anfängen der Expedition zu suchen war. Bahlow schenkte sich noch einen Schnaps ein. Aus dem Dossier wusste er, dass Janensch mit Apparaten photographierte, die der Expedition von der Firma Voigtländer frei zur Verfügung gestellt worden waren; Hennig dagegen schoss seine Bilder mit einer Anschütz-Kamera («Und zwar mit Film!»). Bahlow ließ die Repetieruhr anschlagen, sechs Uhr, Blutfluss, der Himmel begann sich zu verfärben.
«Ich sammele auch Insekten», wiederholte Janensch.
«Ach», sagte Bahlow, suchte nach Worten, fand keine. «Sie müssen mich entschuldigen. Haben Sie bitte Nachsicht mit mir! Ich bin sehr müde.»
«Verzeihen Sie unsere Unhöflichkeit. Ich zeige Ihnen Ihre Hütte.» Hennig hielt ihm den Arm hin, damit er sich darauf stützen konnte, doch Bahlow wollte alleine gehen.
«Morgen bekommen Sie einen eigenen Boy.»
«Einen Boy?» Bahlow sah Janensch verständnislos an.
«Jeder hat hier einen Boy. Wir sind die bwana mkubas.»
Bahlow quittierte die Behauptung mit einem zögerlichen Nicken. Wie gerne hätte er sich in einem weichen Bett ausgestreckt, einen munter tickenden Wecker auf dem Nachttisch, die Pantoffeln auf dem flauschigen Vorleger, die Stiefel vor der Zimmertür, damit sie ein geisterhaftes Hotelpersonal nachts blitzblank wienerte – halt! Eine Angelegenheit musste noch geklärt werden, ehe er sich in Valdskys Bett legte. «Wie verhält es sich hier mit der Post?»
«So!» Hennig zog ein Bündel Briefe aus der Jackentasche. «Die Post kommt mit dem Küstendampfer nach Dar es Salaam. Üblicherweise holt sie ein Bote ab, aber da ich in Lindi war, um Sie abzuholen …»
«Wie lange braucht ein Brief von, sagen wir, Kiel nach Lindi?» Nicht ohne Stolz vermerkte Bahlow, dass er trotz Müdigkeit noch zu detektivischem Vorgehen in der Lage war. Nick Carter wäre stolz auf ihn! Sie saßen sich an einem kleinen runden Tisch gegenüber. Aber weshalb sah Nick Carter auf einmal aus wie ein alter Mann? Bahlow gab dem Kellner ein diskretes Zeichen. Ein bis zwei Monate. Hennig, der seit der Ankunft im Lager kein einziges Mal James Cook erwähnt hatte, reichte Janensch einige der Briefe, die dieser, ohne sie zu betrachten, in der Innentasche der Jacke versenkte, eine Geste, die Bahlow von seinem Vater kannte. Nach dem Frühstück hatte dieser an einer Hälfte eines aufgeschnittenen Brötchens das Messer gesäubert, damit die Post geöffnet und sie sich in die Jacke gesteckt, ohne zuvor in die Umschläge hineingesehen zu haben. Dann hatte er eine Tasse Kaffee im Stehen geleert (wobei er bei jedem Schluck den Kopf in den Nacken legte wie ein trinkendes Huhn) und mit fliegenden Rockschößen das Speisezimmer verlassen. Vater war auf der Straße gestorben. Als man ihn zu Hause entkleidete, sahen selbst die Dienstboten, dass im Augenblick des Todes eine umfängliche Darmentleerung stattgefunden hatte, ein Umstand, der schlagartig die wenigen schönen Kindheitserinnerungen einschwärzte, die Bahlow verblieben waren. Jahre später beging er den Fehler, Nägele von dieser Angelegenheit zu erzählen (in einem Anfall weinseligen Selbstmitleids auf dem Dachboden des Schlaftraktes), und bald danach wusste es das ganze Internat.
«Bin mit meiner Anschütz-Kamera vollauf zufrieden!», sagte Hennig. «Erst glaubte … «
Bahlow unterbrach ihn ungeduldig: «Wie lange braucht nun der Brief?»
Hennig wirkte verlegen. «Ein bis zwei Monate.»
Oh, gut. Da bleibt noch Zeit. Vielleicht hat man sie noch nicht gefunden. Oder gehört das zum Plan? Von Herder verfügt durchaus über die Mittel, dafür Sorge zu tragen, dass Afrika mein Gefängnis wird – und hier stehe ich nun und plaudere mit meinen Wärtern. Janensch zog die Handschuhe aus und kratzte sich zwischen den Fingern, wo die Haut ekelhaft gerötet war. «Sie erwarten Post?», fragte er mit zweideutigem Grinsen. Bahlow senkte den Blick. «Na, da ist doch ganz bestimmt eine Dame im Spiel!» Als Bahlow sich wieder konzentrieren konnte, beklagte Janensch mit pathetischen Gebärden das Fehlen holder Weiblichkeit, wobei sein Gesicht bei «Weiblichkeit» einen faunischen Ausdruck annahm. «Es ist unverantwortlich, Weiber», heftiges Lippenlecken, «nach Afrika mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob Sie vom traurigen Schicksal gehört, äh, ich meine, gelesen haben, das Krapfs Gattin ereilt hat. Er nahm sie mit, als er von Massaua einen Vorstoß in die Shoho-Wildnis machte, und die Strapazen waren so groß, dass sie eine Frühgeburt bekam. Das Kind starb binnen einer Stunde, und nach drei Tagen befahl Krapf den Weitermarsch. Ein Jahr später, ich denke, das war 1844 in Mombasa, raffte die Ärmste ein Fieber dahin. Natürlich war sie damals wieder schwanger. Sie sehen, wie unverantwortlich es ist, eine Frau mitzunehmen. Oder ein», Janensch kniff die Augen zusammen und sah Bahlow streng an, «Mädchen. Nehmen Sie regelmäßig Ihre Tabletten? Raus mit der Sprache, Käferologe! Sie erwarten Post von einer Dame?»
«Ja», schrie Bahlow. «Meine Braut will mir schreiben.»
Janensch brach in schallendes Gelächter aus.
«Um noch einmal auf die Post zurückzukommen», begann Bahlow zornig und verlor den Faden. Er glaubte sich daran zu erinnern, vor nicht allzu langer Zeit selbst einen Briefumschlag in die Innentasche der Jacke gesteckt zu haben. Aber weshalb sollte er das getan haben? Bahlows Hand tastete durch die Schwärze, fand den Faden und packte ihn. «Ich kann also davon ausgehen», heftige Lenkbewegungen vollführend wandte er sich an Hennig, «dass ein Brief, der, nehmen wir einmal an, heute in Kiel abgeschickt wird, etwa in ein oder zwei Monaten hier am Tendaguru ankommt?»
«In der Regel verhält es sich ganz so, wie Sie meinen», sagte Hennig, «aber zur Zeit des Süd-Monsuns kann es zu schweren Verspätungen kommen.»
Ihr Verbündeter ist der Süd-Monsun. Bahlow baute sich schwankend vor Janenschs Kiste auf. «Und wann weht dieser Süd-Monsun?» Kuiders Bemerkung gewann überraschend Sinn.
«Man höre und staune!», rief Janensch. «Auf einmal wird er wieder munter, unser müder Krieger! Vive la femme!»
Ohne den Scherzreden Beachtung zu schenken, antwortete Hennig errötend: «Von Juli bis Oktober.» Rascher Überschlag, Juli, August, September, Oktober, sehr gut, mit etwas Glück bleiben mir vier Monate, starker Seegang, der Boden des Pavillons neigte sich, glitt in die Schräge wie ein Schiffsdeck, versetzte Bahlow einen heftigen Schwinger. Blutet er? Ich glaube nicht. Kommen Sie! Hennig half dem Entomologen auf. Janensch zog die Glacéhandschuhe an und fragte in berechnender Beiläufigkeit: «Wen, sagten Sie, haben Sie in Marseille getroffen?»
Eiskalt: «Ich habe niemanden getroffen.»
«Ach so, ich dachte, Sie hätten vorhin einen Namen genannt.»
«Nein, habe ich nicht. Um Himmels Willen! Hören Sie endlich auf, mich zu quälen!» Blinzelnde Vogelpunkte über der rotglühenden Ebene, Gesang umwehte den Pavillon: Im Dorf der Arbeiter wurde gefeiert. Hennig zupfte an Bahlows Ärmel wie eine lästige Meerkatze, Janensch nahm die Brille ab, und sein Gesicht zog sich in die Länge, als er mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand die Tränensäcke massierte. «Sie müssen mich entschuldigen», stammelte Bahlow. «Ich kann kaum mehr klar denken.» Und endlich führte man ihn zu seiner Unterkunft, einer Bambushütte mit lehmverstärkten Wänden und strohgedecktem Dach. Nachdem er eine gute Stunde geruht hatte, machte er sich mit kühlem Kopf daran, das Gepäck zu verstauen. An der Wand hing ein geschmackloses Bild, ein vorwurfsvolles Echo Valdskys: Der Heiland lässt schmale, weibische Hände segnend über den Köpfen von glücklichen Schafen schweben. Ansonsten deutete bis auf eine Sicherheitsnadel, die Bahlow unter dem Feldbett fand, nichts darauf hin, dass die fensterlose Hütte jemals bewohnt gewesen war. Er steckte die Sicherheitsnadel in die Hosentasche. Feldbett, Tisch, dreibeiniger Hocker, aber es gab wenigstens Regale. Diese füllten sich rasch mit entomologischen Gerätschaften, die Kleider blieben in Seesack und Reisetasche, die Bücher wanderten unsortiert in ein Regal über dem Kopfende des Feldbettes. Einige Bände von Charles Oberthürs Etudes d’Entomologie waren darunter, die bahnbrechenden Arbeiten von John Head, Jakow Andrejitsch und Hans Pähp, Der Große Bobert natürlich und die üblichen Bestimmungsbücher, dicke Folianten mit Seidenpapier zwischen den Farbseiten. Bahlow, der es schon als Heranwachsender vorgezogen hatte, sich auf dem Dachboden des Internats zu verbergen, anstatt mit den Mitschülern im Aufenthaltsraum zu sitzen, genoss es, zum ersten Mal seit Tagen mit seinen Gedanken alleine sein zu dürfen.
Aber als er im Liegestuhl vor der Hütte im siebten Band von Jean-Henri Fabres Souvenirs entomologiques blätterte, um das letzte Licht des Tages auszunutzen, gesellte sich Salinski zu ihm, ein korpulenter Herr mit gerötetem, feuchtem Gesicht, platter Nase und dichtem, rotem Vollbart. Er war arglos und freundlich wie ein Marienkäfer. Sie plauderten über Fabre und das kleine Tischlein in Sérignan, an dem dieser seine Werke verfasst hatte, Salinski malte mit dem Spazierstock gedankenverlorene Krakel in den Sand. Der Dschungel, in dessen schwarz-grünem Meer der Tendaguru trieb, zirpte und klopfte und bereitete sich auf eine wilde Nacht vor. Plötzlich lachte der Pavillon auf dem Gipfel mit Janenschs Stimme und prustete etwas, das entfernt nach «baba kufa, mama kufa» klang, nein, das kann nicht sein, Bahlow nickte aufmunternd: «Fahren Sie bitte fort!»
August Salinski arbeitete, wie er aus dem Dossier wusste, für Adalbert Seitz, einen Mediziner und Lepidopterologen, der von 1893 bis 1908 Direktor des Frankfurter Zoos gewesen war und seit 1909 als Privatgelehrter in Darmstadt lebte, um sich der Herausgabe des mehrbändigen Die Groß-Schmetterlinge der Erde zu widmen. Salinski kannte bestimmt diese wunderbaren Spiele der Jugend. Ein Nachtfalter mit einer Nähnadel durch den Leib, der durch die Kammer flog. Oder man betäubte eine Fliege mit einem sanften Schlag der Klatsche, umwickelte ihren leblosen Körper mit einem Bindfaden und ließ sie steigen, wenn sie aus ihrer Ohnmacht erwacht war, einen kleinen, pelzigen Drachen. «Und Sie arbeiten für Staudinger & Bang-Haas?», fragte der Marienkäfer. «Sie sind Außenagent der Firma?»
«Außenagent», bestätigte Bahlow. Alle sprachen dieses Wort aus, als hätte es etwas anderes zu bedeuten, als beinhaltete es wie eine verschlossene Schatulle etwas Seltsames, etwas Geheimnisvolles. Nun, er würde mitspielen! «Ich arbeite auch auf eigene Faust. So suche ich Käfer, um sie nach mir zu benennen», improvisierte er ins Blaue hinein. «Stellen Sie sich das vor! Ein afrikanischer Käfer, der meinen Namen trägt!» Bahlow sah seinen Namen durch das hohe Gras huschen und mit mächtigen Mandibeln eine fette Made packen. Der gefährliche Bahlow! Achtet auf den gefährlichen Bahlow, Mädchen, wenn ihr im Dschungel spazieren geht! Seine Zähne sind spitz, seine Zunge ist schnell!
«Welcher Käfer dürfte Ihren Namen tragen?», fragte Salinski.
«Nun … vielleicht am ehesten ein Käferpendant zum Attacus atlas Linné …»
«Zum was?»
«Zum Atlasspinner», erklärte Bahlow, ohne Verdacht zu schöpfen.
Im Lager der Arbeiter brüllte jemand wie ein Berserker.
«Von Geinitz ist zurück», sagte Salinski.
Das Geschrei hielt eine Weile an, Kisuaheli, Bahlow bewegte sich unbehaglich auf dem Liegestuhl, hörte wieder den abknickenden Aufschrei des Heizers, den satten Aufschlag des Körpers im glitzernden Wasser des Suezkanals, das der Dampfer durchschnitt wie das heimkehrende Volk der Israeliten. «Schlafen Sie wohl!» Nachdem sich der Lepidopterologe derart verabschiedet hatte, erhob Bahlow sich und sah, was jener neben seinem Liegestuhl in den Sand gemalt hatte: einen Kreis, den ein X in gleiche Viertel schnitt; ein dummer Zufall. In der Welt gibt es Zufälle, überlegte Bahlow, denn es gibt keinen Gott. Aber in einem Buch ist der Zufall ausgeschlossen: Hier hat alles Bedeutung. Er weigerte sich, weitere Schlussfolgerungen aus dieser Überlegung zu ziehen und betrat sein neues Zuhause. Die Repetieruhr gab acht Schläge von sich, metallisch hallend, als befände sich eine winzige Stadt in dem flachen Gehäuse, ein kleines mittelalterliches Städtchen, auf dessen bevölkerten Marktplatz sich das Miniaturläuten der Turmuhr senkte.
Bahlow entzündete die Petroleumlampe, verriegelte die Tür, lud sicherheitshalber die Luger, umwickelte sie mit dem öligen Zeitungspapier und schob das Bündel unter die Bettdecke. Den idiotischen Brief, den ihm der Pockennarbige in Lindi gegeben hatte, würde er erst morgen von Geinitz aushändigen. Sie müssen ein offenes Pentagramm gehen. Sie beginnen am linken Fuß des Pentagramms und marschieren Richtung Kopf. Wenn Sie vom linken Arm zum rechten emporstoßen, sind Sie da. Ich gebe Ihnen diese Information nur, weil ich erwarte, dass Sie sich in gleichem Maße erkenntlich zeigen werden. Sehen Sie sich satt, und reisen Sie unverzüglich ab! Oder schlagen Sie sich auf unsere Seite! Der Brief war mit einem schlichten B. unterzeichnet. Unverständlich. Völlig unverständlich. Vielleicht ein Ulk? Ja, das war gut möglich. Bahlow würde sich auch einen Ulk erlauben, würde diesem von Geinitz einfach sagen, er habe den Brief bereits geöffnet erhalten. So einfach war das!
Er löschte die Lampe, kroch unter das Moskitonetz, spürte den Lauf der Luger unter dem linken Schulterblatt, und wie so oft in den letzten Nächten erwartete sie ihn hinter den geschlossenen Lidern. Bilderbecks Tochter trug ein gewagtes Reformkleid, er legte ihre Schultern frei, küsste feuchte Pentagramme den Rücken hinab, glitt davon. Danach lief Bahlow ziellos durch die kleine Stadt in seiner Uhr. Vor einer Konditorei blieb er stehen, die Luft roch nach Vanille, auf einmal strömte Hitze durch alle Gassen und aus dem zersplitternden Schaufenster stieg der fürchterliche Konditor, in den sich sein Lateinlehrer verwandelt hatte, und flüsterte mit glasierter Stimme: «Ich bin der Dschungel, und ich gebe dir deinen wahren Namen.»
Wimmernd wälzte sich Bahlow auf die rechte Seite.
ENDE DES ERSTEN BaNDES