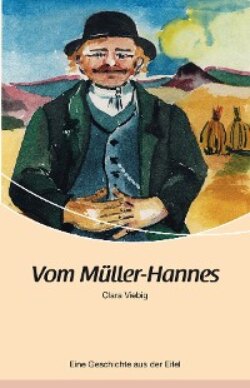Читать книгу Vom Müller-Hannes - Clara Viebig - Страница 4
2.
ОглавлениеDas war eine wundervolle Maiennacht! Eine Nacht, in der alle Winde schlafen, in der der Mond Silber streut; eine Nacht, in der das Springen der Knospen zu hören ist. Der Wildbach fließt ruhig, und wo er bergab ins Gefälle kommt, scheint er die Steine zu küssen, über die er sich schmeichelt. Es duftet – nicht nur der Waldmeister, der im Buchenbüsch unter den braunen Blättern vergangener Herbste sprießt, nicht die Anemonen, nicht die Veilchen und Himmelschlüssel allein, die am grünen Wegrain blühen – alles duftet, die Luft, das Wasser, die Erde. Es duftet voll herber und doch süßer Frische, es duftet nach Jugend.
Die großen Kehren, in denen sich die Straße von Manderscheid abwärts zum Tal der Kleinen-Kyll schlängelt, fuhr ein Wagen hinunter. Ein Paar saß darin.
»Hott – hahr!« rief der Mann dem Pferdchen zwar zu, aber acht hatte er nicht. Gut, daß das Roß die Straße kannte! Vorsichtig bog es an den gewohnten Stellen um; sacht rollen die Räder zu Tal.
Und immer höher hob sich der Mosenkopf, der Herrscher, aus dem Gewirr all der niedrigeren Höhen. Der Mann im Wagen stand plötzlich auf, riß den Hut ab und grüßte den heimatlichen Berg mit langhallendem, jauchzendem Schrei. Ein trunkener Glanz lag dabei auf seinem Gesicht; die Zügel ließ er fahren und riß mit beiden Armen sein junges Weib zu sich in die Höhe.
»Kuckste, Tina, lao es hän, dän Mosenkop!« Er schwenkte noch einmal den Hut: »Boschur! Ech sein eweil widder hei! On kuk hei, dat Tina es mein’ Frau – ech haon se! Hallo – ho, ho!«
Das Echo war erwacht und antwortete aus allen Schlünden und Schründen. Die stille Nacht ward plötzlich laut, wie erschreckt von der starken Stimme. Im Gebüsch rauschten Vögel, ein aufgescheuchtes Reh setzte in Sprüngen über den Weg, und ein Fuchs stahl sich schlau beiseite. Zurück gen Manderscheid, und unten den Bach im Grund entlang, bis hinauf zum Mosenberggipfel und noch höher, bis an die Wolken, bis zum blanken, glänzenden Rund des Mondes gellte der Ruf:
»Dat Tina es mein’ Frau – ho, ho!«
Hannes schlang den linken Arm um den Nacken seiner Jung-Angetrauten, er mußte sich ein wenig stützen; aber es war nicht all der genossene Hochzeitswein, der ihn taumeln machte. Mit der Rechten wies er hinauf zum Berggipfel. Der Wind streichelte den Kopf des alten Riesen; jeder Grat, jedes Grätchen, jede Schrunde, jeder Riß war sichtbar im vollen Licht. Auch auf des Hannes Gesicht lag Mondglanz, aber da war noch keine Falte, kein Fältchen – alles glatt.
Ausgelassen rief er:
»Tina, kuckste hei dän Mosenkop? Dän es nach meinem Gu[2]! Lao stieht hän schon an de dausend Jaohr on kehrt sich’n Dreck, wat de Welt micht. Siehste, hei bauen ech noch ehs en schien Haus. Groß muß dat sien on kommod. Dann siehn ech de Mosel on dän Rhein, on ech spucken de Leut uf dän Kop!«
Hatte er zu viel getrunken? Die junge Frau hielt ihn fast ängstlich am Arm fest. Drei Tage hatten sie Hochzeit gefeiert, dann waren sie heut morgen von Hause fort – sollte der Abschiedstrunk, den die Verwandten und Gefreundten ihnen kredenzt, als sie schon auf dem Wagen saßen, noch so nachwirken?! Sie suchte seinen Blick, aber er erwiderte ihn nicht; er sah sie gar nicht. Glänzend waren seine Augen auf den Berg gerichtet. Und er reckte sich, atmete tief und brach dann in ein so anhaltendes Gelächter aus, daß das Pferd die Ohren spitzte, den verständigen Trott aufgab und in ganz unvernünftigen Sprüngen, den Wagen hinter sich dreinschlenkernd, bergab jagte. Das ging wie der Blitz. Die Kehren hinab – rechtsum – linksum – die Ebereschenbäumchen an der Ansturzseite flogen wie Schatten vorüber.
Tina schrie erschrocken auf und haschte nach den Zügeln. Aber ihr Mann stand ihr nicht bei, er hatte sich hintenüber auf den Sitz geworfen und klatschte sich die Lenden. Angst?! Warum denn? Ei, das war gerad’ schön! Er ergriff die Peitsche, berührte noch die Seiten des Pferdes und hieb dann, derb knallend, in die Luft. »Hä, hä, voran gemach, hä, hä!«
Immer rascher, rascher. Tina hätte weinen mögen vor Angst. Windschnell waren sie unten. Nun verfiel das Pferd von selber in ruhige Gangart, denn der Weg war steinig, stieg bald und fiel bald, immer auf und ab, jeder Windung der Kleinen-Kyll folgend. Auch Hannes wurde ruhiger im nächtigen Schatten des tiefen Tals, dessen Grund der Mond nicht erreichte.
Er zog Tina an sich und küßte sie zärtlich verliebt; wahrhaftig, es tat ihm jetzt bitter leid, daß er sie geängstigt hatte.
Sie vergaß ganz, daß sie ihm eigentlich böse war wegen der tollen Fahrt – so leichtsinnig, ohne Zügel und Bremse!
Und sie flüsterten miteinander. Müde wurden sie darüber, und eine Sehnsucht stieg in ihnen auf nach dem Ehebett, das in der Mühle jetzt ihrer harrte, festlich bereitet von neuem, weißem, glattem Linnen für ein neues Glück.
Die Alten hatten Wohnung im Dorfe genommen und die Mühle dem jungen Paar ganz allein überlassen. Beim Sohn auf dem Altenteil zu bleiben, das paßte dem Müller-Matthes nicht; von seinem Vater selig her wußte er’s noch, wie unzuträglich es ist, wenn einer da ist, der noch kommandieren möchte, wo doch jetzt ein anderer zu kommandieren hat. »Wann Heu und Stroh beisammen kommen, dann entsteht leicht ein Brand«, und »man soll sich nicht austun, bevor man schlafen geht«, das waren Sprichwörter, die Müller-Matthes bedachte. Dem Sohn hatte er wohl die Mühle übergeben, aber sein bares Geld aus dem Sacke zu tun, o nein, das fiel ihm gar nicht ein! Er wollte auch noch leben und nicht nur um Gottes willen.
Der Zufall wollte es, daß das Häuschen des Landscheid zu Maarfelden leer wurde. Der Alte hatte schon lange an der Gicht gelegen und verstarb, als die Märzstürme übers Maar sausten. Nun wollte die Seph das Erbe, das einzige, was sie hatte, gern zu Gelde machen, um mit den Geschwistern auswärts sich auseinanderzusetzen. So war sie eines Tages selber auf die Mühle gekommen und hatte gefragt: wenn es denn wahr sei, was sie reden gehört, daß der Sohn zum Mai heirate und der Müller eine andere »Gelegenheit« suche, ob er dann nicht ihr Anwesen kaufen wolle? Groß sei das freilich nicht, denn Reichtum sei nicht bei ihnen zu Hause gewesen.
Sie hatte das letztere mit einem bitteren Auflachen, recht unnötigerweise, zugesetzt – wie es bei Landscheids stand, wußte doch jeder im Dorf – und ihre schwarzen Augen waren dabei wild in der Stube umhergefahren mit einem suchenden Blick. Aber der Hannes ließ sich nicht finden. Und als sie nachher draußen vor der Tür stand und zögerte, ob sie ihn nicht vielleicht über den Hof schreiten oder beim Säckeladen hantieren sähe, war auch kein Hannes da. Mit gesenktem Kopf war sie von dannen gegangen, ihre hohe Gestalt schien um einen Fuß kleiner. Dort, wo der Mühlenweg zum Maar einwendet, beim Steinkreuz, war sie stehengeblieben und hatte starren Auges in die dunkle Flut gestiert.
Der scharfe Wind des kommenden Frühlings zerrte ihr am Haar, daß einzelne Strähnen sich lösten und ihr ums Gesicht schlugen.Und sie dachte daran, wie sie manche Nacht bei Sturm und Unwetter auf den Hannes gewartet und nicht gemerkt hatte, daß es kalt und rauh war. Und nun war alles zergangen zu gar nichts, wie der Schaum da, den der Wind auf dem Maar zusammmenpeitscht, und der dann am Ufer trüb und schmutzig in den toten Binsen zerfließt. Sie weinte nicht, aber ihre Fäuste ballten sich in den Falten des Rockes.
Daß der Müller-Hannes sie nicht heiraten würde, hatte Landscheids Seph immer gewußt – reiche Söhne heiraten keine armen Dirnen – nachgedacht hatte sie freilich weiter nicht darüber. Er war ihr gut und sie ihm, sonst was scherte sie nicht. Sie hatten miteinander geschäkert schon als Halbwüchsige; der herbe Eifelwind hatte sie beide groß und kräftig gemacht, war’s da nicht natürlich, daß sie sein Mädchen geworden war?! All die Jahre, die er beim Militär gewesen, hatte sie sich keinen anderen angeschafft, und als er dann endlich wiedergekommen war, hübscher denn je, männlich und dreist, da war sie ihm an die Brust gestürzt wie eine Bergquelle, die sich ergießen will. Nein, sie wäre ihm nicht böse gewesen, hätte er einmal eine Reiche geheiratet, die der Müller ihm ausgesucht! Aber daß er’s so getan hatte, so mir nichts dir nichts, ihr’s nicht einmal vorher angefragt, ihr einfach den Laufpaß gegeben, als er es an der Zeit fand, das verzieh sie ihm nicht.
»Dän Deiwel soll hän holen, dän schandlusen Kerl! Dau – dau – vermaledeit seiste!« Sie hob die Faust und drohte nach der Mühle zurück mit einer wütenden Gebärde. –
Jetzt suchte Landscheids Seph eine Unterkunft. Oben zu Manderscheid hätte sie wohl ankommen können, im Gasthof dort brauchten sie eine mit starken Armen und eine Hübsche, die den Gästen gefiel; aber das war ihr zu weit, sie wollte nicht weg aus ihrem Dorf, jetzt erst recht nicht, dem Hannes zum Possen. Die Burschen hatte ihr zwar in des Hannes Hochzeitsnacht einen Strohmann vor die Tür gesetzt und eine Katzenmusik gebracht, die ihr noch in den Ohren gellte; aber sie hatte ihnen aus der Dachluke schmutziges Wasser auf die Köpfe gegossen und war doch geblieben.
In dem kleinen erbärmlichen Dorfwirtshaus hatte sie einen dürftigen Dienst angenommen und schuftete vom frühen Morgen an hart, und lag spät nach Feierabend noch auf den Knien am Bach, der ohne Einfaß mitten durchs Dorf rinnt, und klopfte die vergraute Wäsche mit Steinen.
So sah sie den Hannes zum ersten Male wieder, ganz von der Nähe. Sonst hatte sie nur immer flüchtig aus der Ferne einen Blick auf seinen breiten Rücken erhascht: den drehte er ihr vielleicht nicht gerade mit Absicht zu, aber es hatte sich eben immer nicht anders gemacht.
Es war Holzversteigerung gewesen in dem großen Forst, der sich hinter Maarfelden über Höhen und Mulden, riesenhoch und riesenweit, bis hinab ins grüne Salmtal streckt.
Da hatte der junge Müller tüchtig gekauft, grün noch, auf dem Stamm. Seine Holzfäller sollten schlagen; einen ganzen Trupp hatte er gedungen, er betrieb gern alles im großen und hielt sich nicht lange kleinlich bei einer Sache auf. Seiner Tina hatte er heute zeigen wollen, wie man so ein Geschäft beschickt, zwei Pferde wurden angespannt – nur ein Gäulchen paßte dem Hannes schon lange nicht mehr – und so waren sie davongefahren im Chaischen, am hellichten Nachmittag, am ganz gewöhnlichen Werkeltag.
Jetzt kamen sie zurück; rasch rollten die Räder von der Höhe zum Dorf hinab, Staub wirbelte hinter dem Chaischen drein, und die struppigen Köter kläfften. Wer in der Hütte war, eilte neugierig vor die Tür, den reichen Müller zu grüßen.
Die Seph hatte den gebückten Rücken aufgerichtet. Ihre Blicke brannten. Ja, nun konnte er ihr nicht mehr den Buckel zudrehen, jetzt kanm er im Wägelchen direkt auf sie zugefahren, gerad’ auf sie los – Angesicht gegen Angesicht! Wild klopfte ihr das Herz.
Müller-Hannes knallte mit der Peitsche: »Hä, gäwt Obacht, Ihr elao!«
Aber sie rührte sich nicht. Sie blieb auf den Knien und richtete das erblaßte Gesicht steif gegen ihn. In der einen Hand hielt sie das verschmutzte zerissene Arbeitshemd, in der anderen den Stein, womit sie es geklopft hatte. Der dünne Rock klebte ihr am Körper, sie war durchnäßt bis auf die Haut und lag im Schmutz. Die Räder streiften sie und rissen ihr im Vorbeirollen einen Fetzen vom Rock ab, eine ganze Wolke von Staub fiel über sie her; aber sie sah Hannes starr an. »Kennste mich?« schien ihr Blick zu fragen.
»O je, ich kennen Dich,« schien sein Blick zu antworten. Müller-Hannes nickte, lässig zwar nur und leichthin, aber er grüßte doch: »Dag, Seph!«
Sie grüßte nicht wieder, sie war wie erstarrt. Mit offenem Munde sah sie ihm nach. Und sie hörte die junge Frau fragen:
»Wer is die?«
Und ihn antworten:
»Dat Landscheids Seph, hei aus’m Dorf! Dat es ehs mei Mädche gewest!«
Er sagte es recht laut; die Frau neben ihm zuckte, unangenehm berührt, heimlich zusammen. Und das Mädchen hinter ihm zuckte auch; Seph hätte aufschreien mögen vor Schmerz, Wut, Empörung und zugleich doch vor Freude, ja vor Freude: verleugnet hatte er sie wenigstens nicht, seiner Frau es ins Gesicht gesagt!«
»Dat Seph es ehs mei Mädche gewest« – das hörte sie die ganze Nacht. Das war doch wie eine Genugtuung. Aber dann durchfuhr es sie plötzlich schmerzhaft, gleich einem Stich: sie hatte es wohl gesehen, wie kurz auch die Begegnung gewesen war, sie hatte es gesehen, mit dem einen, alles unfassenden Blick – seine Frau war in Hoffnung!
Aber nicht nur Landscheids Seph warf sich diese Nacht hin und her auf ihrem harten Laubsack, auch die junge Müllerin fand keinen Schlaf in dem hochgetürmten Ehebett. Hannes schnarchte schon längst, da drehte und wendete sie sich noch in Herzensangst. Was war das für ein schwarzes Weibsbild gewesen mit bösen Augen?! Die war einmal ihres Mannes Schatz gewesen?!
»Och Jesus!« Sie stützte sich auf den Ellbogen und beugte sich so, halb aufgerichtet, fragenden Blickes über den Schlafenden. Der Mond warf ein falbes Licht in die Stube. Wenn sie doch jetzt in seinem Gesicht lesen könnte! Was war gewesen, was würde noch alles sein?! Sie seufzte. Ihn am Tage zu fragen, wagte sie nicht. Nicht, daß sie nicht zufrieden mit ihm gewesen wäre – o nein, es ging ihr ja sehr gut, das konnte sie ihrem Vater versichern in jedem Brief, das konnte sie sich selber versichern, und auch der lieben Mutter Gottes dort überm Weihwasserkesselchen – ihren Hannes wollte sie nicht verklagen, nein, der war nun mal so! Und doch machte ihr manches Sorge. Wenn der Hannes nur nicht so leicht mit dem Geld wäre! Neulich war er zur Dauner Kirmes gewesen, da hatte er Bekannte und Unbekannte traktiert: »trinken sollten sie, so viel sie wollten« – und das war viel – und hernach, als sie schrien: »Vivat dän Müller-Hannes! Hoch soll hän läwen hoch, hoch, hoch!« da hatte er noch ein paar Flaschen »Schambannijer« spendiert. So hatten sie es ihr erzählt; sie selbst fuhr jetzt nicht mehr mit auf die Kirmessen – ach je, ihr war es jetzt oft recht elendig! Die Brauttränen müssen geweint werden; die Braut, die sie nicht vor der Hochzeit weint, muß sie danach weinen – ach, sie hatte keine Brautträne geweint, keine einzige! Aber jetzt –?!
Seufzend zog sie die Stirn in Falten und drückte das Gesicht ins Kissen. Still nur, still! Sagen ließ er sich ja doch nichts. Und »das Weib hat’s Maul zu halten«, hatte ihr erst letzthin der Schwiegervater gesagt, als er kam und sie gerade saß und weinte.
Das junge Weib wühlte den Kopf immer tiefer ein; dann warf es sich rastlos.
Derweil träumte der Mann schön: ihm war der erste Sohn geboren, ein Knabe, groß und stark. Pfarrer Noldes von Maarfelden taufte ihn – »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes …« tauchte den Finger ins Taufbecken, bespritzte des Kindes Stirn – da schrie der Knabe so durchdringen auf und strampelte so mit den Beinen, daß der erschrockene Pfarrer zurückfuhr und alle Paten lachten. So ein Filou, wahrhaftig, der wußte schon, was ihm gebührte! Solch einen Jung’, einen Sohn vom Müller-Hannes, den tauft man nicht mit purem Wasser, aus dem dreckigen Bach, aus dem alle Leut’ schöpfen!
Als der Müller am anderen Morgen erwachte, stieß er sein Weib an, das erst bei Tagesgrauen Schlaf gefunden hatte, und erzählte lachend seinen Traum. Das war ein Jung’! Schon im voraus war der Vater ordentlich stolz auf ihn.
Da sagte Tina schüchtern:
»Wann’t äwer nur e Mädche is?!«
Er sah sie an, als verstände er sie gar nicht, und dann wurde er grob:
»Maach! Onnerstieh Dech! Ech will en Jong haon, ech muß en Jong haon! Hörste? Dän soll de Mühl’ ärwen!«
[2]. gout