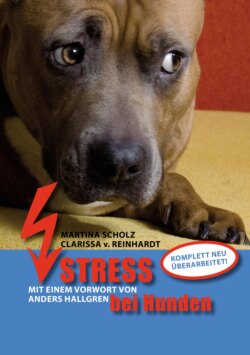Читать книгу Stress bei Hunden - Clarissa v. Reinhardt - Страница 8
ОглавлениеDEFINITION DES BEGRIFFS STRESS
Beschäftigt man sich mit dem Thema, so muss zunächst definiert werden, was Stress überhaupt ist. In dem medizinischen Fachlexikon Pschyrembel findet sich folgende Definition:
„Stress (engl. Druck, Belastung, Spannung) meint einen Zustand des Organismus, der durch ein spezifisches Syndrom (erhöhte Sympathikusaktivität, vermehrte Ausschüttung von Katecholaminen, Blutdrucksteigerung u.a.) gekennzeichnet ist, jedoch durch verschiedenartige unspezifische Reize (Infektionen, Verletzungen, Verbrennungen, Strahleneinwirkung, aber auch Ärger, Freude, Leistungsdruck und andere Stressfaktoren) ausgelöst werden kann. Unter Stress kann man auch die äußeren Einwirkungen selbst verstehen, an die der Körper nicht in genügender Weise adaptiert ist. Psychischer Stress entsteht in Folge einer Diskrepanz zwischen spezifischen Anforderungen und subjektivem Bewältigungsverhalten (coping). Andauernder Stress kann zu Allgemeinreaktionen im Sinne eines allgemeinen Anpassungssyndroms führen.“
WAS IST STRESS?
Die meisten Definitionen beschreiben Stress als einen Zustand, in dem ein Organismus auf eine innere oder äußere Bedrohung reagiert und seine Kräfte darauf konzentriert, die Gefahrensituation zu bewältigen.
Demnach ist Stress also ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelphänomene, für die ein Zustand erhöhter Aktivierung des Organismus kennzeichnend ist. Im neutralen Sinne bezeichnet Stress die unspezifische Anpassung des Organismus an jede Anforderung, das heißt eine Anpassungsleistung. Die meisten Definitionen beschreiben Stress als einen Zustand, in dem ein Organismus auf eine innere oder äußere Bedrohung reagiert und seine Kräfte darauf konzentriert, die Gefahrensituation zu bewältigen. Stress hat es schon immer gegeben, und er kann aus evolutionärer Sicht als überlebenswichtige Reaktion auf Reize angesehen werden, durch die auch eine Anpassung an veränderte Umweltbedingungen erreicht wurde.
Dabei bezeichnet Stress ein ambivalentes Phänomen, für das der Stressforscher H. Selye die Unterscheidung zwischen Eustress und Distress eingeführt hat. Eustress ist eine notwendige Aktivierung des Organismus, die das Tier (oder den Menschen) zur Nutzung seiner besten Energien führt und damit auch eine Fortentwicklung eigener Fähigkeiten ermöglicht. Distress meint dagegen ein schädigendes Übermaß an Anforderungen an den Organismus. In den letzten Jahrzehnten wird der Begriff Stress vor allem im Zusammenhang mit einer Verminderung des Wohlbefindens, der Leistungsfähigkeit und der Gesundheit genannt. Mit anderen Worten: Sprach man von Stress, war praktisch immer Distress gemeint.
Stress findet seinen Ausdruck auf allen Ebenen des Organismus:
physiologisch, zum Beispiel in Schweißausbrüchen, Herzklopfen usw.
im Verhalten, zum Beispiel durch Aggressionen, Erregung oder Unruhe
im Erleben, zum Beispiel in der Bewertung des eigenen Zustands
Er kann sich in allen Lebensbereichen und Situationen und auch in allen Altersstufen manifestieren. Das Erleben von Stress und auch die vom Organismus entwickelten Bewältigungsstrategien können bei Menschen wie bei Hunden individuell verschieden sein. Erleben zum Beispiel mehrere Hunde die gleiche Situation, so kann es sein, dass einige sie gar nicht als belastend empfinden, während andere deutlich gestresst reagieren. Von denen, die gestresst reagieren, können ganz unterschiedliche Symptome und Bewältigungsstrategien gezeigt werden. In den situationsspezifischen Konzepten der Stressforschung konzentriert man sich vor allem auf die auslösenden Reizsituationen, die so genannten Stressoren.
Man unterscheidet:
Äußere Stressoren wie Überflutung der Sinnesorgane mit Reizen oder den Entzug von Reizen (Deprivation), Schmerzreize und reale oder simulierte Gefahrensituationen.
Entzug von Nahrung, Wasser, Schlaf, Bewegung, so dass primäre Bedürfnisse nicht mehr befriedigt werden können.
Leistungsstressoren, zum Beispiel Überforderung, Unterforderung, Angst vor bevorstehenden Prüfungen, Angst vor möglichem Versagen, vor Zurechtweisung oder Strafe.
Soziale Stressoren wie zum Beispiel Isolation bei der dauerhaften Ausgrenzung des Hundes aus unserem Lebensumfeld. Auch das Zusammenleben von Hunden oder von Mensch und Hund mit mangelnder Passung stresst.
Vornehmlich psychische Stressoren wie Konflikte, Unkontrollierbarkeit, Angst, Trauer, Trennungsangst und Erwartungsunsicherheit.
Innere Stressoren wie Krankheiten, Behinderungen.
Größere Veränderungen der Lebensumstände wie der Tod einer Bezugsperson, Umzug etc. können ebenso als Stressoren erfahren werden wie kleine Widrigkeiten des Alltags, wenn diese sich summieren.
Die Reaktion auf Stress kann in drei aufeinander folgende Phasen unterteilt werden:
Die AlarmreaktionsphaseIn dieser Phase führt das Zusammenspiel von Nervenimpulsen und Hormonausschüttungen zur optimalen Reaktionsbereitschaft.
Die WiderstandsphaseIn dieser zweiten Phase ist der Widerstand gegenüber dem Auslöser erhöht und gegenüber anderen Reizen herabgesetzt. Dies bedeutet, dass der Bewältigungsversuch zu Lasten der Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Stressoren geht.
Die ErschöpfungsphaseHält der Stress zu lange an, kann der Organismus ihm trotz der ursprünglich erfolgten Anpassung nicht mehr standhalten. Die Symptome der Alarmreaktion aus Phase 1 stellen sich wieder ein, sind jetzt aber dauerhaft. Diese anhaltende Hochspannung kann im Zusammenwirken mit anderen Risikofaktoren zur Ausbildung organischer Krankheiten und im Extremfall sogar zum Tod führen.
Nehmen wir also an, am heutigen Tag wird ein Hund im Tierheim abgegeben, weil sein Besitzer ihn nicht mehr halten kann oder will. Der Hund verliert somit nicht nur seine Bezugsperson, sondern auch sein gesamtes soziales Umfeld, die gewohnte Umgebung, seine angestammten Spazierwege, vertraute Tagesabläufe. Gleichzeitig findet er sich in einer Umgebung – dem Tierheim – wieder, die ihm fremd ist, in der er sich vollständig neu orientieren und Sicherheit aufbauen muss. In den meisten Tierheimen ist es zusätzlich ziemlich laut, der Bewegungsspielraum in den Zwingern oder Boxen ist sehr eingeschränkt, es gibt kaum Rückzugsmöglichkeiten und häufig riecht es auch streng, schon für unsere Nase. Man kann sich also leicht vorstellen, dass der Stresslevel dieses Hundes enorm steigt, der gesamte Organismus ist in Alarmreaktionsbereitschaft.
Bleibt dieser Hund nun für einige Zeit im Tierheim, gewöhnt er sich scheinbar an die Situation. Das Bellen im Hundetrakt, der Geruch, die Enge scheinen ihm nicht mehr so viel auszumachen wie anfangs. Gleichzeitig kann man aber beobachten, dass er gegenüber Artgenossen nicht mehr so gelassen und souverän reagiert, wie man es von ihm gewohnt war, und bei den Gassi-Gängen pöbelt er plötzlich Jogger und Radfahrer an, was er früher nicht getan hat. Mit anderen Worten: Der Hund befindet sich in der Widerstandsphase. Seine Toleranz gegenüber den Reizen im Tierheim ist gestiegen, dafür hat er aber weit weniger Reserven, wenn es um die Begegnung mit weiteren Anforderungen geht.
Schließlich kann es passieren, dass der Hund in die Erschöpfungsphase gerät, wenn sich über einen längeren Zeitraum keine Verbesserung seiner Lebensumstände erreichen lässt. Man liest dann traurige Meldungen wie „Der Deutsche Schäferhund Jerry ist seit Jahren im Tierheim, nun hat er alle Hoffnung verloren und gibt sich auf. Wer kann ihm helfen?“ in den Tierschutzverteilern im Internet. Diese Hilferufe für Hunde, die sich – neudeutsch ausgedrückt – im Burnout befinden, lassen erahnen, welch unglaubliche Stressbelastung sich in ihnen aufgebaut hat.