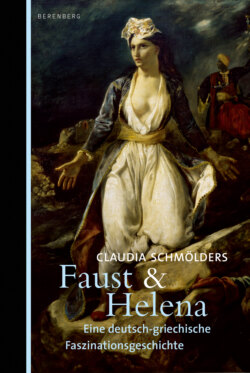Читать книгу Faust & Helena - Claudia Schmölders - Страница 11
DRITTES KAPITEL 1832 bis 1871 Nachrichten aus Weimar, Wien, Athen. Die neue Sprache Katharevousa. Jakob Philipp Fallmerayer als linguistischer Scharfrichter. Sprachenlernen als »furchtbare Passion«: Auftritt Heinrich Schliemann. Die unglaubliche Laufbahn eines ostdeutschen Pfarrerssohns. Heinrich und der »Schatz des Priamos«; Heinrich und Helena: das Traumpaar des deutschen Hellenismus.
ОглавлениеDie politische Realität hinter dem Harmoniebegehren von 1827, dem Jahr des griechischen Triumphs und der goetheschen »Helena«, sah aber natürlich ganz anders aus. Bei aller Liebe zu Musik und Dichtung und zum alten Griechenland schätzte Goethe die Lage eher realistisch ein. Am 2. April 1829 brach es im Gespräch mit Eckermann geradezu prophetisch aus ihm heraus: »›Ich will Ihnen ein politisches Geheimnis entdecken‹, sagte Goethe heute bei Tisch, ›das sich über kurz oder lang offenbaren wird. Kapodistrias kann sich an der Spitze der griechischen Angelegenheiten auf die Länge nicht halten, denn ihm fehlet eine Qualität, die zu einer solchen Stelle unentbehrlich ist: er ist kein Soldat. Wir haben aber kein Beispiel, daß ein Kabinettsmann einen revolutionären Staat hätte organisieren und Militär und Feldherrn sich unterwerfen können. Mit dem Säbel in der Faust, an der Spitze einer Armee, mag man befehlen und Gesetze geben, und man kann sicher sein, daß man gehorcht werde; aber ohne dieses ist es ein mißliches Ding. Napoleon, ohne Soldat zu sein, hätte nie zur höchsten Gewalt emporsteigen können, und so wird sich auch Kapodistrias als Erster auf Dauer nicht behaupten, vielmehr wird er sehr bald eine sekundäre Rolle spielen. Ich sage Ihnen dieses voraus; es liegt in der Natur der Dinge und ist nicht anders möglich.‹«
Dass der griechische Aufstand den ehemaligen russischen Gesandten Kapodistrias plötzlich in die Rolle eines Napoleon versetzen könnte, wie nun 1827 durch die revolutionären Zustände im Osmanischen Reich, muss Goethe tatsächlich erschreckt haben. Er hatte den Grafen zwei Jahre zuvor in Weimar kennengelernt; ein junger Schützling der »Philomusen« – dem Bildungsverein des Grafen – studierte damals in München und übersetzte hingebungsvoll Goethes »Iphigenie« ins Griechische. Genauer, er übersetzte das berühmteste Stück des deutschen Philhellenentums in die neugriechische Kunstsprache Katharevousa, die der Schriftsteller Adamantios Korais erfunden hatte und dem jungen Staat einprägen wollte. Es war eine idealistische und zugleich ganz realpolitische Initiative. Das Motiv der auch sprachlich gradlinigen Abstammung aus dem alten Hellas befeuerte natürlich nicht nur die gebildeten Ausländer, sondern vor allem die griechischen Intellektuellen selber; auf dem Weg zu einer nationalen Wiedergeburt wollte man die Dialekte hinter sich lassen, die im osmanischen Vielvölkerstaat zwangsläufig entstanden waren. Das Experiment gelang nur halb, denn anders als in Israel, wo das zurückeroberte Hebräisch tatsächlich eingebürgert werden konnte, blieb die Katharevousa als eher förmliche Schrift- und Amtssprache nur bis 1976 erhalten, nur wenig länger als die griechische Monarchie. Seither wird eine gehobene Alltagssprache namens Dimotiki benutzt, die aber durchaus antike Herkunft erkennen lässt.
Es war absehbar, dass es mit der Gründung eines griechischen Staates auch zu heißen Kämpfen um die zukünftige Sprache – vor allem die Amtssprache – kommen musste: schließlich gehörte das klassische Griechisch der gesamten antiken Literatur zur Ahnenreihe eines Weltreiches noch unter Alexander dem Großen und lange danach auch im Römischen Reich. Die alte Sprache trug das identitätsbildende Narrativ des Volkes und einst real existierenden Landes, nach dem sich auch eine neugriechisch sprechende Iphigenie sehnen mochte. Goethes Stück wurde also 1818 von einem jungen Studenten namens Papadopoulos übersetzt. Aber wer konnte dieses Griechisch im neuen Land schon sprechen, verstehen oder schreiben? Trotzdem war die Einsetzung der Katharevousa das Gebot der Stunde, denn tatsächlich brach der schärfste Kritiker der soeben mühsam errungenen Staatlichkeit genau in diese offene Flanke. Zielgenau im Jahr 1830 veröffentlichte ein Südtiroler Historiker eine Schmähschrift gegen das zeitgenössische Griechenland in Gestalt einer linguistischen Untersuchung. Jakob Philipp Fallmerayers »Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters: ein historischer Versuch« begann mit folgenden Sätzen: »Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa ausgerottet. Schönheit der Körper, Sonnenflug des Geistes, Ebenmaß und Einfalt der Sitte, Kunst, Einfalt, Stadt, Dorf, Säulenpracht und Tempel, ja sogar der Name ist von der Oberfläche des griechischen Kontinents verschwunden […] Denn auch nicht ein Tropfen ächten und ungemischten Hellenenblutes fließet in den Adern der christlichen Bevölkerung des heutigen Griechenlands. Ein Sturm, dergleichen unser Geschlecht nur wenige betroffen, hat über die ganze Erdfläche zwischen dem Ister und dem innersten Winkel des peloponnesischen Eilandes ein neues, mit dem großen Volksstamme der Slaven verbrüdertes Geschlecht von Bauern ausgegossen. Und eine zweite, vielleicht nicht weniger wichtige Revolution durch Einwanderung der Albanier in Griechenland hat die Szenen der Vernichtung vollendet.«
Wen also würde ein deutscher Faust im Athen des Jahres 1832 in den Armen halten, überhaupt welche Frau wäre wirklich Griechin mit hellenischem Stammbaum? Grausamer als mit Fallmerayers Worten konnte man die desaströse Vertreibung der Helena aus den Phantasien deutscher Philhellenen nicht beschreiben. Ob der alte Goethe jemals davon erfuhr? Es ist nicht bekannt.
Fallmerayer hatte in längeren Reisen durch das Land vor allem Namenkunde betrieben, geographisch wie sozial, und dabei eine völlige Dominanz der slawischen Sprachen festgestellt. Seine gehässige Formulierung galt der idealistischen Emphase nicht nur von Leuten wie Adamantios Korais, sondern eben auch der ganzen philhellenischen Begeisterung in Bayern, die Fallmerayer in München, wo man ihm eine Professur überlassen hatte, aus nächster Nähe kennengelernt hatte. Auch wenn die Forschung inzwischen fast alles widerlegt hat, was der Professor im Brustton der Überzeugung behauptet hatte, seine brutal rassistische Auslassung sollte nie wieder aus dem Magazin der Griechenkritiker wie auch der Eugeniker verschwinden. Im Gegenteil, sie gewann mit der Epoche Darwins immer mehr Fahrt, um spätestens 1941 in den Köpfen der deutschen Wehrmacht und schließlich auch sinngemäß bei Hitler zu landen.
Gespenstisch daran war nicht zuletzt, dass die Tirade einen gewissen Vorlauf mitten aus der innigsten literarischen Liebeserklärung der Deutschen besaß. Schon 1810 sprach der Geographielehrer von Schillers Söhnen, Friedrich August Ukert, in seinem landeskundlichen Werk über das Griechenland seiner Zeit von »den entarteten Nachkommen« der Hellenen, die er erforscht habe, »um zu sehen, ob das gesunkene Geschlecht, das mit so vielen fremden Völkern vermischt ward, so lange unter dem Druck roher und harter Beherrscher seufzte, noch den alten Griechen ähnlich zu nennen sei«. Freiheitliche Hoffnungen hatten Ukert zu seinem Werk getrieben, dessen liebevolle Detailfreude damals unübertroffen war; wer es las, konnte sich in Griechenland zuhause fühlen. Für ein idealistisches Publikum gespenstisch musste aber auch schon der Vorgänger dieser Meinungsschmiede sein. Es war ausgerechnet Hölderlin, der schon ein Dutzend Jahre vor Ukert seinen Hyperion sagen lässt: »Ich will, sagt ich, die Schaufel nehmen und den Kot in eine Grube werfen. Ein Volk, wo Geist und Größe keinen Geist und keine Größe mehr erzeugt, hat nichts mehr gemein, mit andern, die noch Menschen sind, hat keine Rechte mehr, und es ist ein leeres Possenspiel, ein Aberglauben, wenn man solche willenlose Leichname noch ehren will, als wär ein Römerherz in ihnen. Weg mit ihnen! Er darf nicht stehen, wo er steht, der dürre faule Baum, er stiehlt ja Licht dem jungen Leben, das für eine neue Welt heranreift. Alabanda flog auf mich zu, umschlang mich, und seine Küsse gingen mir in die Seele.«
Wenigstens gab es nicht nur den griechischen Aufrührer Alabanda in diesem Roman, sondern eben auch eine Diotima. Mit ihr erinnerte Hölderlin namentlich an die einzige und überragende weibliche Figur aus den Dialogen des Sokrates, wo sie die mystische Theorie der Liebe erläutert – und nun also auch Hyperion zur Nächstenliebe auffordert: »Ich bitte, dich, geh nach Athen hinein, noch einmal, und siehe die Menschen auch an, die dort herumgehn unter den Trümmern, die rohen Albaner und die andern guten kindischen Griechen, die mit einem lustigen Tanze und einem heiligen Märchen sich trösten über die schmähliche Gewalt, die über ihnen lastet – kannst du sagen, ich schäme mich dieses Stoffs? Ich meine, es wäre doch noch bildsam. Kannst du dein Herz abwenden von den Bedürftigen? Sie sind nicht schlimm, sie haben dir nichts zu leid getan. Was kann ich für sie tun, rief ich. Gib ihnen, was du in dir hast, erwiderte Diotima …«
»Hyperion«, dieser Briefroman über den allerersten griechischen Befreiungskampf, erschien in zwei Bänden zehn Jahre nach der Französischen Revolution. Napoleon war Erster Konsul geworden und unterwegs zum Kaisertum. Mit der historisch viel älteren Szene des Romans erinnerte Hölderlin an die Seeschlacht von Tschesme im Auftrag Katharinas, unter Leitung des Grafen Orlow 1770. Zwar besiegten damals die Russen die Türken, aber der Aufstand im Land der Griechen misslang – und dieses Misslingen hielt der Roman nun auch seiner eigenen Gegenwart vor. Napoleons Aufstieg bedeutete das Ende der Freiheit in Frankreich wie auch in Deutschland, dem der wohl schneidendste Satz des Romans galt: »Es ist ein hartes Wort und dennoch sag’ ichs, weil es Wahrheit ist: ich kann kein Volk mir denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen – ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergossne Lebensblut im Sande verrinnt?«
Hölderlins Roman wurde trotz aller Liebe zum Traumvolk nicht in die neugriechische Katharevousa übersetzt. Der einzige Grieche, der dazu fähig gewesen wäre, Rigas Velestinlis, wurde 1798 hingerichtet; und als es 1832 endlich einen Staat mit kulturellen Ambitionen gab, hatte anderes Vorrang.
Fallmerayers Tirade empörte jedenfalls das gesamte philhellenische Feld. Im Nu machten die Sätze die Runde, bis hin zu Ludwig I., der dem Autor die Professur entzog. Auch die Griechen selber protestierten und bestärkten ihre Forschungen zur byzantinischen Kontinuität des Hellenentums. Eine der herausragenden und beispielhaften Figuren in dieser Gesellschaft war der Theologe Theoklitos Farmakides. Nach einem Studium in Istanbul, Jassy und Bukarest wurde er 1811 geweiht und dann nach Wien geschickt, wo er bis 1818 als Priester wirkte. Hier lernte er Latein, Französisch und Deutsch, wurde Mitglied der Filiki Eteria und Mitherausgeber der Zeitschrift »Hermes Ho Logios«, einem Sprachrohr von Adamantios Korais. Damit war Farmakides ein entschiedener Verteidiger der Katharevousa. Am griechischen Aufstand nahm er ab 1821 teil; als Mitglied der ersten Nationalversammlung wurde er ab 1825 Herausgeber der »Allgemeinen Zeitung von Griechenland«, dem späteren Amtsblatt der Regierung und unter Otto I. treibende Kraft bei der Synode von 1833. 1837 erhielt er den Lehrstuhl für Theologie an der neuen Universität Athen. Zweifellos kannte er das Pamphlet des Griechenfeindes Fallmerayer, und womöglich war es auch Thema des Unterrichts.
Unter seinen Studenten muss damals jedenfalls ein gewisser Theodorus Vimbos aus Athen gewesen sein, später Bischof dortselbst und Erzbischof von Mantineia. Im Jahr 1856 verdiente sich Vimbos noch Geld als Sprachlehrer vorübergehend in Petersburg. Unter seinen Schülern war ein prominenter deutscher Geschäftsmann, der seit Ende des Krimkrieges als reichster Mann der Petersburger Börse galt. Er hieß Heinrich Schliemann – und der Moment, in dem er den jungen Vimbos traf, war schicksalsträchtig. Ihn, den eingefleischten Geschäftsmann, hatte nämlich nach eigener Auskunft eine unerhörte Sprachpassion erfasst. Fast verzweifelt schrieb er im Dezember 1856 seiner Tante Magdalena nach Kalkhorst: »Wissenschaften und besonders Sprachstudium sind bei mir zur wilden Leidenschaft geworden, und jeden freien Augenblick darauf verwendend ist es mir gelungen, in den zwei letzten Jahren noch die polnische, slavonische, schwedische, dänische sowie im Anfang d. J. die neugriechische Sprache fertig zu erlernen, so daß ich jetzt 15 Sprachen geläufig spreche u. schreibe. Die furchtbare Passion für Sprachen, die mich Tag und Nacht quält und mir fortwährend predigt, mein Vermögen den Wechselfällen des Handels zu entziehen u. mich entweder ins ländliche Leben oder in eine Universitätsstadt wie z. B. Bonn zurückzuziehen, mich dort mit Gelehrten zu umgeben u. mich ganz und gar den Wissenschaften zu widmen, ist jetzt schon seit Jahren in blutigem Kampf mit meinen zwei anderen Leidenschaften, dem Geiz und der Habsucht …«
Zwei Jahre später hatte er genügend Neu- wie auch Altgriechisch gelernt, um eine erste große Reise nach Athen anzutreten; aber die Geschäfte, vielleicht auch die Reichtumsgier eines Schatzgräbers und überhaupt Geltungssucht fesselten ihn und seine Ursehnsucht noch zwölf Jahre, bevor er in der Türkei nach Homer zu suchen und zu graben begann.
Heinrich Schliemann, geboren 1822 in Neubukow, Mecklenburg, aufgewachsen in Ankershagen, jammervoll gestorben auf einer Straße in Neapel, war ein kultureller Oligarch, wie ihn die Welt oder mindestens die deutsche bis dahin noch nicht gesehen hatte. In einen ärmlichen Pfarrhaushalt verschlagen, mit einem offenbar brutalen, aber kenntnisreichen Vater gestraft, verlor er früh die Mutter und musste schon mit vierzehn als Handlungsgehilfe arbeiten. Aber er war der Arbeit physisch nicht gewachsen. Nach Missgeschicken auf See kam er mit zwanzig in Amsterdam in einem Handelskontor unter; hier lernte er zwar Handel treiben, fühlte sich aber unterfordert und lernte Sprachen gleich schockweise: erst Englisch, Französisch, Holländisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch, später Russisch. Offenbar war niemand in seiner Umgebung darüber erstaunt. 1846 ging er nach Petersburg und baute ein Imperium auf; schon 1854 galt er dort als Börsenmagnat, und das erst recht, als ihm der Krimkrieg 1854–1856 das Vermögen noch einmal verdoppelte; er hatte rechtzeitig Waren für das Militär eingekauft. Aber nun machten Geschäfte ihm keine Freude mehr; er fürchtete beständig Verluste und träumte nur noch von Bildungsreichtum. Inzwischen hatte er Reisen quer durch Europa und bis nach Amerika absolviert, Schwedisch und Polnisch gelernt, bis er in Petersburg auf Theodorus Vimbos traf, den Mann seiner Träume. Mit ihm entwickelte er eine eigene Methode, lernte erst Neu-, dann Altgriechisch und verständigte sich wenn nötig mit einer Mischung aus beidem. Es vergingen aber noch weitere zehn Jahre mit Geldverdienen, Reisen und Sprachenlernen in Asien und im Orient, ehe er sich 1866 in Paris niederließ, um ein Studium aufzunehmen. Alle möglichen Fächer wurden erwogen, aber die Antike reizte ihn dann offenbar doch am meisten. 1868 kam er zum ersten Mal über Italien zur Peloponnes und in die Türkei nach Hissarlik, wo nach Meinung einiger Fachleute und gebildeter Dilettanten Troja, die berühmteste Stadt aus Homers »Ilias« liegen musste. Mit dem Bericht über diese Reise promovierte Schliemann 1869 an der Universität Rostock; im selben Jahr heiratete er die blutjunge Griechin Sophia Engastromenou, eine Nichte seines Griechischlehrers. Zwei Jahre später hatte er sich endlich mit den türkischen Behörden geeinigt und stürzte sich auf die Ausgrabung Trojas im damals türkischen Gebiet. Er glaubte an die Wörtlichkeit der homerischen Epen wie ein Pietist an das Evangelium; Odyssee und Ilias waren für ihn nicht Gedichte, sondern Landeskunden, wenn auch rühmend und spannend vorgetragen. Seine amtlichen Grabungen begann Schliemann im Oktober 1871, neun Monate nach dem Sieg von Versailles und der Krönung von Wilhelm I. zum deutschen Kaiser, wofür er sich offenbar nicht interessierte. Im Lauf der kommenden zehn Jahre machte er weltweit beachtete, aufsehenerregende Funde, wenn auch die Fachwelt, besonders die deutsche, ihm immer wieder misstraute, nicht selten zu Recht. Aber er fand tatsächlich Stadtreste, die er Troja nannte, und er fand einen spektakulären Goldschatz, den er dem mythischen Trojanerkönig Priamos zuschrieb. Auch seine späteren Grabungen im griechischen Mykene machten Schliemann reich, als ob er das noch nötig gehabt hätte; in fünf sogenannten »Schachtgräbern« fand er wiederum lauter Schätze, am berühmtesten darunter eine goldene Gesichtsmaske: für Schliemann war es frei nach Homer die Maske von Agamemnon, dem Herrscher von Mykene und Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg – also eben im Krieg um die legendäre Helena, Königin von Sparta und Frau des Menelaos, dessen Bruder Agamemnon war. Helena war mithin seine Schwägerin.
Mit den Funden Schliemanns kam die ganze verwickelte griechische Mythologie ins Bewusstsein der europäischen, vor allem aber der deutschen Gesellschaft wieder zurück. Helena also: Atemberaubend schön, war sie nach der bekanntesten griechischen Sage das Opfer eines himmlischen Wettstreits, bei dem Göttinnen unrühmlich mitspielten, aber die Menschen nicht minder. Ein Königssohn namens Paris entführte die Frau des Menelaos angeblich nach Ilios oder Troja, in die heutige Türkei, vielleicht verschwand sie aber auch nach Ägypten, unter dem Schutz des Zeus, und ein Trugbild kam nach Troja, jedenfalls rüstete der Schwager Agamemnon die griechische Flotte zur Rückholung der Beute. Es wurde ein zehnjähriger Krieg mit grausamen Opfern; das Meiste darüber ist aus der Ilias des Homer bekannt.
Nun aber, im Jahr der realgeschichtlichen Ausgrabung von Troja, gerät Helena gleichsam leibhaft unter die Augen von Heinrich Schliemann. Aus tiefsten mythischen Nebeln taucht sie hier endlich auf, dieses ganz konkrete Objekt der Begierde eines wahrhaft faustischen deutschen Mannes, der auch noch wirklich Heinrich hieß. Schliemanns rastlose Karriere brachte die antike Traumfrau zum Greifen nahe, wie er glaubte, und zwar im Schatten ihrer Schmuckstücke. Die großen Funde von Troja und Mykene gehörten zwar nicht einer gemeinsamen Kulturepoche zu; denn Schliemann hatte ja eine rund zweitausend Jahre ältere Schicht, eine vormykenische Stadt Troja ergraben. Aber das stellte sich erst bei seinem Nachfolger Dörpfeld heraus. Erst einmal konnte der Ausgräber seinen Fund inszenieren. Der trojanische Schatz umfasste Tausende von Einzelteilen, darunter feinsten Schmuck, wie ihn Helena, falls es sie jemals gab, womöglich getragen hatte. Musste sich Schliemann nicht fühlen wie Goethes Faust auf dem Rücken des Chiron? Im eiligen Gespräch der beiden im zweiten Teil der Tragödie berichtet der heilkundige Kentaur ja, dass er Helena höchstpersönlich auf dem Rücken getragen und sie in seine Mähne gegriffen habe. Faust ist hingerissen, denn diese Mähne berührt ja nun auch er. Die Mähne als Fetisch: die Mähne als Analogie für den Schmuck. Ließ Helena sich mit einer Zeitmaschine von ferne berühren? Schliemann greift in die Verse Homers, der doch Helena wahrhaft näher stand als Goethe, und seine Mähne ist dieser Schatz. Später im Grabungsbericht wird alles sorgsam dokumentiert, wenn auch mit einigen Ungenauigkeiten, die von der Fachwelt alsbald registriert wurden. Natürlich inszenierte Schliemann alsbald eine Fotositzung, für den seine Frau Sophia das sogenannte »große Gehänge« einer Helena am trojanischen Hof anlegt, als »echte Griechin« und Nachkommin des homerischen Geschlechts – das alles mit geschickter Propaganda und weltweiter Wirkung aus einem erst vierzigjährigen jungen Griechenstaat heraus. Diese Helena/Sophia ist zwar nicht Frau eines südlichen Königs, wohl aber Gattin eines ostdeutschen Oligarchen, seinerseits geboren und aufgewachsen unweit von Stralsund, wo der Urvater der deutschen Hellasliebe, Johann Joachim Winckelmann, fast zwanzig Jahre gelebt hatte. Doch anders als der rastlose Schliemann hatte Winckelmann nie nach einer Helena gesucht, sondern war bis auf seltene Reisen in Italien sesshaft geblieben, meist in Rom, introvertiert und in mythisch schönen Männerkörpern befangen.
Bei aller deutschen Graekomanie – mit seinen pompös vermarkteten Grabungen ging Schliemann für die deutsche Fachwelt zunächst einmal wohl zu weit. Man tadelte und verlachte ihn und misstraute ihm. Der Berliner Papst der klassischen Philologen, Wilamowitz, soll in einer Satire Frau Schliemann gespielt haben, wie sie den Schatz in ein Tuch gewickelt von der Grabungsstätte getragen habe. Das Misstrauen der Philologen saß tief. Seit Gründung der Berliner Humboldt-Universität hatte man ja von oberster Stelle aus das Hellenentum in Gestalt der Gräzistik akademisch eingehegt und in diversen Instituten, wie etwa dem Deutschen Archäologischen Institut Athen, dann aber auch im humanistischen Gymnasium, glorifiziert und versäult. Hier kritisierte man an Schliemann noch lange den haut goût des Hochstaplers, des wütend ehrgeizigen Dilettanten und Aufsteigers. Der alte Schmidt in Fontanes »Frau Jenny Treibel« musste jedenfalls noch verteidigen, »dass jemand, der Tüten geklebt und Rosinen verkauft hat, den alten Priamus ausbuddelt«. Und wirklich: Fast rückhaltlose Bewunderung erhielt Schliemann zunächst einmal nur aus England; hier, im Londoner South Kensington Museum, durfte er seinen Fund 1877 ausstellen, bevor seine Frau und der Freund Rudolf Virchow ihn dazu brachten, den ganzen Schatz von mehr als achttausend Teilen 1881 dem Deutschen Reich zu schenken, durchaus zur Freude des Kaisers, der ja selber als Hobby-Archäologe tätig war. Pünktlich zu diesem Anlass erschien nun auch der voluminöse Bericht über das ganze Unternehmen, mit detailgenauen Zeichnungen, zahlreichen Fotos und Beiträgen namhafter Kollegen als Buch unter dem schlichten Titel »Ilios«, mit dem Untertitel »Stadt und Land der Trojaner. Forschungen und Entdeckungen in der Troas und besonders auf der Baustelle von Troja«.
Abbildung 14 in diesem Band zeigte die »Allgemeine Übersicht des in 28 Fuss Tiefe gefundenen Schatzes«, der heute im Berliner Neuen Museum als Replik zu sehen ist: nämlich den Schlüssel der Schatzkiste, die goldenen Diademe, Stirnband, Ohrringe und kleine Juwelen; ferner silberne Talente und Gefäße von Gold und Silber; silberne Vasen und eine merkwürdige kupferne Platte; Waffen und Helmkronen von Kupfer oder Bronze; ein kupfernes Gefäß, kupferner Kessel mit zwei Henkeln, kupferner Schild. Unerhört penibel schildert und zeichnet Schliemann die eigentlichen Schmuckstücke, wie sie eine Trojanerin – Abbildung 688 – wohl getragen haben mag. Der Name Helena taucht im Text nicht auf, aber schließlich kam Helena ja auch aus Sparta und hätte in Troja also fremden Schmuck getragen, was bei einem zehnjährigen Exil in königlicher Umgebung wohl auch denkbar war. Schon Schliemann dachte bei seinen Beschreibungen damals aber auch an ägyptischen Einfluss; natürlich kannte auch er die antike Version der Helena-Sage, wonach ihr Entführer Paris nur ein trügerisches »eidolon« nach Troja gebracht habe, sie selbst aber sei vorsorglich von ihrem Vater Zeus nach Ägypten gerettet worden. Dem gleichsam doppelt fremden Schmuck später im Gräberfeld von Mykene widmete ein deutscher Archäologe namens Meurer 1912 eine sonderbar ausufernde schliemannkritische Studie. Er ließ an eine ägyptische Helena denken, wie sie in der Zeit zwischen den Weltkriegen zur Titelfigur einer Oper von Richard Strauss wurde, mit einem Libretto von Hugo von Hofmannsthal, uraufgeführt in Dresden 1928 und erneut bei den Salzburger Festspielen 1933. – Den echten »Schatz des Priamos« aus dem Hügel von Hissarlik, dann in Berlin, erbeuteten im Zweiten Weltkrieg sowjetische Soldaten; nach 1945 war er angeblich nicht wieder aufzufinden. Erst 1993, nach dem Zusammenbruch des Sowjetreiches, erfuhr die staunende Welt, dass er sich im Moskauer Puschkin-Museum befand, wo er seit 1996 auch wieder gezeigt wird. In Berlin sieht man bisher nur eine detailgetreue Kopie.
Was aber hatte Schliemann letztlich zu dieser archäologischen Raserei gebracht? War es wirklich, wie er in seinen autobiographischen Bemerkungen schrieb, eine allgemeine Begeisterung seiner kindlichen Umgebung für Homer, oder ganz besonders eine vom Vater geschenkte Weltgeschichte für Kinder? 1828 gab es zuhause den Band von Georg Ludwig Jerrer und der Vater hatte ihm daraus vorgelesen. Mit wem konnte man sich dabei identifizieren, mit Agamemnon oder Aeneas oder Herakles oder eben Odysseus? Als der junge Sigmund Freud das berühmte Buch »Ilios« über die Ausgrabungen lesen konnte, war er begeistert, nicht nur von den Griechen, sondern auch von Schliemann. Dieser Mensch hatte eine untechnische, geistige, nämlich sprachliche Entdeckung gemacht, er hatte eine vergangene Wirklichkeit hinter den Buchstaben entdeckt; er hatte in der Tiefe der Geschichte gegraben und sich nicht mit der Oberfläche einer Fiktion begnügt. Mehr als fünfzig Jahre später sollte Freud eine Reise nach Athen beschreiben, die er 1904 zusammen mit seinem Bruder unternommen hatte. Freud erinnerte sich in dem Text, den er »Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis« nannte, wie sonderbar er es nach der Ankunft auf der Burg plötzlich fand, dass nun alles greifbar und vorhanden war, was sie als Kinder bei Homer gelesen hatten und was erst recht Schliemann bekräftigt hatte. Auf den ersten Blick schien Freuds »Störung« also nur eine Abwehr Schliemanns, dessen Abenteuerlust ja gerade mit Finderglück belohnt worden war; aber der zweite Blick offenbarte dann doch tiefen Sinn für das archäologische Verfahren, wenn Freud später etwa die Stadt (Rom) zum Modell der menschlichen Psyche erhob, in der sich Analytiker grabend bewegten, jeder ein Schliemann, und oft auch mit strahlenden Funden belohnt.
Warum aber dieser Schliemann, der doch eigentlich Geschäfte mit Farben und Stoffen und Kriegsmaterial machte, der an der Börse unaufhörlich rechtzeitig kaufte und verkaufte, dessen Briefe von finanztechnischen Details wimmeln, von Verlustängsten gepeinigt, warum also dieser Mann sich in die griechische Antike nicht nur zurücksehnte, sondern regelrecht eingraben wollte wie in ein Pharaonengrab, ist oft erörtert worden. Fontane hat es leise parodiert. Nicht nur seine Frau »Jenny Treibel« will ja möglichst nur Handfestes, selbst der alte Schmidt des Romans meint beim Anblick der ›Agamemnon‹-Maske: »wenn ich mir vorstelle, dass diese Goldmasken genau nach dem Gesicht geformt wurden, gerade so wie wir jetzt eine Gesichts- oder Wachsmaske formen, so hüpft mir das Herz bei der doch mindestens zulässigen Idee, daß dies hier – und er wies auf eine aufgeschlagene Bildseite – daß dies hier das Gesicht des Atreus ist oder seines Vaters oder seines Onkels …« Wieder drängt sich der Fetischcharakter der Funde ins Bild, ihr Koeffizient an Wirklichkeit und Gegenwart, die weder Kunst noch Literatur bieten können. Aber womöglich die Sprache darunter?
Die Welt der alten Griechen aus dem Munde Homers zum Greifen nah: eine solche Intuition mochte Schliemann vielleicht wirklich als Junge aus Ankershagen gehabt haben; inzwischen kannte er aber doch auch die leidenschaftlichen Diskussionen, die Goethes Zeitgenosse Friedrich August Wolf im Jahr 1795 ausgelöst hatte. Wolf erörterte damals die These des italienischen Kulturphilosophen Vico, wonach es den einen und einzigen Homer vielleicht nie gegeben habe, wonach diese grandiosen Epen, Ilias und Odyssee, womöglich in mündlicher Tradition von vielen Sängern überliefert und bis zur schriftlichen Fixierung auch immer weiter verbessert worden seien. Einer wie Schliemann konnte aber beweisen, dass hinter dem Namen Homer ein Historiker stand, kein phantastischer oder gar phantasierender Sänger oder gar eine Gruppe von Sängern. Er konnte, vor allem aber wollte er es beweisen. Und denkbar ist, dass ausgerechnet seine Sprachwut ihn dabei leitete. Als er 1856 in Petersburg bei dem jungen Vimbos Griechisch lernte, war in dessen Kreisen das linguistische Todesurteil über die griechische Sprache sicher gespenstisch bekannt; eben Jakob Fallmerayers Verdikt von 1830. Inzwischen, mit Gründung des Staates und der unermüdlichen Patronage von Adamantios Korais, hatte man die Katharevousa ja eingeführt, ein modernisiertes Altgriechisch, eine Mischung, die natürlich auf Anhieb keineswegs überall gleichmäßig angewandt wurde. Wiederholt hat Schliemann in seinen Erinnerungen beschrieben, dass er genau solch ein Verfahren selber erprobt und sich angeeignet hatte. Nur ist bei ihm niemals die Rede von diesen innergriechischen Debatten und der Name »Katharevousa« fällt nicht. Ob ihn an Fallmerayers Text etwas ganz anderes gereizt hatte? Dort nämlich standen ja die wuchtigen Sätze, die Schliemanns kindliche Vorstellungen zermalmen wollten und zugleich zeigten, wie man sie in Erfüllung gehen lassen konnte, nämlich durch Grabung: »Eine zweifache Erdschichte, aus Trümmern und Moder zweier neuen und verschiedenen Menschenrassen aufgehäuft, decket die Gräber dieses alten Volkes. Die unsterblichen Werke seiner Geister, und einige Ruinen auf heimatlichem Boden sind heute noch die einzigen Zeugen, daß es einst ein Volk der Hellenen gegeben habe. Und wenn es nicht diese Ruinen, diese Leichenhügel und Mausoleen sind; wenn es nicht der Boden und das Jammergeschick seiner Bewohner ist, über welche die Europäer unserer Tage in menschlicher Rührung die Fülle ihrer Zärtlichkeit, ihrer Bewunderung, ihrer Tränen und ihrer Beredsamkeit ausgießen: so hat ein leeres Phantom, ein entseeltes Gebilde, ein nicht in der Natur der Dinge existierendes Wesen die Tiefen ihrer Seele aufgeregt.«