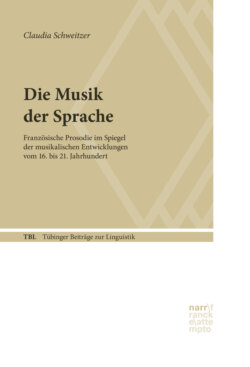Читать книгу Die Musik der Sprache - Claudia Schweitzer - Страница 21
Phonostylistik und Erforschung der Gesangsstimme
ОглавлениеIn den 1960ger Jahren sind die technischen Möglichkeiten so weit fortgeschritten, dass großangelegte instrumentale Studien zur Erforschung der Zusammenhänge von perzeptiven Eindrücken und messbaren akustischen Faktoren anvisiert werden können. Damit rückt das Studium der spontanen Sprachäußerung in realen Kommunikationssituationen immer weiter in das Zentrum des Forschungsinteresses. Die Verbindungen zwischen (Norm-) Syntax und Prosodie sind bei dieser Art von Untersuchung weitaus weniger deutlich und andere Funktionen der Prosodie, wie der Ausdruck von Emotionen, Selbstdarstellung und diskursbedingte Stimmmodulationen dominieren. Die Aufteilung des Akzents in de grammaire oder tonique und in d’oratoire oder d’émotion, die sich seit dem 17. Jahrhundert in den französischen Grammatiken gezeigt hatte, spiegelt sich in den Betrachtungen der verschiedenen Parameter wider, die a) zum Verständnis des Codes und der Funktion der Aussage nötig sind, und b) zusätzliche, zum Verständnis ebenfalls wichtige Informationen (wie Stimmfärbung, Intensitätsvariationen, Atmung, usw.) übermitteln.
Die letzteren werden im Rahmen der von Nicolas Troubetzky ins Leben gerufenen und in Frankreich vor allem von Ivan FónagyFónagy, Ivan und Pierre Léon entwickelten Phonostylistik wichtig, die in diesem Sinne das Erbe der Rhetoriker des 16. und 17. Jahrhunderts angetreten haben. Die lange Zeit im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehenden Intonationsmuster (zum Beispiel DelattreDelattre, Pierre, 1966) werden durch Studien zu den Verbindungen von Emotionen in Musik und in Sprache komplettiert (zum Beispiel FónagyFónagy, Ivan, 1983).
Bei den Phonetikern wird die Gesangsstimme Objekt eigener Forschungsarbeiten. Dank der genauen Messmöglichkeiten kann die zeitlich unterschiedliche Organisation der Silbe in Sprache und Gesang verglichen werden (Scotto di Carlo & Autesserre, 1992). Die Unterschiede sind auf die bedeutende Verlängerung der Vokale auf Kosten der Konsonantendeutlichkeit zurückzuführen, die bei den im lyrischen Gesang (Opernschule) ausgebildeten Sängern die Regel ist. Diese Veränderung der Silbenstruktur ist auch einer der Gründe, weshalb Opernsänger und Sängerinnen oft schwer – oder gar nicht – zu verstehen sind (Scotto di Carlo, 1978). Im Unterschied zu den barocken Sängern der Lullyschen Tragédie lyrique, von denen absolute Textverständlichkeit erwartet wurde, stellt die auf die romanische Tradition zurückgehende „klassische“ Gesangstechnik die Formung der Stimme in den Vordergrund. Diese muss in erster Linie in der Lage sein, über ein großes sinfonisches Orchester hin zu tragen. Dabei wird generell die italienische Sprache mit ihrer hohen Anzahl offener Vokale bevorzugt (vgl. Schafroth, 2020).