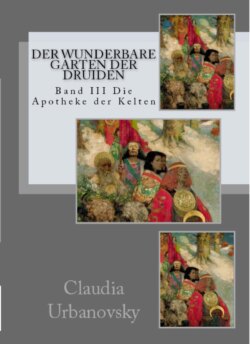Читать книгу Der wunderbare Garten der Druiden - Claudia Urbanovsky - Страница 4
Einführung - Eine wundersame Rezeptsammlung aus vormittelalterlicher Zeit
ОглавлениеNachdem Sie nun einen ausgedehnten Spaziergang durch den Kräuter- und Giftgarten der Druiden gemacht haben, ist es an der Zeit, einen Blick in die ärztliche Praxis der weißen Brüder zu werfen. Natürlich können wir uns wieder einmal nur Vermutungen und Annahmen hingeben. Aber das Alter des schon so häufig erwähnten Leydener Manuskripts lädt einfach zu dem Glauben ein, dass die Zeit, in der dieses Wissen mündlich von druidischem Lehrmeister an Druidenschüler weitergegeben wurde, nicht allzu weit zurücklag.
Das Manuskript, das wissenschaftlich auch unter der Bezeichnung »UB Vossianus Lat F96 I–III« geführt wird, löste vor ein paar Jahren unter den keltischen Philologen einen kleineren Gelehrtenkrieg aus. Professor D.N. Dumville vom Girton College in Cambridge zweifelte damals vehement dessen bretonischen Ursprung an und versuchte um jeden Preis nachzuweisen, dass es sich um einen altkornischen oder gar walisischen Text handelte, der etwa 100 Jahre jünger sein sollte, als seit Stockley gemeinhin angenommen wurde. Doch da es in diesem Buch um die Tradition der druidischen Heilkunst geht, möchten wir diese Auseinandersetzung, die immer noch im Gange ist, außer Acht lassen, den interessierten Leser an Alexander Falileyev, Morfydd Owen und Helen McKee verweisen und uns direkt der Materie zuwenden, die uns wirklich interessiert: den Rezepten!
Das Interessanteste an den Rezepten im Leydener Manuskript ist, dass die meisten von ihnen in ganz ähnlicher Weise schon bei Marcellus Burdigalensis (Empiricus) in seiner »De Medicamentis« auftauchen. »De Medicamentis« datiert, wie schon oft erwähnt, aus dem 4. Jahrhundert der Zeitrechnung und sein Autor rühmt sich der Bekanntschaft sowohl mit Patera als auch mit dessen Druiden-Vater und Druiden-Großvater, der noch Priester des Belenos im Sonnentempel von Burdigala gewesen war. Und »De Medicamentis« ist von der historischen Wissenschaft unbestritten bis zum heutigen Tage der ultimative Schlüsseltext, auf dem sämtliche anderen mittelalterlichen europäischen Rezeptsammlungen basieren.
Nach eigener Aussage des umtriebigen »magister officiorum« von Kaiser Honorius enthält sein Werk nicht nur all das, was er aus klassischen Quellen wie Plinius, Dioscorides oder Celsus zusammentrug, sondern auch gallische Rezepturen und keltische Zauberformeln. Diese »lokale« medizinische Weisheit erfuhr der Schriftsteller – wieder nach eigener Aussage – direkt von den örtlichen Praktikern der Heilkunde, mit denen er sich ausführlich unterhielt. Und unter örtlichen Praktikern verstand Marcellus nicht nur gelehrte Männer wie Patera, die unterrichteten und eigene Arztpraxen unterhielten, sondern auch die weisen (alten) Leute, die weit ab der Stadt auf dem Land oder in den Bergen lebten und dort eine auf Tradition beruhende Volksmedizin ausübten.
Doch zurück zum Leydener Manuskript und seiner Rezeptsammlung: Eine weitere Besonderheit des Textes, abgesehen von seinem ehrwürdigen Alter und seiner illustren Herkunft, ist die Tatsache, dass es sich hier nicht um einen Gelehrtentext handelt, sondern um ein Werk für Praktiker. Wenigstens einer der vier Co-Autoren war Herbalist und kein einfacher Kopist, der eine Kräuterliste abschrieb. Ein weiterer Co-Autor muss praktizierender Arzt gewesen sein, der sich offensichtlich auf ein Gebiet spezialisiert hatte, das man heute gemeinhin als »Ernährungsmedizin und Diätetik« bezeichnet. Bei keinem der vier Autoren lässt sich aufgrund seines schriftlichen Beitrags nachvollziehen, dass er einer christlichen Klostergemeinschaft angehört haben könnte. Insbesondere das vollständige Fehlen von christlichen Formulierungen oder Hinweisen auf christliche Verbote und Gebote macht den Text so einzigartig. Außerdem unterstreicht diese Identifikation der Autoren, dass die klassische Unterteilung der wissenschaftlichen Medizin in Pharmazeutik, Diätetik und Chirurgie mit ziemlicher Sicherheit auch für die Praxis der Druiden-Ärzte gegolten haben dürfte. Was sich allerdings, ganz im damaligen Zeitgeist, auf den vier Vellum-Bögen reichlich findet, sind magische Formeln. Leider sind sich die Gelehrten über die meisten von ihnen immer noch nicht ganz im Klaren. Aber sie sind eindeutig vorchristlicher Natur und Prägung! Darüber hinaus fällt auf, dass die Leydener Rezepte, die auf Lateinisch verfasst wurden, pflanzliche sowie animalische und mineralische Bestandteile haben, während die Rezepte, die den altbrythonischen Text ausmachen, außer Butter und zerstoßenem Widderhorn keine animalischen Zutaten enthalten und als einziger mineralischer Zusatz Silberschlacke auftaucht. Dieser Unterschied in den Rezepturen deutet stark darauf hin, dass sie aus sehr unterschiedlichen Quellen stammen. Die Tatsache, dass die meisten der altbrythonischen Rezepte sich in ähnlichen Zusammensetzungen auch in angelsächsischen Rezepten des sogenannten »Leechdoms« wiederfinden, unterstreicht in meinen Augen ihre lokale – keltisch-gallische – und somit druidische Herkunft noch zusätzlich. Nach heutigen Schätzungen war etwa ein Viertel der in dieser vorwissenschaftlichen Medizin angewendeten Drogen objektiv wirksam, wobei aber bei weitem nicht jedes Heilmittel seinen Ursprung in empirischer Anwendung hatte. Zu allen Zeiten wurden auch Heilmittel eingesetzt, deren Bezug zur Krankheit ein magischer war. Im Gegensatz zur empirisch gefundenen Arznei heutiger Tage ist der Bezug zwischen magischer Arznei und Patienten und Krankheit sehr stark von seinem Kulturkreis geprägt. Für Europa lassen sich hier vor allem zwei rote Fäden durchgehend verfolgen: die Ähnlichkeitslehre und die Drecksapotheke. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Schätzungen über die Wirksamkeit der Heilmittel recht weit unten angesetzt sind und man sich bei genauer Analyse und unbefangenem Hinsehen eher in einem Bereich über der 50-Prozent-Grenze bewegen dürfte. Denn oftmals werden die uralten Rezepturen durchaus »vernünftig und fassbar«, wenn man kurzerhand die »magische« Komponente wegstreicht – oder einfach mal das Exkrement weglässt und lediglich die Kräuter zusammenmischt.
Die Leydener Mischungen gegen Parasiten wie Läuse und Würmer sind zwar nicht ganz ungefährlich, aber durchaus wirkungsvoll. Man muss sich hier lediglich vor Augen halten, dass die Dosis das Gift macht und heutzutage wesentlich ungefährlichere Mittel existieren, um den Krabbeltieren auf den Leib zu rücken. Auch sind viele der Rezeptvorschläge von Marcellus Empiricus überzeugend: Fenchel und Honig sind bei Husten wirklich keine schlechte Lösung. Allerdings funktioniert die Mischung eben auch ganz gut, wenn man eine Tasse davon im Wohnzimmer trinkt und nicht auf der Türschwelle mit dem Blick gen Osten gewandt. Ich habe häufig aufs Geratewohl »De Medicamentis empiricis libri« aufgeschlagen und irgendwo meinen Finger auf die Seite platziert. Meist stand dort auch etwas, das Sinn machte und wirklich half: Nehmen Sie als Beispiel einfach seine Empfehlungen für einen Patienten, der an Hüftschmerzen leidet. Ihm empfiehlt Marcellus Wärme (man lege ihn in die Sonne) und eine Einreibung mit einer Mischung aus Zypressenöl, Bertramswurz, Schilfschaum, Wolfsmilch und ein wenig Natron. In der Tat ergibt diese Mischung ein sogenanntes ableitendes Mittel, also eine wärmende Salbe. Zusätzlich rät Marcellus, einen solchen Patienten einer Bäderkur zu unterziehen (lange Bäder in sehr warmem Wasser). Andererseits gibt er im selben Kapitel seines Werkes eine Rezeptur an, die den Leser sofort dazu verleitet, Marcellus als einen abergläubischen Quacksalber und Propheten der Drecksapotheke abzutun: Als Medizin empfiehlt er nämlich – ebenfalls bei Hüftschmerzen – neun Kügelchen Mäusedreck, die mit einem Quartarius (ca.1/4 Liter) Wein vermischt werden! Diesen Trank muss der Patient zu sich nehmen, während er mit dem Bein, wo ihn die Hüfte schmerzt, auf einem Schemel steht – natürlich nach Osten gewandt. Danach muss er sofort mit diesem einen Bein vom Schemel springen und auf diesem noch drei Mal herumhüpfen – und dies an drei aufeinander folgenden Tagen. Ich könnte noch eine ganze Reihe solcher »Widersprüche« anführen und ein sinnvolles Heilmittel einem sinnlosen gegenüberstellen. Es wäre eine höchst interessante und amüsante Reise durch die Geschichte der Heilkunde in Gallien. Leider würde dies den Rahmen des vorliegenden Buches sprengen. Aus diesem Grund folgen nur kurz und unkommentiert ein paar Blüten des Marcellus Empiricus. Aber beurteilen Sie bitte nicht alle traditionellen Hausmittel aus längst vergangenen Tagen an den unten aufgeführten Rezepten. Natürlich habe ich diese auch mit einem kleinen Augenzwinkern ausgewählt.