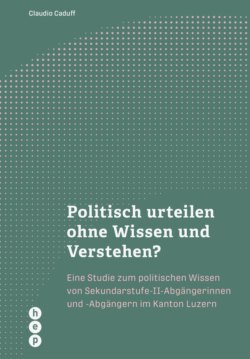Читать книгу Politisch urteilen ohne Wissen und Verstehen? (E-Book) - Claudio Caduff - Страница 6
2.1 Politikdidaktische Modelle
ОглавлениеSpätestens seit TIMSS und PISA Anfang des 21. Jahrhunderts fokussiert die politikdidaktische Diskussion auf die Frage, welche Inhalte und Kompetenzen für die politische Bildung zentral sein sollten. Schon im Jahr 2003 legte die Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE), die deutsche wissenschaftliche Fachgesellschaft für politische Bildung, einen Entwurf für nationale Bildungsstandards vor (zusammenfassend vgl. Sander 2014d), auf dessen Basis ein Kompetenzmodell entworfen wurde (GPJE 2004).
Abbildung 1: Kompetenzmodell der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE 2004, S. 13)
Überraschend daran waren zwei Tatsachen: Erstens herrschte in Bezug auf das Modell ein grosser Konsens unter den Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern, und zweitens war damals der bildungstheoretische und vor allem der bildungspolitische Paradigmenwechsel von der inputorientierten Lehr-Lern-Theorie zur outputorientierten Kompetenzorientierung praktisch unumstritten. Offenbar wollte man damals den Anschluss an die durch die sogenannte Klieme-Expertise (Klieme 2003) vorgelegte Neukonzeptionierung nationaler Bildungsstandards nicht verpassen.
Das Kompetenzmodell der GPJE (siehe Abbildung 1) erlangte schon innert Kürze grosse Bedeutung und wurde rasch zur Referenz der politikdidaktischen Weiterentwicklungen in Deutschland. So wurden beispielsweise bereits im Entwurf zu den drei Kompetenzbereichen politische Urteilsfähigkeit, politische Handlungsfähigkeit und methodische Fertigkeiten Standards für die verschiedenen Schulstufen definiert. Der breite Konsens unter den Politikdidaktikerinnen und -didaktikern bröckelte in der Folge allerdings schnell. Diese Erosion wird durch das GPJE-Kompetenzmodell selbst verursacht: Das die drei Kompetenzbereiche ergänzende «konzeptuelle Deutungswissen» wurde weder im Entwurf selbst noch später genauer bestimmt. Mittlerweile findet in der Gemeinschaft der deutschen Politikdidaktik eine heftige Kontroverse statt, die über die ursprünglich im Zentrum stehende Frage nach den relevanten Inhalten (Wissen, Konzepte, Kategorien) der politischen Bildung längst hinausgewachsen ist – es geht heute auch um Lerntheorien und um die Kompetenzorientierung in der schulischen Bildung generell.
Bevor der aktuelle Diskurs nachgezeichnet wird, sollen drei Kompetenzmodelle vorgestellt werden, die in der Folge des GPJE-Modells entwickelt wurden.
Das Modell von Gollob et al. (2007) lehnt sich stark an das GPJE-Modell an. In Abbildung 2 wird es knapp erläutert. Auffällig daran ist, dass (zumindest in der Verkürzung des Modells) Wissen und/oder Kenntnisse nicht vorkommen. Implizit findet man wohl Hinweise darauf in den «Sachaspekten» (im Kompetenzbereich A).
Abbildung 2: Kompetenzmodell nach Gollob et al. (2007)
Im Modell von Krammer (2008) findet sich neben der Urteils-, Handlungs- und Methodenkompetenz auch die Sachkompetenz (siehe Abbildung 3). Darunter versteht der Autor «jene Fähigkeiten, Fertigkeiten und jene Bereitschaft, die notwendig sind, um die Begriffe, Kategorien beziehungsweise die Konzepte des Politischen zu verstehen, über sie zu verfügen sowie sie kritisch weiterentwickeln zu können. Unter Begriffen sind hier die politischen Fachausdrücke, die sich von der alltagssprachlichen Verwendung durch exakte Definition unterscheiden, zu verstehen, unter Kategorien jene ‹Kernbegriffe›, denen allgemeine Merkmale eigen sind, sodass sich Gegenstände, Vorstellungen und Ereignisse diesen Merkmalen entsprechend zuordnen lassen. Basiskonzepte (key concepts) sind Leitideen beziehungsweise Grundvorstellungen, mit deren Hilfe Schüler und Schülerinnen politisches Wissen strukturieren und einordnen können. Sie werden in einem ständigen Prozess der Differenzierung und Komplexitätssteigerung weiterentwickelt» (S. 11). Zu den vier Kompetenzbereichen gesellt sich noch das «Arbeitswissen», das anlassbezogen ist und instrumentellen Charakter aufweist; es ist erforderlich, um sich über konkrete politische Fragestellungen zu informieren (Krammer 2008, S. 6).
Abbildung 3: Kompetenzmodell nach Krammer (2008, S. 6)
Moegling (2008) modelliert vier Kompetenzbereiche um die zentrale Metakompetenz «politische Mündigkeit» (siehe Abbildung 4).
Abbildung 4: Kompetenzmodell nach Moegling (2008, S. 14)
Er definiert in seinem Modell die politische Wissenskompetenz als «Fähigkeit, Wissen – sei es Faktenwissen oder konzeptuelles Deutungswissen, also auch Kernbestände von Theorien – aufzunehmen, zu verknüpfen, zu integrieren und zu erinnern» (S. 15). Damit beschreibt er aber eine allgemeine Lernfähigkeit in Bezug auf Wissen, wie sie wohl in praktisch allen Fächern notwendig ist. Über welches politische Wissen (seien das Begriffe, Konzepte, Kategorien oder Theorien) politisch mündige Menschen verfügen sollten, ist jedoch nicht klar.
Basierend auf den drei oben dargestellten Modellen politischer Bildung entwarfen Hellmuth & Klepp (2010, S. 116–123) ein «subjekttheoretisches Modell politischer Bildung» mit den beiden Kompetenzbereichen Reflexions- und Partizipationskompetenz (s. Abb. 5).
Abbildung 5: Subjekttheoretisches Modell politischer Bildung (Hellmuth & Klepp 2010, S. 118)
Reflexionskompetenz ist die Voraussetzung für Partizipationskompetenz, sie umfasst einerseits die (De-)Konstruktionskompetenz, die politische Sinnbildung ermöglicht, besonders aber den Einzelnen befähigt, «die eigene Sinnbildung zu hinterfragen und zu dekonstruieren» (Hellmuth & Klepp 2010, S. 116). Die (De-)Konstruktionskompetenz ermöglicht es dem Individuum zudem, Politik kritisch zu analysieren. (De-)Konstruktionskompetenz ist anderseits eine unabdingbare Voraussetzung für die Urteilskompetenz, und diese beiden setzen ihrerseits Methodenkompetenz voraus. Zur Partizipationskompetenz gehören die Kritik-, die Orientierungs- und die Handlungskompetenz.
Die Kritikkompetenz versteht sich als «Fähigkeit und Bereitschaft, die eigene politische Sinngebung dahingehend zu hinterfragen, ob sie […] – im Sinne der Aufklärung […] – individuelle Freiheit garantiert, ohne die Freiheit der anderen einzuschränken» (S. 122). Handlungskompetenz basiert schliesslich auf der Kritik- und der Orientierungskompetenz. Auf das rahmende (Arbeits-)Wissen wird auch in diesem Modell nicht weiter eingegangen.
Gerade aber an der Frage um das Wissen in der politischen Bildung entfachte sich die jüngste Kontroverse in der Politikdidaktik. Diese soll im Folgenden knapp dargestellt werden.