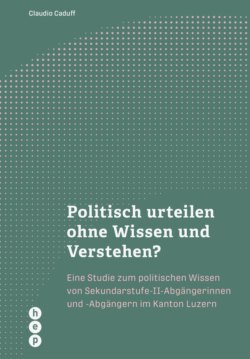Читать книгу Politisch urteilen ohne Wissen und Verstehen? (E-Book) - Claudio Caduff - Страница 8
2.3 Weitere politikdidaktische Ansätze
ОглавлениеIn der deutschen Politikdidaktik bestehen neben den bisher beschriebenen Ansätzen noch zwei weitere eigenständige Richtungen der politischen Bildung: Demokratielernen und historisch-politische Bildung. Gerhard Himmelmann (2005) legte vor knapp 15 Jahren ein politikdidaktisches Konzept vor, in dem das Demokratielernen im Zentrum steht. In Anlehnung an den Pragmatismus von John Dewey entwirft er ein politikdidaktisches Stufenmodell aus Lebensform, Gesellschaftsform, Herrschaftsform: Im Laufe ihrer Entwicklung erfahren Schülerinnen und Schüler Demokratie zunächst in ihrer unmittelbaren sozialen Umgebung, dann als Gesellschaftsform in sozialen Teilsystemen (besonders in der Schule und in Vereinen) und schliesslich als Herrschaftsform im Staat und in der Politik. Demokratielernen heisst nun nach Himmelmann, dass in der Schule nicht nur Politik unterrichtet wird, sondern dass je nach Alter und Schulstufe der Schülerinnen und Schüler «alle drei Ebenen im schulischen Bereich vorkommen und eine ganzheitliche Betrachtung von Demokratie zulassen. Der Zusammenhang dieser drei Ebenen sollte stets im Auge behalten werden» (Reinhardt 2014), damit die Lernenden Demokratie erfahren, erleben, begreifen und beurteilen können.
Armin Scherb (2014) führt in seiner «Pragmatistischen Politikdidaktik» drei Bausteine auf (S. 123–209):
•Sinnorientierung: Die Suche nach Sinn als menschliche Praxis (damit Leben gelingt) rechtfertigt das normative Prinzip der Sinnorientierung im Unterricht und mithin in der politischen Bildung.
•Politische Urteilsbildung als Problemlösungsprozess: Weil das Politische immer etwas Offenes, Umstrittenes ist, ist sowohl in Sachfragen als auch in Wertfragen jeder «Versuch, vorab feststehende Bewertungen und Urteile auf dem Weg einer Vermittlung zu übertragen» (S. 159), unzulässig.
•Offenheit der Schule: Die Schule muss ein Ort erfolgreicher Problemlösungsprozesse sein, und damit ist sie der wichtigste Ort für die Entwicklung der demokratischen Einstellungen bei den Schülerinnen und Schülern. Dafür muss sich die Schule inhaltlich, methodisch und institutionell öffnen.
Thomas Hellmuth (2014) begründet in seinem Werk Historisch-politische Sinnbildung die Verbindung von historischer mit politischer Bildung mit dem Hinweis, dass Geschichte als Konstruktion zu verstehen ist, da sie eine Deutung der nicht unmittelbar zugänglichen Vergangenheit ist. Diese Deutung ist jedoch stark von der Gegenwart ihrer Entstehung beeinflusst. Um diesem Verständnis von Geschichte Rechnung zu tragen, muss der Geschichtsunterricht jedoch gesellschaftskritisch und gegenwartsbezogen sein. Und damit ergibt sich die Nähe zur politischen Bildung, die ihrerseits von Problemen der Gegenwart ausgeht und gesellschaftliche Konflikte erfasst (S. 9).