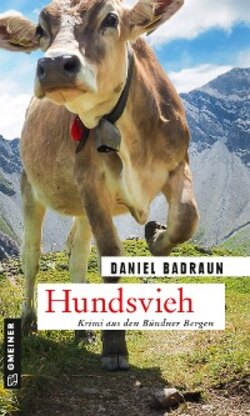Читать книгу Hundsvieh - Daniel Badraun - Страница 7
1.
ОглавлениеApril 1996
Der Eisenbahnwaggon kommt aus der Dunkelheit des Tunnels heraus, ein Blinzeln, schon sind wir in schwindelerregender Höhe auf dem Landwasserviadukt. Der Zug, ein Geländer, darunter die gähnende Leere. Irgendwo im Nichts Felsbrocken, Wasser, Büsche und Wiesen. Ich sitze da und starre hinunter in den Abgrund. Tiefer als in solch ein Loch hier könnte ich kaum fallen.
Vor einer Stunde bin ich in St. Moritz losgefahren. Schnellzug nach Chur mit Halt in Celerina, Samedan, Bergün, Filisur, Tiefencastel, Thusis und Reichenau. In jedem dieser Orte würde ich liebend gerne aussteigen, einen Tee trinken und dann gemütlich zurückfahren. Doch ich kann und darf nicht.
Wie gelähmt starre ich in die Tiefe, zwischen den Pfeilern des mächtigen Bauwerks fließt weit unten der tosende Fluss. Einige japanische Touristen hinter mir lehnen sich mit ihren Fotoapparaten und Filmkameras weit aus dem Fenster. Aufregung macht sich breit. Das Viadukt muss abgelichtet werden, möglichst aus der nächsten Kurve heraus, damit zu Hause einige der roten Wagen auf dem Bild erscheinen. Könner bringen auch noch den Tunnelausgang mit aufs Bild. Die Rhätische Bahn, die ›Kleine Rote‹, wie die Schmalspurbahn von den Werbern liebe- und effektvoll genannt wird, ist ein Tourismusmagnet für Eisenbahnfreunde aus der ganzen Welt. Diese Strecke mit den imposanten Bauwerken müsste eigentlich UNESCO-Weltkulturerbe werden. Für mich ist dieser Zug das einzig mögliche Verkehrsmittel, das mich von A nach B bringt, von St. Moritz nach Chur, die Straße kommt für mich nicht infrage, denn ich kann und will mir keinen Wagen leisten. Und mit dem Fahrrad überqueren nur gestählte Fitnessapostel in einer Sinnkrise die Pässe, die aus meinem Tal herausführen.
Knapp zwei Stunden Zugfahrt trennen St. Moritz von der Kantonshauptstadt Chur, in der mich das Unvermeidliche erwartet.
Die Tür des Abteils geht auf. Der Imbisswagen.
»Kaffee, Gipfel, Mineral, Sandwich!«
Langsam rollt der Wagen auf mich zu. Professionelle Freundlichkeit in einem dunklen Gesicht. »Sie wünschen, Chef?«
»Einen Tee bitte.«
»Creme, Zucker, Lemon?«
»Creme und Zucker.«
Breitbeinig schenkt der Hochgebirgszugkellner ein. »Gipfel auch, Chef?« Lächelnd stellt er den Becher auf das Tischchen unter dem Fenster mit der fantastischen Landschaft und schaut mich erwartungsvoll an.
»Kein Gipfel.«
»Sandwich?« Der gibt wohl nie auf! »Käse, Schinken, Salami?«
Genervt schüttle ich den Kopf.
»Zigaretten?«
Ein müdes Kopfschütteln. Irgendwann in einer fernen Vergangenheit, als alles noch so leicht schien, das Leben weit und verheißungsvoll vor mir lag, da rauchte ich. Nicht viel, eine Zigarette da, eine dort zu einem guten Kaffee oder einem Glas Wein. Mit einem Freund am Fluss, wir schauten dem Wasser nach und zogen den Rauch tief in uns hinein. Das Wasser trug unsere Träume und Wünsche in die Welt hinaus. Irgendwie glaubte ich, das Leben zu spüren.
Unterdessen bin ich fast dreißig, das Leben hat mich manchmal leicht gestreift, doch richtig fassen konnte ich es nie. Ein Hauch von Ewigkeit flog vorbei, damals am Ganges in Indien, an den Ghats, den Treppen, die hinunter zum Wasser führten. In ihren langen Saris die Frauen, mit einem schlichten Tuch um den Bauch die Männer, so gingen sie langsam hinunter zum Fluss, übergaben ihre Opfergaben dem Wasser, führten dann die vorgeschriebenen rituellen Waschungen durch.
In Indien, da spürte ich etwas, das sich wie ein Sinn anfühlte, eine tiefe Intensität. Seither ziehen die Tage und Wochen an mir vorbei, ziellos streife ich durch dieses Leben, in dem ich nicht wirklich angekommen bin und keine echte Herausforderung spüre.
Der Mann zieht eine Schublade aus seinem kleinen Wagen.
»Fisherman’s Friend vielleicht?«
»Nein, danke.«
Im Moment habe ich nicht sehr viel Geld, der Hunderter in meiner Tasche gehört nicht mal mir, er ist bloß geliehen, Mona wird ihn zu gegebener Zeit von mir zurückverlangen.
Langsam lasse ich den Teebeutel kreisen, ziehe ihn, als ich glaube, die Brühe sei dunkel genug, aus dem Becher, Zucker, Creme, ein erster Schluck – eigentlich hätte ich es wissen müssen.
»Ach, Mona, musste das wirklich sein?«
Gedankenverloren schaue ich dem Mann nach, wie er mit seinem schwankenden Wagen im nächsten Abteil verschwindet.
Einfach rausgeschmissen hat mich Mona heute Morgen, mir blieb gerade noch Zeit, um meine Reisetasche zu packen, schon standen wir beide an der Tür unserer Wohnung, die in Wirklichkeit ihre Wohnung ist, weil sie den Vertrag unterschrieben hat und meistens die Miete alleine bezahlt. Mit ihrem Lohn, den sie sich hart verdient auf der Bank, wie sie bei jeder möglichen und auch jeder unmöglichen Gelegenheit immer wieder betont.
»Weißt du, Claudio, ein regelmäßiges Einkommen ist die Basis für ein geregeltes Leben!« Monas Grundsätze und ihre Sturheit sind in gewissen Situationen kaum auszuhalten, vor allem regen sie mich nicht zur Nachahmung an, ganz im Gegenteil, aber das will und kann meine Freundin einfach nicht verstehen.
Ein geregeltes Leben heißt für Mona eine gut eingerichtete und geheizte Wohnung, ein Wagen, alle nötigen und unnötigen Versicherungen, diverse Anschaffungen nach dem Lustprinzip, immer mal wieder neue Kleider, Schuhe natürlich, auswärts essen und Kino. Zudem leistet sie sich einen ganz speziellen Luxus, wie sie manchmal erklärt, begleitet von einem gekünstelten Hüsteln, das mir das Blut in den Gefäßen erstarren lässt. Dieser Luxus bin in ihren Augen ich.
Natürlich steuere ich immer mal wieder etwas zum gemeinsamen Haushalt bei, kaufe ein, wenn ich Geld habe, übernehme alle möglichen Hausarbeiten, die sie nicht mag, sauge, mache den Abwasch, putze das Klo, gieße die Blumen, wasche ihre Blusen und bügle sie ordentlich. Wenn ich keinen Job habe, was öfters der Fall ist, sieht Monas Wohnung immer sauber und akkurat aus.
Und wie gesagt, zwischendurch verdiene ich einiges. Sogar ziemlich viel, wenn ich für meinen Freund Reto Müller einen Auftrag erledige, im Winter als Aushilfs-Skilehrer arbeite oder im Sommer als Wanderleiter eine Gästegruppe durch ein romantisches Seitental führe.
Doch was macht sie? Hartherzig und stur, wie sie nun einmal ist, setzt sie alles daran, mich wieder in die richtige Arbeitswelt zu integrieren. Eine richtige Arbeit bedeutet für sie Ordnung und Sicherheit, für mich aber Sklaverei und Enge. Zweiundvierzigstundenwoche, fünf Wochen Ferien, dreizehnter Monatslohn. Chef und Telefon und Computer und Sitzungen und der tägliche Stau vor der Kaffeemaschine. Wie ich das hasse! Mona sollte doch wissen, wie wenig ich mich zu geregelter Arbeit eigne.
»Hier, Claudio!« Schnell streckte sie mir eine Fahrkarte nach Chur zu, einen Hunderter Startkapital und ein Stelleninserat. »Melde dich um zwei bei dieser Adresse, ich habe angerufen, die haben einen richtigen Job für dich.«
Und schon war ich draußen. Vielleicht hätte ich mich nach der Wintersaison etwas intensiver um Arbeit bemühen sollen, dann wäre ich jetzt noch bei Mona. Doch nachdem die Pisten weggetaut und die letzten Gäste Ende März abgereist waren, wollte ich zuerst etwas ausspannen. Mona hatte endlich Ferien, wir fuhren nach Italien, denn es gibt nichts Öderes, als die Zwischensaison in einem Tourismusgebiet zu verbringen. Geschlossene Lokale, ausgeräumte Boutiquen, leere Straßen, überall Baustellen. Die Wiesen braun und staubig, alle Farben aus dem Tal verschwunden, der Schnee auf den Bergen noch ziemlich nah. Kein Kino, kein Hallenbad, keine Freunde, mit denen man sich die Nächte um die Ohren schlagen könnte. Keinerlei Frühlingsgefühle.
Mit Mona nach Italien zu fahren ist dagegen ein Fest! Da wird in guten Hotels übernachtet, ausgiebig getafelt, genossen und wieder richtig aufgetankt. Nach der harten Wintersaison ging es mir mit jedem Tag Müßiggang besser.
Mein Kontostand bewegte sich allerdings in die entgegengesetzte Richtung, als wir zurückkamen, war nicht mehr viel übrig von meinem Winterverdienst. Wie ich für Mona ein Luxus bin, den sie sich leistet, ist auch Mona ein Luxus für mich. Ein Luxus aber, den ich mir eigentlich nicht leisten kann.
Einige unnötige Anschaffungen wie diverse Lampen, ein Teppich, Vorhänge für Monas Wohnung gaben meinem Vermögen endgültig den Rest. Und irgendwann letzte Woche war ich bei Null angelangt.
»Hier, deine Zahnbürste, hast du die absichtlich liegen lassen? Komm zurück, wenn du dich selber ernähren kannst, klar?« Dann war die Tür endgültig zu und Mona weg.
Die Japaner hängen wieder am Fenster. Gleich werden wir das Solisviadukt überqueren, das höchste Bauwerk der Albula-Strecke. Es wird weiterhin ausgiebig fotografiert, auch der Bahnhof Solis, bewohnt von einem Geranien-Fetischisten, wird abgelichtet und Pixel für Pixel nach Japan transferiert. Dann folgt der nächste Tunnel, eine Möglichkeit, auf den diversen Displays die Ernte der letzten Minuten zu begutachten.
Ich ziehe das zerknitterte Inserat hervor. ›Das Kunsthaus Chur sucht einen initiativen Mitarbeiter oder eine initiative Mitarbeiterin für diverse Aufgaben. Bei Fragen steht Ihnen Paul Fritschi gerne zur Verfügung.‹
Mona hatte angerufen und mich angemeldet. So weit bin ich gesunken.
Sils im Domleschg, Kreuzungspunkt. Auf dem anderen Geleise setzt sich ein entgegenkommender Zug in Bewegung. Rote Wagen, gefüllt mit lächelnden und winkenden Touristen, ziehen vorbei. Dieser Zug würde mich auf dem direkten Weg zurück nach St. Moritz, zurück zu Mona bringen. Ich schüttle trotzig den Kopf. Nein. Mona, ich komme nicht angekrochen! Sie wird mich erst wieder sehen, wenn ich zu Geld gekommen bin, wenn ich sie zum Abendessen ausführen kann.
Thusis. Ich schaue zu den hellgrünen Wiesen hinauf, sehe zwei Biker am Hang, einen Gleitschirmflieger im tiefblauen Himmel kreisen, einige Wanderer. Da müsste man sein, denke ich wehmütig und schlürfe den bitteren Tee, der mittlerweile kalt geworden ist. Schlimmer kann man sich ein Leben kaum mehr vorstellen.
Ein Ruck weckt mich auf. Chur, mein Rücken ist steif, ich bin zu lang, um bequem im Zug schlafen zu können, langsam steige ich aus, durchquere die Unterführung, ohne die unterirdischen Geschäfte zu beachten. Eine Rolltreppe bringt mich hinauf. Es ist warm, die Sonne wirft ein mildes Licht auf den Bahnhofsplatz, ich kaufe Brot, ein Stück Käse, setze mich auf eine Bank und esse.
Eigentlich ist es ganz angenehm, hier zu sein. Die Luft ist mild, es riecht nach Frühling, dagegen werden im Engadin die Wiesen erst jetzt langsam grün. In Chur dagegen sind die Straßencafés bereits gut gefüllt, die Leute sind leichter angezogen, ein Lachen liegt in der Luft.
Ein streunender Hund setzt sich vor mich auf den Asphalt und schaut mich mit großen Augen an.
»Na du?«, frage ich, er winselt leise.
Also teile ich den Rest des Brotes und den Käse mit ihm.
»Ah, un amico dei cani, ein Hundefreund, das gefällt mir!« Ein elegant gekleideter Mann im dunklen Anzug mit Aktentasche und Hut setzt sich zu mir auf die Bank. Umständlich nimmt er die Sonnenbrille ab und reibt sich die Augen.
»Allora? Wie läuft es so?«
»Nicht besonders«, brumme ich und werfe dem Hund einen letzten Bissen Brot zu. Geschickt fängt mein neuer Freund den Happen auf und verzieht sich damit unter die Bank.
»Wollen Sie etwas verdienen? Un piccolo lavoro, nichts Großes, eine Gefälligkeit für einen Freund.«
»Lavoro? Arbeit?« Dieses Wort verursacht mir immer wieder Übelkeit, da kann ich einfach nichts dagegen tun.
Der Fremde hebt beruhigend die Hände. »No, no, keine Angst, es ist nichts Anstrengendes, eher etwas für einen amico dei cani, für einen Hundefreund.« Und er lacht, dass seine Goldzähne blitzen.
»Können wir vielleicht später nochmals darüber reden?« Ich zeige auf die Uhr beim Bahnhof. »Ich habe um zwei eine Verabredung.«
»Kein Problem, dann treffen wir uns più tardi, später. Ich warte im Café auf dem Arcas.« Er steht auf und klopft mir freundlich auf die Schultern. »Ciao!«
Einen Moment noch schaue ich ihm nach. Was will der Mann von mir? Sehe ich aus wie einer, der dringend auf Arbeit angewiesen ist? Wie jemand, der hungert? Der Hund winselt, er bekommt noch eine Portion Streicheleinheiten, mehr kann ich im Moment nicht bieten. Dann nehme ich meine Reisetasche und gehe die Bahnhofstrasse hinauf Richtung Kunsthaus.