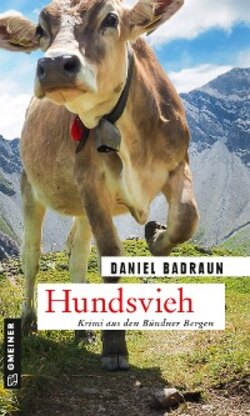Читать книгу Hundsvieh - Daniel Badraun - Страница 8
2.
ОглавлениеWenn ich es mir recht überlege, ist das mit der Kunst keine schlechte Idee. Ich sehe mich bereits in der Uniform eines Museumswächters mit blinkendem Namensschild. Unbeweglich würde ich neben einer modernen Skulptur stehen und mir amüsiert die Kommentare der ratlosen Museumsbesucher anhören. Es gibt anstrengendere Methoden, um an Geld zu kommen.
Die Bahnhofstrasse führt leicht ansteigend hinauf zum Postplatz, dem Tor zur Altstadt von Chur. Rechts stehen mächtig und etwas angestaubt die traditionsreichen Warenhäuser Globus und Manor, links davon befinden sich in den Überbleibseln eines vormals stattlichen Parks zwei Villen. In der größeren ist die Verwaltung der Rhätischen Bahn beheimatet. Rechts davon steht die Villa Planta, ein protziger Bau von zurückhaltender Schönheit, der das obere Ende der Bahnhofstrasse markiert.
Ehrfürchtig betrete ich das Kunsthaus. Hier würde ich in Zukunft arbeiten. Einen Moment bleibe ich in der verglasten Veranda stehen, ziehe die Luft ein, schaue mich um. Links ein Raum mit Schließfächern, rechts die bescheidene Cafeteria.
Die Frau im cremefarbenen Wollkleid will mich aufhalten an der Kasse, es sei nicht erlaubt, mit einer Tasche das Museum zu betreten. Ich stelle mich vor, zeige ihr das Inserat aus der Zeitung.
Sie lächelt reserviert, führt mich dann vorbei an einigen großformatigen Bildern, »Angelika Kaufmann«, sagt sie beiläufig. Marmorboden, Säulen, hohe Räume, links ein Lichthof. »Nicht einfach, hier Kunst zu präsentieren, vor allem nicht moderne Werke!«, erklärt sie, klopft dann an einer Tür und öffnet.
»Herr Fritschi, Claudio Mettler aus St. Moritz ist da.« Dann macht sie Platz und lässt mich vorbei.
Paul Fritschi, der Direktor des Bündner Kunsthauses, empfängt mich in seinem kleinen Büro. Braun gebrannt, sportliches Hemd, Jeans. Kein Anzug, keine Krawatte. Er bietet mir den Besucherstuhl an und setzt sich mit verschränkten Armen auf die Kante seines mit Papieren überladenen Schreibtisches.
»Willkommen in der Villa Planta! Kennen Sie die Geschichte des Hauses?«
Ich schüttle den Kopf.
»Die Familie von Planta machte ihr Geld mit dem Baumwollhandel und dem Eisenbahnbau in Ägypten. Die letzten weiblichen Nachkommen der Familie schenkten die Villa dem Kanton mit der Auflage, ein Kunsthaus einzurichten. Außerdem bescherten sie Chur eine Frauen- und Geburtsklinik.«
»Interessant«, sage ich und versuche, ein Gähnen zu unterdrücken.
Fritschi räuspert sich. »Mögen Sie Kunst, Mettler?«
Ich höre den spöttischen Unterton in seiner Stimme. Daher lasse ich mich nicht auf eine Diskussion über die toten Helden und lebenden Hungerleider der Bündner Kunstgeschichte ein. Zurückhaltung und Bescheidenheit, besser, ich versuche gar nicht erst, mit meinem lückenhaften Halbwissen über die gezeigten Bilder und Statuen zu glänzen und mich dabei lächerlich zu machen.
So reagiere ich mit einer Gegenfrage: »Sie haben Arbeit für mich?«
Er mustert mich schweigend, nickt dann. »Können Sie mit einem Rasenmäher umgehen?«
»Was hat das mit Kunst zu tun?«
»Morgen Abend, Herr Mettler, werden wir einige ausgesuchte Statuen hier im Park präsentieren, ein gepflegter Rasen gehört dazu.«
»Ich verstehe nicht ganz …«
»Melden Sie sich bitte morgen um acht beim Empfang, dann werden wir weitersehen.« Fritschi steht auf.
»Hat nicht Joseph Beuys gesagt, dass jeder Mensch ein Künstler ist?«, werfe ich ein. »In diesem Bereich kann ich mich sicher nützlich machen!«
»Beuys hätte sicher nichts gegen die Kunst des Rasenmähens einzuwenden«, sagt der Direktor und lächelt kühl. Die Audienz ist beendet.
Die Dame am Empfang entlässt mich mit einem distanzierten Kopfnicken.
Dann stehe ich draußen auf der Straße mit meiner Reisetasche. Mein Freund Reto Müller kommt mir in den Sinn.
»Besuch mich, wenn du mal in Chur bist, Claudio. Meine Tür steht immer für dich offen!«
Reto ist ein Macher, einer, der überall ein Geschäft wittert, der Bedürfnisse erkennt und entsprechende Angebote entwickelt, bevor die Konkurrenz zur Stelle ist, auch bevor die Kundschaft selbst weiß, was sie wirklich braucht. Seine Karriere begann Müller als Mitarbeiter beim Kurverein St. Moritz. Er bediente Gäste am Telefon und am Schalter, buchte Zimmer und organisierte Ausflüge. Oft musste er Leute abweisen, denn in den klaren Strukturen des Tourismusbüros gab es keine Möglichkeiten, um sehr spezielle Wünsche zu erfüllen. Schnell merkte er, dass in der Tourismusbranche jenseits der öffentlichen Organisation viel Geld zu verdienen ist, vorausgesetzt, man hatte keine Skrupel und wusste, wie man es anpackte.
So machte sich Müller selbstständig, er betrieb einen Limousinenservice, brachte die reichen Gäste vom Flugplatz in Samedan zu ihren Villen in St. Moritz und von den Villen zum Shopping, zu den Restaurants und Clubs. Auch sonst organisierte er dies und das für seine illustren Kunden, ihre Wünsche konnten noch so ausgefallen sein. Er besorgte alles für die kleinen und großen Räusche der Sinne, kannte Anwälte und Notare, Richter und Clubbesitzer, kassierte und verteilte.
Dabei bewegte er sich des Öfteren mal am Rand der Legalität, er verstand es aber immer, mit sauberen Händen dazustehen. Bei heiklen Aufgaben standen ihm stets Leute zur Seite, die bereit waren, für ein paar Hunderter Nebenverdienst einiges zu riskieren; Leute wie ich eben.
»Meine Gäste«, sagte Müller, wenn er etwas zu viel getrunken hatte, »sind stinkreich, darum können sie sich den Luxus erlauben, ohne Moral zu leben. Ich hingegen, kann mir nur Luxus leisten, weil ich ohne Moral lebe.«
Mit seinem Bierbauch unter der Lederweste, den dunklen, öligen Haaren, die hinter dem Kopf zu einem kleinen Pferdeschwanz zusammengebunden sind, dem Dreitagebart im breiten Gesicht ist er eine eindrückliche Erscheinung, nichts bringt ihn aus der Ruhe – außer vielleicht ein Anruf seiner Mutter, bei der er bis vor Kurzem immer noch lebte.
Im Februar verkaufte Müller überstürzt seinen Limousinenservice, gab seine Geschäftsräume auf und zog Hals über Kopf nach Chur. Irgendetwas war bei einem Deal schiefgelaufen, er war wohl einigen einflussreichen Leuten zu sehr auf die Zehen getreten. Es erschien ihm ratsam, eine Weile aus dem Engadin zu verschwinden. Selbst seine Mutter hätte ihn nicht zurückhalten können.
Müllers Wohnung muss irgendwo hinter dem Postplatz sein. Bei der nächsten Telefonkabine rufe ich die Auskunft an und bekomme für einige Münzen die gesuchte Adresse, schleppe die Reisetasche zwei Straßen weiter und dann noch hinauf bis ins dritte Stockwerk.
›Müller Enterprises‹ steht auf einem protzigen Türschild. Typisch Reto.
Trotz mehrmaligem Klingeln öffnet niemand. Schade, er ist nicht zu Hause. Weil ich nicht weiß, wohin ich sonst gehen soll, lasse ich die Reisetasche vor der Tür stehen und schreibe ihm einen Zettel.
Hoffentlich ist Reto nicht irgendwohin in die Ferien gefahren.
Ohne die schwere Reisetasche fühle ich mich gleich viel besser. Der Mann von heute Mittag kommt mir in den Sinn, der Mann, der einen Auftrag für einen Hundefreund hat. Ein Auftrag bedeutet Geld, bedeutet Essen, bedeutet eine schnelle Rückkehr nach St. Moritz. Da ich nichts anderes zu tun habe, beschließe ich, ihn zu treffen. Ich schlendere durch die Altstadt, vorbei an der reformierten Martinskirche, die eingeklemmt zwischen den Häusern unterhalb des Hofes steht. Hier die stolze, reformierte Pfarrkirche, oben die pompöse Kathedrale, Sitz des Bischofs von Chur, abgehobener und reichlich konservativer Herrscher über weit verstreute und doch widerspenstige Gläubige. Gleich hinter dem Martinsplatz führt ein schmaler Durchgang hinaus auf den Arcas. Lange konnten die Churer wenig mit diesem Platz anfangen, er war zu groß, zu leer, lag nicht im Zentrum, hatte keine Tradition. Da die Verkehrsplaner nun einmal die Fläche zwischen den Häusern von den Autos befreit hatten, begann eine zögerliche Inbesitznahme des Arcas. Markttreiben an Samstagen, im Sommer eine Freilichtbühne, spielende Kinder und kaffeetrinkende Mütter sowie in die Sonne blinzelnde Müßiggänger.
Die Tische vor den Restaurants sind auch heute gut besetzt, ich brauche eine Weile, bis ich den Italiener hinter einer Zeitung entdecke.
»Fame? Haben Sie Hunger? Ich würde Sie gerne einladen.« Er schaut sich die Speisekarte an und bestellt uns Wein und etwas zu essen.
»Salute, zum Wohl. Io sono Marco Morandi.« Er hebt sein Glas.
»Ich bin Claudio Mettler, freut mich. Um was geht es bei dieser Arbeit?«
»Ma no, Signore Mettler, erst das Essen, dann il lavoro.«
Wir schauen auf den Platz hinaus, Kinder spielen am Brunnen, junge Leute mit Schultaschen gehen vorbei, Frauen bummeln schwatzend über das Pflaster.
Es wird aufgetragen, mir wird bewusst, dass ich heute noch nichts Ordentliches im Magen hatte, wir essen, prosten uns zu, unterhalten uns über Hunde, dann über Kunst.
»Kennen Sie Giacometti?«
»Alberto Giacometti? Ich bin sozusagen Experte für Moderne Kunst, ich arbeite hier im Kunsthaus.« Eine meiner Schwächen – und da gibt es laut Mona einige – ist die der Übertreibung. Aber den Bergeller Künstler, der in Paris zu Weltruhm kam, kennt wirklich fast jedes Kind, er ist auf der Hunderternote abgebildet, seine dünnen Skulpturen stehen in vielen bedeutenden Sammlungen und werden bei Auktionen zu Rekordpreisen gehandelt.
»Che fortuna! Was für ein Glück für mich, sehen Sie, ich habe einen Freund, dieser Freund liebt Hunde, und er liebt Giacometti und …« Morandi erstarrt mitten im Satz, springt dann eine Entschuldigung murmelnd auf und hastet hinüber zu einem Japaner, der am Rand des Platzes steht, dem Italiener zuwinkt und Häuser fotografiert.
Gemächlich leere ich meinen Teller und sehe, wie Morandi mit dem Japaner intensiv diskutiert, denn Morandi gestikuliert wild mit den Händen, er zeigt auch immer wieder zu mir herüber. Ein Radfahrer quert den Arcas, er weicht einem hinkenden Rentner aus und verschwindet am unteren Ende des Platzes. Dann schaue ich zwei Kindern zu, die sich am Brunnen nass spritzen, eine Mutter schimpft, und als ich mich wieder umdrehe, sind Morandi und der Japaner verschwunden.
»Kann ich abräumen? Oder kommt der Herr noch?« Die freundliche Bedienung deutet auf Morandis halb vollen Teller, ich schüttle den Kopf, sie stellt die Teller zusammen.
»Darf ich Ihnen noch etwas bringen?«
Wieder schüttle ich den Kopf. Da habe ich mich ganz schön reinlegen lassen. Von wegen Einladung. Nun sitze ich da und muss wohl die ganze Rechnung begleichen, dabei habe ich selbst nur noch knapp neunzig Franken in der Tasche.
Gleich kommt der peinliche Moment, gleich wird man mir mit einem professionellen Lächeln und in Erwartung eines ordentlichen Trinkgeldes die Rechnung präsentieren. Schnell habe ich unsere Ausgaben zusammengerechnet, meine neunzig Franken würden knapp ausreichen, hätte Morandi nur einen billigeren Wein gewählt. Nebst den Schulden hat mir Morandi nichts anderes zurückgelassen außer einer Streichholzschachtel, die ich einstecke.
Die Schatten wandern über die Fassaden, ich trinke langsam den teuren Wein und sehe zu, wie der Platz sich allmählich leert. Aus den Augenwinkeln bemerke ich, wie die Serviertochter rundherum einkassiert.
»Bringen Sie mir bitte einen Espresso und die Rechnung, ich muss noch schnell …«
»Aber …«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, gehe ich zum Haus hinüber, die Jacke lasse ich hängen, das macht einen besseren Eindruck, wirkt weniger verdächtig. Ein Zechpreller lässt seine Jacke nicht hängen, er rennt einfach so davon.
Die Klos sind im Untergeschoss, ein mittelalterlich anmutendes Treppenhaus führt mich hinunter in die Tiefen Churs. Dunkle Holztüren, Schieferplatten, moderne Sanitärinstallationen. Die Fenster hier unten sind klein, nur ein enger Lichtschacht führt nach oben. Da komme ich unmöglich raus. Verzweifelt betrete ich eine der Kabinen, reiße so viel Papier wie möglich von der Rolle und mache einen kleinen Haufen am Boden. Dann ziehe ich Morandis Streichholzschachtel aus der Tasche und zünde den Haufen an. Im allgemeinen Durcheinander eines Feuers würde ich verschwinden können.
Draußen geht die Wasserspülung, ein Handy spielt die Elise von Beethoven.
»Ja? … Nein, Mama, nicht jetzt …. Aber Mama, ich bin in einer wichtigen Besprechung! … Sicher, Mama, ich rufe zurück, kein Problem Mama, ich vergesse es nicht.«
Mein Feuer qualmt immer mehr, der Kerl da draußen soll mit seiner Mutter endlich verschwinden, damit ich »Feuer, Feuer!« schreien und abhauen kann. Beißender Rauch breitet sich aus, ich beginne zu husten.
»He, was machst du da drin, bist du verrückt geworden!« Der Mann mit dem Beethoven-Handy hämmert gegen meine Klotüre. »Lebst du noch?«
Ich sehe kaum noch etwas, meine Augen tränen, atmen kann ich auch nicht mehr, so gebe ich auf, entriegle die Türe und beginne, das Feuer auszutreten. Der Mann hilft mir, reißt dann alle Fenster auf, damit der Rauch abziehen kann, bevor die Brandmelder Alarm auslösen. Nach wenigen Minuten ist meine kümmerliche Brandstiftung Geschichte, eine lahme Erinnerung. Ich stehe da und starre verlegen auf meine Schuhe.
»Wolltest du dich mit WC-Papier verbrennen?« Er lacht, während ich mir kaltes Wasser über das Gesicht laufen lasse. »Mettler, Mettler, etwas mehr Stil hätte ich dir schon zugetraut.«
Langsam trockne ich mir das Gesicht ab. Vor mir steht in voller Körperfülle inklusive Lederweste und Dreitagebart … Reto Müller.
»Hör auf zu lachen, Reto, ich stecke in der Klemme, oben wartet das Personal mit einer astronomischen Rechnung auf mich, und ich habe kein Geld.«
»Das ist doch kein Grund, die ganze Churer Altstadt einzuäschern, oder?« Müller zieht eine fette Brieftasche hervor und gibt mir zwei Hunderter. »Reicht das? Oder brauchst du meine Hilfe sonst noch?«
»Vor deiner Wohnung steht meine Reisetasche, wenn es geht, würde ich gerne ein paar Nächte bei dir schlafen.«
»Mettler, du bist doch mein Freund, und du weißt, dass ich dir keinen Wunsch abschlagen kann.« Müller streicht sich über seine eingeölten Haare und prüft nach, ob sein Schwänzchen richtig sitzt.
»Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll.« Langsam steigen wir die Treppe hinauf.
»Das, mein Freund, werde ich dir heute Abend genau erklären!« Müller klopft mir auf die Schulter. »Um sieben bei mir in der Wohnung. Pünktlich!«
Drüben am Tisch steht mein kalter Espresso. »Kann ich bitte zahlen?«
»Das wollte ich Ihnen schon vorher sagen«, flötet die Bedienung zuckersüß, »ihre Konsumation wurde bereits beglichen!«
»Und wer, bitte schön, hat bezahlt?«
»Ein Japaner, er hat auf Sie und den anderen Mann gezeigt und gesagt, das gehe alles auf seine Rechnung.«
»Und wo finde ich diesen Wohltäter? Schließlich will man sich doch bedanken.«
»Er hat gesagt, er warte vor der Martinskirche auf Sie!« Die junge Frau zuckt mit den Schultern und beginnt dann, die Tischtücher einzusammeln.