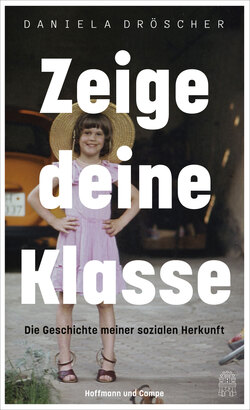Читать книгу Zeige deine Klasse - Daniela Dröscher - Страница 7
Das Küchenfenster, aus dem man als Kind blickt – ein bis vier Jahre
ОглавлениеIch erinnere mich an einen Moment des Innehaltens während der Pina-Bausch-Retrospektive, die 2016 im Berliner Martin-Gropius-Bau gezeigt wurde. Ich war ernsthaft erstaunt, zu erfahren, dass die Meisterin des tänzerischen Humors aus einer Solinger Gastwirtfamilie stammte. Was von dieser einfachen Herkunft, fragte ich mich, ist wohl eingeflossen in ihre federleichte Pantomime?
In einer Dokumentation stellte sich ein Kritiker genau diese Frage und beantwortete sie sich selbst wie folgt: Pina Bausch habe dem klassischen Ballett »die Ferse zurückgegeben«. Der Beitrag stammte aus den 80er-Jahren, ich merkte dem Mann seine Begeisterung an. Auch deshalb hat sich mir der Satz so eingeprägt. Ich liebe die Vermischung von Ernst und Unterhaltung.
Ein Kind ist mit dem Inventar und den Insignien von sozialen Räumen umgeben: Gestik, Mimik, Sprachduktus etc. Die vier Wände, in denen es aufwächst, sind der Schoß des Wirklichen (Mircea Eliade). In diesem Fall war das kindliche Zuhause das Wirtshaus der Eltern. Wie bewusst Pina Bausch dieser Einfluss gewesen sein mag, kann ich nicht einschätzen. Im Zentrum ihrer Ästhetik aber steht die alltägliche Geste. In ihren Choreographien wimmelt es vor Akrobatik und Clownerie, also niedrigeren kulturellen Formen. Ihr Ensemble setzte sich aus Menschen verschiedenster Nationalitäten zusammen, darunter viele Laien, die sich MIT HÄNDEN UND FÜSSEN verständigten. Ausgangspunkt der Arbeiten waren oft Gesten und Mimiken, die nach dem sprichwörtlich Bodenständigen im Menschen suchten. Dem, was sie jenseits von Sprache an geteilter Körperlichkeit miteinander verbindet: die zu einem U verzogenen Lippen, das königlich erhobene Haupt, das Naserümpfen, das Sich-auf-dem-Absatz-Umdrehen, das Ärmelhochkrempeln, der verschmierte Lippenstift.
Lange Zeit hatte ich diesen Boden, diese Ferse nicht, hatte ich doch meine Herkunft samt Nabelschnur gekappt. Wie ein Geist schwebte ich zwischen schwarzer Schrift und weißem Papier über den Dingen.
Aus den ersten vier Lebensjahren erinnert ein Kind kaum etwas. Ich fand es empörend, dass ich aus dieser Zeit nichts wusste. Stattdessen musste ich mit Fotografien sowie Erzählungen anderer vorliebnehmen.21 Symptomatisch ist, was sich zur ersten Erinnerung stilisiert. In meinem Fall ist es die Erinnerung an mein Überleben.
Als ich vier Jahre alt war, rettete mein Vater mich vor dem Ertrinken. Während eines Adria-Urlaubs nahm meine ältere Großcousine mich an die Hand und lief mit mir ins Meer. Ich konnte noch nicht schwimmen. Unvermittelt löste meine Cousine den Griff, und die Wellen schwappten umgehend über mir zusammen. Mein Vater, der vom Strand aus mit Argusaugen über mich wachte, stürzte augenblicklich los. – Das ist meine erste visuelle Erinnerung, und sie ist zur Hälfte fiktiv, aus den Erzählungen meines Vaters nachkoloriert: Ich treibe strampelnd und mit von Salzwasser gefüllten Lungen am Meeresgrund und starre stumm und panisch in den wässrig blauen Himmel, bis mein Vater mich aus den Tiefen des Wassers hebt.22
Mein Vater erzählte mir später oft von meiner Rettung. Es passte zu der Rhetorik vom »harten Leben«, zu der meine Großeltern und partiell auch meine Eltern neigten.
Versuch, die Ferse zurückzugewinnen: Der buntscheckige Boden meiner Kindheit
der braune weiche Teppich, in den meine kleinen Füße einsinken – mein Kinderzimmer
der »Speicher«, immer leicht sandig – der Dachboden direkt gegenüber vom Kinderzimmer, dort trocknete die Wäsche
die alte leberbraune knarzende Holztreppe
beigefarbenes Linoleum – die Küche
der Parkettboden des Wohnzimmers: spiegelglatt, darauf ein rubinroter Perserteppich
karamellfarbene 70er-Jahre-Fliesen – das Bad
die hellgrau gefleckte Marmortreppe hinunter zu meinen Großeltern väterlicherseits
bunte winzige alte Mosaik-Steinfliesen – der Hausflur
graue, große Pflastersteine – der Hof unseres Hauses
der eiskalte, immer leicht feuchte Lehmboden, den meine nackten Füße durch die dünnen Sandalen beim Kartoffelholen spüren – der Keller
die mit Blumen bewachsene Wiese – in unserem Garten23 und um das Dorf
die frisch asphaltierten Straßen – die Hauptstraßen
Lehm und Erde – der Feldweg zum Gemüsegarten meiner deutschen Oma
Das Küchenfenster, aus dem man als Kind blickt (Knut Elstermann) ist prägend für die Welterschließung, dasselbe gilt für die Landschaft der Kindheit – das Urbild (Goethe) für alle weiteren Bilder. Wie also sah sie aus, die soziale Wirklichkeit, die sich von meinem Küchenfenster aus zu einem Urbild fügte? Was war mein Schoß des Wirklichen?
Mein Elternhaus war das Elternhaus meines Vaters, ein Eckhaus mitten im Dorf. Gegenüber unserer Wohnung, die im ersten Stock lag, blickte ich auf einen Teil der alten Scheune, davor der Innenhof, eine etwa 50 Quadratmeter große asphaltierte Fläche. Dort spielte ich im Sandkasten, schaukelte und fuhr Dreirad. Ein schwarzes, filigranes schmiedeeisernes Tor trennte den Hof von der Straße, die den oberen Teil des Dorfes mit dem unteren verbindet. Den ganzen Tag über herrschte ein reges Kommen und Gehen, Menschen, Fahrräder, Autos, Traktoren, sogar amerikanische Panzer rollten ab und an noch, aus dem nahen Baumholder kommend, dort hindurch.
Die Wohnung reichte vom ersten Stock bis in das ausgebaute Dachgeschoss, war hell und GERÄUMIG, insgesamt fünf Zimmer, Küche und Bad. Zu meinem Kinderzimmer – 12 Quadratmeter groß, Blick auf den Kirchturm direkt gegenüber – führte eine alte, braune, glatt gewienerte Holztreppe mit ausgetretenen Stufen. Sie knarrte bei jedem Schritt und war ein magischer Spielort, wie ein lebendiges Wesen erschien sie mir.
Im Erdgeschoss lebten meine deutschen Großeltern. Neben den benutzten Räumen gab es unbenutzte oder umfunktionierte Areale, die mit Staub und Spinnweben an eine längst vergangene Zeit erinnerten:
der Hühnerstall; heute – überdachter Freisitz
das Backhaus; heute – Abstellraum
der Schweinestall; heute – Werkstatt
der Kuhstall; heute – Abstellraum
die Scheune – verbotenes Terrain, voll mit alten Möbeln, das Dach hatte Löcher
Das also war mein Ort, das Gehäuse meines Küchenfensters. Das Wohnzimmer prägte ein unaufgeregter, bilderloser Minimalismus: Perserteppiche, Parkettböden, Ledermöbel, Setzkästen, Zimmerpflanzen, 70er-Jahre-Tapeten.
Mindestens so entscheidend für ein Kleinkind wie das, was sich vor dem Fenster zuträgt, ist natürlich das familiäre Kammerspiel selbst.
| Foto Mutter Augen: groß, grün Haar: hellbraun, lockig Gesicht: rund, hohe Wangenknochen Besonderheiten: »übergewichtig« Typ: Schauspielerin Marianne Sägebrecht | Foto Vater Augen: schwarz Haar: blond, glatt, Seitenscheitel Gesicht: feminin Besonderheiten: Brille Typ/Familienähnlichkeit: Schauspieler Helmut Fischer/Monaco Franze |
Meine Mutter liebte:
blauen Lidschatten, die Sonne, Einkaufen, Kochen, Rote Bete, Lederhandtaschen, das Spiel, bei dem wir im Bett lagen und uns gegenseitig unsichtbare Buchstaben auf den Rücken schrieben, bunte Röcke mit kleinem Blumenmuster, frisches Brot, Cher, Liv Taylor, Muhammad Ali, ihren orangefarbenen VW-Käfer, hochhackige Schuhe, unsere Katze, ihre Schreibmaschine, Kleider mit Animal Print, Tom & Jerry, die Golden Girls
Meine Mutter liebte nicht:
Erbsen pulen, Lavendelduft, Auto waschen, Landfrauenvereine, die Lindenstraße, Dorftratsch, wenn man mit Essen »spielte«, altes Bratfett, McDonald’s, Schiffsfahrten, Zigaretten, Alkohol, zu starken Wind, Gartenarbeit, die Struwwelliese, den Zappelphilipp, Muttertag, das Wort FREMDENZIMMER24
Mein Vater liebte:
seine rote Vespa,Waldspaziergänge, REVAL-Zigaretten25, seine Stereoanlage, Dialekte nachmachen, Langlauf, Mozart, seine Arbeit, Schreinern, die Größe unserer Hände vergleichen, Monaco Franze, im Chor singen, Schottland, seine Werkstatt, die Beach Boys, Weihachten, auf hohe Berge wandern und die Aussicht vom Gipfel, seine Mundharmonika, bei Regen geschützt im Haus sein, Rehe, Wilhelm Busch, seine Wasserwaage, Glockengeläut
Mein Vater liebte nicht:
körperliche Arbeit bei heißem Wetter, unglaubwürdig konstruierte Kriminalfilme, Pauschalurlaube, Plastikspielzeug, Dreck im Haus, Kanzler Kohl, Weihnachtsmärkte, Werbung, wenn zu oft gebadet wurde (Wasserverschwendung), Kurzstreckenflüge (Umweltverschmutzung), dass Bäcker nicht mehr selbst Brot backen wollten, die Bundeswehr
Es gab zwei Konflikte, die zu Hause dauerhaft schwelten: das Übergewicht meiner Mutter und der Zwist zwischen den Großelternparteien. Ich habe als Kind viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht; als ich zwei Jahre alt wurde, ging meine Mutter wieder den halben Tag zur Arbeit, und so haben mich alle vier miterzogen.
| Steckbrief Klara & Alois Biela hohe Wangenknochen untersetzt und rundlich Pelzmäntel Parfum Hochdeutsch »schläs’scher« Zungenschlag | Steckbrief Berta & Willy Dröscher Schirmkappe & Pfeife sehr groß und schmal (Opa) klein und zierlich (Oma) hüftlanges schwarzes Haar, zu einem Dutt aufgesteckt breiter pfälzischer Dialekt |
Während die Großeltern väterlicherseits bei ihren Vornamen genannt wurden – »Berta Oma« und »Willy Opa« – hießen die mütterlicherseits nach ihrem Nachnamen: »Biela Oma« und »Biela Opa«.26 Mit »Biela Oma« ging ich Pilze sammeln und puzzelte viele Nachmittage lang, mit »Berta Oma« bepflanzte und bewässerte ich den Gemüsegarten, der in einer Reihe mit anderen Kleingärten lag, erntete Beeren, Kartoffeln und Bohnen und pulte dann später, im Hof sitzend, säckeweise Erbsen. Mit »Willy Opa« ging ich spazieren, er sang »Dschingderassa bumm«, las Geschichten vor und brachte mir die Namen aller Bäume und Wiesenblumen bei. Mit der spiegelblanken Glatze meines »Biela Opas« ist das Wort »unter Tage« verknüpft. Er hat sein halbes Leben im Erdinneren, ohne Tageslicht, verbracht.27
Der unausgesprochene Konflikt zwischen den beiden Parteien war natürlich der Krieg. Mein Opa Alois war in russischer Gefangenschaft gewesen und zeit seines Lebens ein erklärter Gegner Hitlers, mein Opa Willy war als unüberzeugtes, aber passives Parteimitglied und Versorger von der deutschen Armee nicht eingezogen worden. Der eine hatte gehungert und gelitten im Namen des Deutschen Volkes, das ihn nun aber im Alltag nicht als Deutschen anerkannte. Der andere hatte zu essen gehabt sowie dazu noch einen französischen Kriegsgefangenen: »Paul aus Paris«.
Für meine deutsche Oma Berta waren die Eltern meiner Mutter VON DRÜBEN. Sie warf sie in einen Topf mit den Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten – Schlesien, Vorpommern, Ostpreußen –, denen die Einheimischen im Dorf nach dem Krieg buchstäblich im eigenen Haus hatten Platz machen müssen. Alois und Berta aber waren erst 1958 nach Deutschland gekommen, als Aussiedler, nicht als Vertriebene.28 Mein Großvater legte viel Wert darauf, dass dieses »A« sogar in seinem deutschen Pass vermerkt war. Er hatte sich die Ausreise teuer erkauft, indem er über Jahre hinweg geduldig korrupte polnische Beamten bestochen hatte.29
Zum anderen war das, was zwischen ihnen stand, schlicht Neid. Meine Großeltern mütterlicherseits wohnten in einem neugebauten Haus mit einem Rosengarten, etwa 15 km von unserem Heimatdorf entfernt. Meine deutsche Großmutter neidete denen VON DRÜBEN diesen aus ihrer Sicht unverdienten Wohlstand. Mein Großvater Alois war schließlich »nur« Bergmann und konnte in ihren Augen sein Geld unmöglich durch EHRLICHE ARBEIT verdient haben. Ich vermute, dass es diese Rhetorik war, die später in meiner kindlichen Wahrnehmung den Sozialneid überlagerte.
Es wäre leicht, mit dem Finger auf meine deutsche Oma zu zeigen, sie als Quell aller späteren Schuld und Scham auszumachen. Ausgerechnet meine Mutter verteidigte die Frau, die sie und ihre Eltern gegängelt hatte, und begründete dies damit, dass eine Frau wie »Berta« nie eine Chance auf Bildung und Weltoffenheit gehabt hatte: Wir kommen in eine Welt, in der die Urteile längst gesprochen sind. (Eribon)
Ich glaube, dass beide Großeltern-Parteien unbewusst den Stachel eines Klassenkampfs in die Ehe meiner Eltern mit einbrachten. Beide vertraten die Ansicht, ihr Kind »unter ihrem Stand« verheiratet zu haben. Sowohl der Bauer als auch der Bergmann entstammen dem Zunftwesen. Es waren einst stolze Berufe, die auf eine lange Tradition zurückblickten. Für diese Gemeinsamkeit aber gab es kein Bewusstsein, und so verfeindeten sich die Deklassierten in meiner Familie untereinander.30
Die deutsche Bäuerin konkurrierte mit dem schlesiendeutschen Bergmann, von dessen Wohlstand sie sich erniedrigt fühlte. Alois und Klara wiederum verschreckte der kaum verhohlene Neid meiner Großmutter, den sie als unverständlich und kränkend empfanden, und so hielten sie ihrerseits Distanz.
Mein Opa Alois war ein schweigsamer Mensch. Er hatte viel erlebt und überlebt: Als Vollwaise war er bei seiner strengen alkoholkranken Stiefschwester aufgewachsen, er war in russischer Gefangenschaft gewesen und mit einem Wasserkopf von dort zurückgekehrt.31 Nach Kriegsende hatte er im kommunistischen Polen 16 Jahre lang die Diskriminierungen als Schlesiendeutscher ertragen. Er war mit nichts in der Hand nach Kirn gekommen, die Starthilfe im Lager Friedland betrug 200 DM. Keine zehn Jahre später baute er bereits an seinem Eigenheim. Jeden Montagmorgen fuhr er auf seiner NSU-Quickly, einem kleinen Moped, zur Grube in das 90 km entfernte Neunkirchen; und schlief die Woche über in einem Männerheim.32 Vor diesem Hintergrund empfand Alois seinen Wohlstand als alles andere als unverdient, und er verstand nicht, warum hier so auf ihn herabgeschaut wurde. Eine Zeit lang weigerte er sich, auch nur das Haus der Schwiegereltern zu betreten, was zu solch absurden Situationen führte, dass er mein Geburtstagsgeschenk vor dem gusseisernen schwarzen Tor ablegte, statt es mir zu überreichen.33 FALSCHEN STOLZ nannte mein Vater das.
In Regionen des Vorderen Orients nahm Widerstand im Altertum meist weniger die Form der Rebellion an als die der Flucht: Das Wegziehen mit den eigenen Herden und Familien. Der Exodus. Flight statt Fight. (Igor Djakonow)
All das verstärkte die Projektion noch. Sinnbild des ihnen unterstellten Snobismus waren die Pelzmäntel, die meine Oma Klara trug – für Berta die Provokation schlechthin. Dabei waren Pelzmäntel in Polen kein Statussymbol, beharrte meine Mutter.34 Angeblich trugen »alle« sie dort, die Winter waren kälter als hier. Berta aber fand diese Garderobe affektiert.
Verwirrend als Kind später: Waren Pelzmäntel jetzt NORMAL oder nicht …?