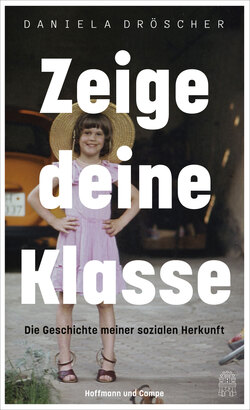Читать книгу Zeige deine Klasse - Daniela Dröscher - Страница 8
Das Küchenfenster meiner Mutter
ОглавлениеMeine Mutter war das Zentrum meiner Kindheit, meine Sonne, um die ich mich drehte.
Einer der berühmtesten Sätze des Entwicklungspsychologen Donald Winnicotts lautet: There ist no such thing as a baby (ein seltsames Echo zu Margaret Thatchers There ist no such thing as society): Ein Baby gibt es nicht. Der Satz soll klarmachen, dass ein Neugeborenes fundamental abhängig ist von seiner Mutter. Hinreichend gut ist eine Mutter dieser Theorie zufolge dann, wenn sie es schafft, ihrem Kind nicht dauerhaft das Gefühl von Verlassenheit zu geben.
Meine Mutter war eine solch hinreichend gute Mutter, gerade weil sie in vielerlei Hinsicht emanzipiert war und arbeiten ging, und das, obwohl ein doppeltes Bündel Tugenden auf ihr lastete.
| Mythos der deutschen Mutter symbiotisch heilig einzigartig unersetzlich fürsorglich eine reformierte Nonne | Matka Polka Mythos der polnischen Mutter unverwüstlich arbeitswütig bis zum Umfallen bis zur Selbstaufgabe opferbereit das Wohl der Familie steht über allem |
Für meine Erziehung war – unhinterfragt – sie ganz allein zuständig. Ich kann mir kaum vorstellen, wie anstrengend und zugleich geistig unterfordernd es für die Mütter ihrer Generation gewesen sein muss, über drei Jahre hinweg den ganzen Tag lang ein Kleinkind zu beaufsichtigen, diese unbezahlte, gesellschaftlich kaum beachtete Arbeit,35 ohne verlässliche Struktur, die sie entlastete.
In den Kindergarten kamen Kinder in der westdeutschen Provinz erst mit vier Jahren. Ich muss als Kleinkind das zeitweilige Befremden und die Einsamkeit gespürt haben, wenn meine Mutter durch dieses Küchenfenster sah, während sie am Herd stand und Essen kochte. Ich saß dabei oft neben ihr, auf der Ablage der Küchenzeile. Sie weinte beim Zwiebelschneiden ihre Tränen auf Augenhöhe mit mir. Sie gab sich Mühe, ihre Traurigkeit und Hilflosigkeit zu verbergen, doch mitunter drangen sie durch die dicken Wände ihrer Mutterliebe hindurch.
Als ein Arzt meiner Mutter eine versteckte Depression attestieren wollte, beharrte sie daraufhin, sie sei traurig. Und dazu habe sie wohl alles Recht. In dieser Welt dürfe man wohl hin und wieder traurig oder melancholisch sein.36
Meine Mutter hatte sich selbst immer sehnlichst Geschwister gewünscht und gehofft, in der großen Familie meines Vaters ein Zuhause zu finden. Neben den Schwiegereltern im Haus lebten die nächsten Verwandten meines Vaters im Dorf, Vettern, Cousinen, mit seiner Schwester und ihrer Familie hatte sie EIN GUTES VERHÄLTNIS.
Meine deutsche Oma aber begegnete ihr – ganz anders als mein Opa, mit dem meine Mutter sehr gut auskam – mit ähnlichen Ressentiments, die sie auch ihren Eltern gegenüber hegte. Ich erinnere mich, dass meine Mutter immer besonders akkurat Geschirr spülte, um Oma Bertas hinter vorgehaltener Hand gemurmelte Bezichtung zu entkräften, wonach man in Polen »polnisch spülte«, also dreckige Teller schnell mit kaltem Wasser abwusch. Sie litt unter diesen Bemerkungen, doch sie wehrte sich nicht, jedenfalls nicht entschieden, auch weil die Ressentiments subtil waren. Eltern und Schwiegereltern hatte man aus ihrer Sicht stets mit Respekt zu begegnen. Der rebellische Gestus von ’68 lag meinen Eltern fern.37
Wenn Zugehörigkeit bedeutet, sich in einem vertrauen Gefüge, in einem geschützten sozialen Raum eines nicht hinterfragten oder fraglichen »Wir« zu bewegen, dann ist dies etwas, was meine Mutter nie kennengelernt hat. Sie hatte »nie eine Heimat« gehabt, wie mein Vater manchmal konstatierte.
Wohnorte meiner Mutter
Miechowice, Polen
Lager Friedland
Kirn, Stettiner Straße
Kirn, Königsberger Straße
Hochstetten-Dhaun
unser Dorf, altes Haus
München, Im Wiesengrund
unser Dorf, altes Haus
unser Dorf, neues Haus
Heidelberg, Rosenweg
Heidelberg, Im Langgewann
Altwarp, Seestraße
Das Haus, in dem sie mit meinem Vater lebte, war nicht das Zuhause, das sie sich erhofft hatte,38 es war vergällt durch meine pelzmantellose deutsche Großmutter, die im Erdgeschoss ihrem losen Mundwerk freien Lauf ließ.
Und das Dorf? Meine Mutter war städtisch sozialisiert, die Gesetzmäßigkeiten des Dorflebens kannte sie nicht, es war ein ihr völlig neues Habitat (Bourdieu). Sie kam mit allen gut aus, sie besuchte Feste wie alle anderen, hatte aber keine Freundinnen im engeren Sinne. Sie war und blieb vor allem ihrem Selbstbild nach die VON AUSWÄRTS.
Im Grunde lebte meine Mutter in unserem Dorf das nach, was ihre Eltern ihr vorgelebt hatten: eine umsichtige, freundliche Distanz. Alois und Klara hatten kaum Kontakt zu anderen, nicht einmal in der unmittelbaren Nachbarschaft. Es waren stille, zufriedene – es waren unsichtbare Menschen. Assimilation ist kein Ankommen, es ist ein Versteckspiel. (Emilia Smechowski)
Meine Mutter agierte ähnlich. Sie achtete immer darauf, dass niemand Anstoß an ihr nahm, sie wollte sein »wie alle anderen« – also unsichtbar –, was ab einem bestimmten Zeitpunkt allein durch die Fülle ihres Körper schlecht möglich war. In unserem Dorf war das kein Problem. Sie war beliebt. Neugierige Blicke erntete sie eher in anonymeren Kontexten.
Mein Vater war Mitglied in vielen Vereinen, dem Fußballverein, Tennisverein, Gesangsverein, der Feuerwehr. Meine Mutter war nirgendwo Mitglied.
Verwirrend: Warum war sie einerseits so hellwach, wenn es darum ging, sich nicht über andere zu erheben, scheute andererseits aber vor echter Nähe mit den Dörflern zurück? Sie sagte, sie habe als berufstätige Mutter wenig Zeit. Vor allem aber mochte sie den Tratsch nicht, der dabei ausgetauscht wurde.
Symptomatisch für ihren Zwiespalt – »Wie sehr dazugehören?« »Wie sehr Distanz wahren?« – war die Sprache. Als Kind schlesiendeutscher Aussiedler war meine Mutter in der Kirner Schule, in die sie mit sieben Jahren kam, mit ihrem Hochdeutsch hörbar anders, doch sah sie keinen Anlass, Kirner Dialekt zu sprechen. Erst mit dem Umzug in unser Dorf versuchte sie das. Sie kann den dortigen Dialekt perfekt nachahmen – trotzdem klang es in meinen Kinderohren falsch.39
Erst als Erwachsene verstand ich, dass meine Mutter mit einem Sprachverbot aufgewachsen ist. Sie durfte als Kind in Polen kein Deutsch in der Öffentlichkeit sprechen; dann zischte meine Oma stets »pscht, pscht« – aus Angst, sie könnten als Deutsche erkannt werden.
Verwirrend: Mit mir sprach meine Mutter Hochdeutsch, draußen nur Hochdeutsch mit denen, die auch Hochdeutsch sprachen, und mit denen, die Dialekt sprachen, Dialekt. Warum sprach sie, die aus Polen kam, kein Polnisch, nicht einmal mit polnischem Akzent? Und warum war der Ort ihrer Herkunft unsichtbar für mich?40
Ich wusste, dass das Küchenfenster, aus dem mein Vater als Kind geschaut hatte, fast identisch war mit dem, aus dem ich jetzt blickte. Von dem Küchenfenster meiner Mutter wusste ich nichts, und weder sie noch meine Großeltern erzählten besonders viel von diesem rätselhaften und weit entfernten Polen.
Definition Heimat Mutter:
»Heimat sind die Menschen, die ich liebe.«
Definition Heimat Vater:
»Heimat ist dort, wo ich geboren wurde.«
Als meine Eltern für drei Jahre, von 1975 bis 1978, nach München gingen, ließ mein Vater die Wohnung, die sie in seinem Elternhaus im ersten Stock ausgebaut hatten, vollständig eingerichtet. Für ihn stand außer Frage, dass sie wieder zurückkehren würden.
Meine Mutter hat gern in München gelebt. Das Kollegium war vergleichsweise international, VON ÜBERALLHER – aus Hamburg, dem Iran, Korea. Unter ihnen hat sie sich wohlgefühlt. Mein Vater gewöhnte sich nie wirklich an die Großstadt. Auch heute reist er zwar gerne in Städte, im Lebensalltag aber wären sie ihm zu anonym. An München liebte er die nahen Berge und die Seen, die bayrischen Sitten und Gebräuche, ist dort aber immer ein Fremder geblieben.