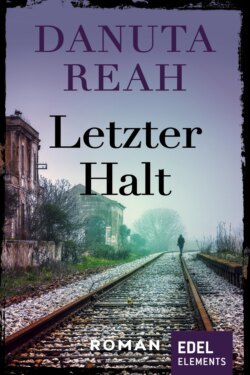Читать книгу Letzter Halt - Danuta Reah - Страница 8
Оглавление2
Das City College in Moreham heißt so, weil es in der Stadtmitte liegt, fünf Minuten zu Fuß von Bahnhof und Busbahnhof und nur einen Steinwurf von der schönen mittelalterlichen Kirche und der Kapelle auf der Brücke entfernt. Die College-Gebäude bieten einen Querschnitt durch die Architektur des zwanzigsten Jahrhunderts. Der Nordbau, mit seinen fast zwanzig Jahren der modernste, präsentiert der Welt eine Fassade aus Rauchglas. Sein Eingang ist schwer zu finden, und wer sich nicht auskennt, kann sich in einem undurchschaubaren Irrgarten von Gängen verlaufen. Der Moore-Bau, der mittlere im Bunde, ist eine Schachtel aus Glasfenstern und Beton, fast vierzig Jahre alt, schäbig und deprimierend. Drinnen ist es gemütlicher. Auf der anderen Straßenseite steht das älteste und trotz seines heruntergekommenen Aussehens schönste Gebäude, der Broome-Bau, ein elegantes Art-déco-Gebäude mit einer Eichentür in der geschwungenen Fassade. Seine Fenster beobachten einen wie Augen.
Debbie hatte verschlafen und war zwei Minuten vor Abfahrt des Zuges im Bahnhof angekommen. Normalerweise las sie unterwegs die Zeitung, doch da sie keine Zeit gehabt hatte, eine zu kaufen, sah sie stattdessen aus dem Fenster. Rechts und links der Gleise war alles mit Unkraut überwuchert, und die hohen Mauern waren voller Graffiti. Die meisten davon waren unverständlich und – für Nichteingeweihte – immer wieder dasselbe, Namenskürzel und gelegentlich ein Wort. Joke stand in gut einen halben Meter hohen Buchstaben auf einer über und über mit Sprühfarbe bedeckten Wand. In Debbies eigener Studienzeit waren die Graffiti noch politisch gewesen: regierungsfeindliche Sprüche, ANC-Slogans, Kommentare zum Golfkrieg, ja sogar noch ein paar Überbleibsel vom erbitterten Streik der Grubenarbeiter – Kohle ist Arbeit, Thatcher raus und Rettet unsere Zechen. Heute gab es offenbar nur noch Selbstinszenierungen, den bedeutungslosen Aufschrei Ich bin frei! oder das unvermeidliche Fuck you, Ausländer raus oder Scheiß-Iren.
Der Zug fuhr weiter durch das industriell geprägte East End von Sheffield, wo die Gerippe der großen Stahlwerke eins nach dem anderen verschwanden und die Straßen und Häuser einen verlassenen und verfallenen Eindruck machten. Die wie aus einer Spielzeugstadt wirkende Kuppel des Meadowhall-Einkaufszentrums stand zwischen ausgedehnten Parkplatzflächen, die schon jetzt voller Autos waren. Leute drängten aus dem Zug, andere stiegen ein. Alle wirkten beklommen und angespannt. Die Brücke, die die Kauflustigen über die Straße brachte, quoll fast über von Menschen. Zum Einkauf stand auf einem Schild. Joke… Der Zug fuhr wieder an, vorbei an mehreren baufälligen Häusern und an Grünflächen, wo der Kanal träge und schwarz dicht an den Gleisen verlief. Fisto war auf ein Steinhaus gesprüht worden, und noch einmal auf einen verfallenen Schuppen. Es sah geradezu dekorativ aus. Der Turm der Kirche von Moreham kam in Sicht, und Debbie nahm ihre Tasche, als der vertraute Bahnsteig an ihrem Fenster vorbeiglitt.
Am College herrschte bereits Hochbetrieb, als sie sich den Weg durch die Studentenmassen bahnte, die auf den Stufen vor dem Broome-Bau standen. Nach dem Sturm der vergangenen Nacht herrschte nun wieder klares Wetter, aber es war kalt. Die Stufen dienten als zwanglose Plauderecke, als Treffpunkt und – da im College striktes Rauchverbot herrschte – als Rauchsalon für Studenten und Dozenten. Es war kein besonders heimeliger Ort, da zwischen den Gebäuden eine viel befahrene Straße verlief, Gespräche vom Autolärm übertönt wurden und immer wieder Busse von der Haltestelle vor dem Haupteingang abfuhren. Dort roch es immer schmutzig, vor allem an kalten, windstillen Tagen.
Debbie nickte Trish Allen zu, einer Psychologie-Dozentin und überzeugten Raucherin, die ihren Unterricht in der Kaffeepause mit ein paar Studenten fortsetzte, indem sie sich allesamt zu einem geselligen, verrauchten Kreis zusammendrängten. Sie erkannte Sarah Peterson, eine schlaksige Studentin aus ihrem Oberkurs, die unsicher im Eingang stand und verlegen an einer Zigarette zog. Debbie begrüßte Sarah im Vorübergehen und erntete ein hastiges Lächeln mit abgewandtem Blick. Sie fühlte sich versucht, zurückzugehen und sich zu der Gruppe auf den Stufen zu gesellen, zehn Minuten damit zu verbringen, mit anderen Menschen zu sprechen – etwas, was sie seit halb zehn am Vorabend nicht mehr getan hatte, doch sie drängte sich durch die Doppeltür in den dunklen, hohen Flur dahinter.
Einer der ersten Menschen, die sie sah, als sie durch die Tür trat, war Rob Neave, der auf dem Weg nach draußen soeben die Treppe herunter und auf sie zukam. Er blieb stehen, als er sie sah. »Gestern Abend nass geworden?«, fragte er. Debbie nickte, und er lachte. Langsam wurde ihr heiterer zu Mute.
»Ich wollte dich noch etwas fragen«, sagte sie. »Ich hatte gestern Abend ein bisschen Ärger im Unterricht.«
»Okay. Ich muss jetzt zu einer Besprechung.« Er setzte eine viel sagende Miene auf. »Aber später habe ich Zeit. Ich komme in euer Dozentenzimmer – gegen halb fünf?« Er schenkte ihr ein Lächeln, das sie in erfreulich gute Laune versetzte, und sie ging auf ihr Dozentenzimmer zu. Mit Rob Neave zu plaudern war das Zuckerkörnchen im ansonsten vollwertigen Müsli von Debbies Arbeitsleben.
Die Lüge in Debbies Stundenplan bestand darin, dass Freitagmorgen ihr freier Vormittag war, als Ausgleich für ihren Abendkurs. Die Lüge in ihrem Vertrag war, dass sie eine Fünfunddreißig-Stunden-Woche hatte. Normalerweise saß sie am Freitagmorgen um zehn an ihrem Schreibtisch und arbeitete ihre Korrekturen sowie den endlosen Papierkram nach, der inzwischen zu ihrem Beruf gehörte.
Sie schloss den kleinen Raum auf, den sie sich mit Louise Hatfield teilte, der Leiterin der englischen Abteilung, die inzwischen nur noch aus ihr und Debbie sowie den wechselnden Gesichtern von Honorarkräften bestand, die über eine Agentur vermittelt wurden. Als Debbie im City College angefangen hatte, hatten zum Fachbereich Englisch fünf Festangestellte gehört, aber finanzielle Krisen und sinkende Studentenzahlen hatten zu einer Reihe von Frühpensionierungen geführt, und nun waren nur noch Louise und Debbie übrig. »So schwindet mein Reich dahin«, hatte Louise am Semesterende zu Debbie gesagt. »Auch unsere Tage sind gezählt. Du wirst schon sehen.«
Debbie hatte gehofft, dass Louise im Dozentenzimmer sein würde, aber die verschlossene Tür sagte ihr, dass sie noch unterrichtete – also gab es niemanden zum Plaudern. Sie begann den Stapel Post auf ihrem Schreibtisch durchzublättern. Sie war müde. Als sie ins Bett gegangen war, hatte sie nicht einschlafen können, sondern hatte bis nach drei Uhr wach gelegen und Radio gehört. Nun, wo sie an ihrem Schreibtisch saß, konnte sie sich nicht konzentrieren. Sie hätte gern mit jemandem über die seltsame Szene von gestern Abend am Bahnhof gesprochen und darüber gelacht, um das nachhaltige Gefühl des – was war es eigentlich? – Grauens? – abzuschütteln, das die schweigende Gestalt ausgelöst hatte.
Sei nicht albern. Es war nichts.
Sie seufzte und drehte den Stapel Post wieder um. Größtenteils handelte es sich dabei um Rundschreiben und Werbebriefe von Schulbuchverlagen und Firmen, die Lehrmittel vertrieben. Weg damit in den Abfall. Zwei Memos waren darunter – eins von der Collegeleitung, in dem es um eine Prüfung der Kursverzeichnisse ging, das andere von der Gewerkschaft zur ständig drohenden Gefahr der Kündigung.
Bekümmert fuhr sie sich durchs Haar. Sie fühlte sich verwundbar. Außerdem wusste sie nicht, wie sie zurechtkommen sollte, falls sie ihren Job verlor. Aber es hatte gar keinen Sinn, jetzt darüber nachzudenken. Sie musste andere Dinge angehen – zum Beispiel das Korrigieren. Sie zog ihre Arbeitsmappe zu sich heran und versuchte, eine Locke nach hinten zu klemmen, die sich aus den Kämmen befreit hatte. Die Berührung ließ die gesamte Frisur auf ihre Schultern herabfallen, und sie strich sich verärgert die Haare zurück und fasste sie hinten mit einem Gummi zusammen. Fünfzehn Aufsätze für den Oberkurs zu korrigieren und dazu noch dreißig für den mittleren Abschluss. Sie nahm den ersten zur Hand und fing an zu lesen.
Sie war noch nicht einmal halb durch den Stapel, als der Hunger sie um halb eins in die Cafeteria im Moore-Bau trieb.
Freitags herrschte dort normalerweise kein großer Andrang. Die meisten Studenten hatten am Freitagnachmittag keine Kurse, und von denen, die welche hatten, schwänzten viele. Debbie holte sich einen gemischten Salat von der Salatbar, rang mit ihrem Gewissen und nahm eine Portion Pommes frites. Dann sah sie sich nach einem Sitzplatz um.
»Hey, Debbie!« Tim Godber, Dozent für Kommunikationswissenschaften, verhinderter Journalist und verflossener Liebhaber von Debbie, winkte ihr zu.
»Hallo Tim.« Debbie war auf der Hut. Sie hatte sich einmal sehr zu ihm hingezogen gefühlt, aber nachdem sie nach einem Institutsfest miteinander ins Bett gefallen waren, hatte er sich zu einem kapriziösen Dompteur entwickelt, der versucht hatte, sie zu kontrollieren und zu manipulieren und unter Einsatz von Charme und Gleichgültigkeit durch verschiedene Reifen springen zu lassen, und mittlerweile war Debbie eher abgestoßen als interessiert. Vor kurzem waren sie am Wochenende zusammen etwas trinken gegangen und erneut in Debbies Bett gelandet, doch am nächsten Morgen hatte sie sich geschworen, dass es das letzte Mal gewesen war.
Er strich sich die Haare aus der Stirn und schob sein leeres Tablett beiseite, um ihr auf dem Tisch Platz zu machen. »Wie geht’s dir, Schätzchen?«
»Ich bin nicht dein Schätzchen.« Debbie hatte gelernt, resolut zu sein. »Und mir geht’s gut. Und dir, Liebster?«
»Ich bin nicht dein Liebster, und mir geht’s auch gut.« Tim hielt es nicht mehr für nötig, Debbie zu schmeicheln. Sie plauderten oberflächlich miteinander, während sie aßen, und tauschten Klatsch aus ihren jeweiligen Dozentenzimmern aus. Debbie wollte gerade eine Einladung auf einen Drink ablehnen, als von der Kaffeetheke am anderen Ende lautes Stimmengewirr ertönte, zuerst Schreie und dann das Geräusch von zersplitterndem Porzellan – zersplitterndem Glas –, was entweder auf groben Unfug oder einen Streit hinwies. Debbie stand vom Tisch auf, um zu sehen, was sich abspielte, obwohl sie nicht die leiseste Absicht hatte einzugreifen. Manche der jungen männlichen Studenten konnten ganz schön einschüchternd sein. Außerdem kümmerte sich offenbar sowieso schon jemand darum. Das Geschrei hatte aufgehört. Rob Neave sprach drüben, wo der Ärger ausgebrochen war, mit einer Gruppe Studenten.
Tim, der genauso wenig Lust wie Debbie hatte, in studentische Streitereien verwickelt zu werden, sah erleichtert drein, beobachtete die Situation aber weiter mit Interesse. »Machismo fascismo«, sagte er, »siegt doch regelmäßig.« Debbie sah ihn an. »Dein Freund, der Expolizist. Derjenige, der sich da drüben als Autorität aufspielt.«
Er wirkte tatsächlich ein bisschen autoritär, aber Debbie würde Tim in diesem Punkt garantiert nicht zustimmen. Sie mochte Rob Neave. »Ich glaube nicht, dass er sich als Autorität aufspielt. Warum sollte er? Er schlichtet doch nur ihren Streit. War er früher Polizist?« Debbie fand, das hätte sie wissen müssen.
Tim wusste alles. Zum einen war es seine journalistische Liebe zum Klatsch, zum anderen seine Verbindungen zur Lokalzeitung. »Das ist sein Job. Für Sicherheit sorgen, Vandalismus verhindern und die Kerle im Zaum halten. Erinnerst du dich noch an diese Geschichte mit dem Lift letztes Semester?«
Debbie schüttelte den Kopf. Nach und nach schilderte ihr Tim, wie gegen Ende des letzten Semesters zwei Studenten einen der Aufzüge im Moore-Bau derart zugerichtet hatten, dass er stecken blieb und sie selbst darin fest saßen. Als sie den Alarmknopf drückten und gerettet werden wollten, hatte Neave, der sich die Sache zusammenreimen konnte, die Rettung um zwei Stunden verzögert, indem er behauptete, sie könnten den Aufzug nicht frei bekommen. Die Hausmeister hatten draußen um den Lift herumgestanden und gedroht, ein Feuer im Schacht anzuzünden. Als die beiden endlich befreit wurden, waren sie ziemlich kleinlaut, und die Collegeleitung, die mit der Rechnung für die Aufzugreparatur konfrontiert war, war nicht dazu aufgelegt, sich ihre Klagen anzuhören. Debbie lachte, als Tim zum Ende der Geschichte kam. Er war ein guter Erzähler.
»Übrigens«, fuhr er fort, »der Eisenbahnwürger hat wieder zugeschlagen.«
»Was?« Debbie ließ ihre Gabel fallen.
»Hast du es denn nicht gehört? Es kam heute Morgen in sämtlichen Radiosendern. In der Zeitung steht es sicher auch. Sie haben letzte Nacht eine Tote an den Gleisen gefunden.«
Debbie wurde kalt. »Wo? Und wann letzte Nacht? Wer war es?«
»Auf der Strecke nach Mexborough, glaube ich. Sie haben keinen Namen genannt, und sie haben auch nicht gesagt, dass es wieder derselbe Täter war, aber er muss es gewesen sein.« Er nahm eines von Debbies Pommes frites und aß es. »Sonst wirst du dick.« Er aß noch eins.
»So bestimmt nicht. Hör mal, Tim, diese Frau wurde nicht zufällig am Bahnhof in Moreham ermordet, oder?«
»Weiß ich nicht, glaube ich auch nicht unbedingt.« Nun betrachtete er sie eindringlich. »Warum? Komm schon, sag’s mir.«
Ohne es zu wollen, erzählte ihm Debbie von ihrer Begegnung im Bahnhof am Vorabend und davon, wie die seltsame Gestalt auf sie gewirkt hatte. »Er sah irgendwie, na ja, gefährlich aus«, schloss sie lahm. »Es ist eigentlich nichts.«
»Nein, red weiter, es ist interessant.« Nun hatte sie seine volle Aufmerksamkeit, und er bestürmte sie mit Fragen, die sie nicht beantworten konnte. Hatte sie das Geräusch zersplitternden Glases wirklich vom Bahnhof her vernommen? Nicht aus einer anderen Richtung? Wie sah er aus? War sie sicher, dass er nicht in den Zug eingestiegen war?
»Womöglich hast du ihn gesehen – den Würger«, sagte er halb im Ernst.
»Unsinn! Wenn es drüben in Mexborough war, kann es nichts mit dem zu tun haben, was ich gesehen habe.« Debbie war ärgerlich, weil sie sich unbehaglich fühlte.
»Es ist der nächste Halt auf der Strecke.«
Sie dachte darüber nach, bis sie sah, wie spät es war. »O Gott, ich muss gehen. Ich habe in fünf Minuten Unterricht.«
Tim lächelte ihr aufmunternd zu, und als sie ging, zog er Notizbuch und Stift hervor. »Ich bleibe hier und arbeite ein bisschen. Hier ist es ruhiger als in unserem Dozentenzimmer. Bis später.«
Als sie die Cafeteria verließ, sah sie Rob Neave an der Wand lehnen und die Studenten mit auffallend düsterem Blick mustern. Er fing Debbies Blick auf und zwinkerte ihr zu. Als sie an ihm vorbeiging, sagte er: »Es wird wohl eher fünf als halb fünf. Ist das in Ordnung?«
»Ja, es dauert nicht lang. Es ist nicht weiter wichtig.«
Er sah skeptisch drein. »Als du letztes Mal nichts weiter Wichtiges hattest, hat das mein halbes Budget aufgefressen«, erwiderte er, eine Anspielung auf jene Zeiten, als Louise und Debbie sich die Tatsache zu Nutze machen wollten, dass das College wirklich jemanden eingestellt hatte, der für die Sicherheit verantwortlich war, und sich für bessere Beleuchtung in einigen der abgelegeneren Teile des Campus eingesetzt hatten. Sie waren davon ausgegangen, dass der neue Sicherheitsbeauftragte mit seinem jungenhaften Gesicht und dem lässigen Charme leicht zu überreden wäre. Er hatte sich als hartnäckiger Unterhändler erwiesen, hatte aber glücklicherweise auf ihrer Seite gestanden. Ihre Beleuchtung hatten sie bekommen.
Bei näherem Hinsehen fiel Debbie auf, dass er erschöpft und abgespannt aussah. Sie fragte sich, ob er ebenfalls eine schlaflose Nacht hinter sich hatte. Fast hätte sie ihm von ihrem Erlebnis auf dem Bahnhof erzählt. Sie sehnte sich nach dem Rat eines Experten.
Ihr Oberkurs am Freitagnachmittag lenkte sie ab, sodass sie zumindest für den Moment den Vorfall am Bahnhof vergaß. Die Studenten befassten sich mit der Ballade »Der alte Seefahrer«, die ihnen enorme Schwierigkeiten bereitete. Debbie hatte sie gebeten, über ein paar Zeilen nachzudenken: »Gott schütze dich, alter Seefahrer! / Was war es, was da dich verdross? / Was raubt dir das Heil?« – »Mit meinem Pfeil / Schoss ich den ALBATROS.« Warum, so hatte sie sie gefragt, erschoss der Seefahrer den Albatros, der dem Schiff Glück gebracht hatte? Irgendwie war die Diskussion zu einer Auseinandersetzung über die Rechte von Tieren ausgeartet, die zwar interessant war, aber nicht das, was Debbie von ihnen wollte.
»Auf jeden Fall ist es grausam«, sagte Sarah Peterson, die die Debatte aufmerksam verfolgt hatte. Debbie seufzte. Sarah leistete nur selten einen Beitrag, aber es war typisch, dass sie, wenn sie es tat, die Sache grundlegend falsch verstanden hatte. Sie sah, dass Leanne Ferris, einer der intelligenteren Teilnehmerinnen, eine scharfe Entgegnung auf der Zunge lag, und lotste die Gruppe wieder zu dem Gedicht zurück und begann sie auf eine weniger wörtliche Interpretation hinzuführen. Sarah schrieb sorgfältig alle ihre Ausführungen mit.
Sarah war dieses Jahr Debbies spezielles Sorgenkind, eine ganz andere Studentin als Leanne. Leanne mit ihrer raschen Auffassungsgabe und ihrem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten manövrierte sicher durch alles, was das Prüfungssystem ihr vorsetzte, solange Debbie sie dazu überreden konnte, ein bisschen zu arbeiten. Sarah arbeitete sehr angestrengt, begriff aber nichts. Sie hatte kein Zutrauen zu ihren eigenen Gedanken und Ansichten, daher wünschte sie sich jemanden – in diesem Fall Debbie –, der ihr sagte, was sie denken sollte. Sie wollte nicht wissen, warum die Antworten richtig waren, was sie bedeuteten oder was daraus folgte. Sie wollte nur die Antworten, wie ihre spürbare Verblüffung bewies, wenn keine geliefert wurden.
Nach dem Kurs wartete Sarah, bis die anderen gegangen waren, und fragte dann ziemlich zaghaft, ob Debbie Zeit hätte, ihren letzten Essay mit ihr zu besprechen. »Den, den ich über Othello geschrieben habe. Ich habe keine besonders gute Note bekommen.« Sie kramte in ihrer Tasche herum und zog den Essay, der reichlich zerknittert aussah, und eine Dose Cola heraus. »Ich muss gleich zur Arbeit«, sagte sie entschuldigend und wies auf die Dose. Wie viele Studenten am City College konnte sich Sarah den Collegebesuch nur leisten, indem sie arbeiten ging. Sie hatte einen Job in einem Pub am Ortsrand von Moreham.
Sie besprachen den Essay, beziehungsweise Debbie besprach ihn, während sich Sarah Notizen machte. »Versuchen Sie es noch einmal«, schlug Debbie vor. »Wenn Sie einen guten Aufsatz geschrieben haben, haben Sie ein Muster für die nächsten. Bringen Sie ihn mir am Montag, ja?«
»Danke, Debbie.« Sarah lächelte und blickte Debbie kurz an, bevor sie hinauseilte. Debbie sammelte ihre Sachen zusammen und ging zu ihrem Zimmer zurück.
Als sie dort ankam, lehnte Rob Neave am Fenstersims neben ihrem Schreibtisch und blätterte in einem ihrer Bücher – einem Gedichtband von Auden. Er zeigte sich meist an ihren Büchern interessiert, obwohl es ihr mitunter schwer fiel zu erkennen, ob er es ernst meinte. Seine Miene konnte undurchdringlich sein. Er sah auf, als sie hereinkam. »Deborah.« Er war einer der wenigen Menschen, die sie mit ihrem vollen Namen ansprachen. »Also, worum geht es bei diesem nicht weiter wichtigen Anliegen?«
»Möchtest du einen Kaffee? Offen gestanden habe ich noch was anderes auf dem Herzen.« Er lehnte den Kaffee ab, wie sie schon geahnt hatte. Er hatte bereits mehrmals spitze Kommentare über die Qualität des Kaffees abgegeben, den sie und Louise tranken. Er wartete, bis Debbie sich eine Tasse eingeschenkt hatte und blätterte weiter den Auden-Band durch.
Sie musste an das letzte Mal denken, als sie mit ihm über Lyrik gesprochen hatte. Er hatte eine Ausgabe von Das wüste Land zur Hand genommen, die auf Debbies Schreibtisch lag. Was hatte das, so wollte er wissen, mit dem Leben zu tun, das die meisten Studenten führten? »Eine Menge«, hatte Debbie erwidert. Und würde es sie bei dem weiterbringen, was sie im Leben wirklich brauchten – einen Weg, genügend Geld zu verdienen? »Sie lernen denken dabei.« Debbie zeigte sich grundsätzlich unnachgiebig, wenn es darum ging, was einem die Beschäftigung mit Literatur denn brachte. Er hatte noch eine Weile freundschaftlich mit ihr diskutiert, und am Ende hatte sie sich gefragt, ob er sie auf den Arm genommen hatte.
»Du kannst es dir ausleihen, wenn du willst.« Es überraschte sie, als er das Angebot annahm. »Ich dachte, du findest Gedichte überflüssig«, bemerkte sie.
»Das habe ich nicht gesagt.« Er blätterte immer noch weiter, las aber nicht wirklich.
Obwohl sie wusste, dass es ein bisschen plump klang, fragte Debbie: »Stimmt es, dass du früher bei der Polizei warst?«
Er sah sie an. »Wer hat dir das erzählt? Ja, zehn Jahre lang.« Ihre Frage schien ihm nichts auszumachen, aber irgendetwas hielt sie davon ab, weiterzufragen.
»Ich möchte dir etwas zeigen.« Sie nahm ihm das Buch aus der Hand und begann, nach einer Stelle zu suchen. »Hier. Das letzte Stück.« Sie sah auf die Zeilen gegen Ende von »Der Schild des Achilles«, die Stelle über den zerlumpten Wicht im unkrauterstickten Feld, über Mord und Vergewaltigung. Er las es durch und sah sie abwartend an. »Bist du diesem Knaben nicht hundertmal begegnet, als du bei der Polizei warst?«
Er las immer noch die Verse. »Ja, die trifft man andauernd.«
»Genau das habe ich gemeint. Lyrik hat eine Menge mit dem Leben zu tun.«
Er grinste, womit er sowohl ihren Einwand anerkannte als auch die Tatsache, dass sie nicht bereit war, die Debatte versanden zu lassen. »Okay, aber man kann auch romantisieren.«
»Ich glaube nicht, dass das romantisiert. Es bezeichnet Vergewaltigung und Mord als Gewissheiten.« Sie stand dicht bei ihm, als sie die Verse lasen, und sie nahm die Wärme wahr, die er ausstrahlte, den Duft des frisch gewaschenen Hemds und schwachen Schweißgeruch.
Er nickte, wechselte dann aber das Thema. »Gut. Also, wo liegt das Problem?« Er hörte zu, während Debbie ihm die Befürchtungen schilderte, die sie hatte, wenn sie abends in Raum B110 unterrichtete, wo die vorhanglosen Fenster hell erleuchtet auf die Straße hinausgingen und jedem Passanten einen ungehinderten Blick darauf erlaubten, wer im Raum war – und wer nicht. Sie erzählte ihm von dem Ärger, den sie am Vorabend mit ein paar Jugendlichen auf der Straße gehabt hatte. Er sah sie an. »Warum hast du das nicht gleich gemeldet?«, fragte er und schaltete unvermittelt von freundlich auf offiziell um. Sie hatte schon öfter mitbekommen, wie er dieses Mittel anwandte, um andere aus dem Konzept zu bringen, und jetzt verunsicherte es sie.
»Es war niemand da, dem ich es hätte melden können«, wandte sie ein, was selbst in ihren eigenen Ohren wie eine Rechtfertigung klang.
Er überlegte kurz und schien sich bewusst um eine entspanntere Haltung zu bemühen. »Ich weiß, dass abends in puncto Sicherheit immer noch Nachholbedarf besteht. Ihr Dozenten könntet wirklich Handys brauchen.« Er lächelte sie kurz an. »Aber dann wäre der Rest meines Budgets dahin.« Nachdem er sich ein paar Notizen gemacht hatte, fragte er: »Und was war das Zweite?«
»Ach, na ja…« Debbie war inzwischen etwas unsicher geworden. Sie wusste nicht, wie er es aufnehmen würde, doch er lehnte sich gegen die Wand und wartete. Also erzählte sie ihm von ihrer Begegnung am Bahnhof. Er lauschte wortlos. »Soll ich es der Polizei melden?«, fragte sie.
»Ja. Nächste Frage.«
»Glaubst du, dass es was mit dem Mord zu tun hatte?« Debbie versuchte, die Angst aus ihrer Stimme herauszuhalten, doch ein Hauch davon musste durchgedrungen sein, weil er die Augen zusammenkniff und eine ernste Miene aufsetzte.
»Ich habe keine Ahnung, Deborah. Du musst es der Polizei sagen und sehen, was sie dort damit anfangen können. Warum kommst du denn nicht mit dem Auto, wenn du Abendkurse hältst?«
»Weil ich keines habe. Ich kann nicht fahren.«
Er sah genervt drein, doch bevor er etwas einwenden konnte, tauchte Louise auf, und das Gespräch wandte sich allgemeinen Collegethemen zu. Nach ein paar Minuten ging er und versprach, sich in Sachen Raum B110 wieder bei Debbie zu melden.
Louise packte einen Stapel zu korrigierender Arbeiten in ihre Aktentasche. »Eine kleine Freizeitbeschäftigung«, witzelte sie, als sie Debbies Blick sah. »Hast du am Wochenende irgendwas Interessantes vor?«
Debbie war missgelaunt. »Ich hasse Wochenenden. Ich gehe überhaupt nirgends hin. Ich habe niemanden, mit dem ich weggehen könnte, und selbst wenn, hätte ich so viel Arbeit, dass ich trotzdem nicht könnte.«
»Hast du Lust, heute Abend mit mir etwas zu trinken?« Als Debbie Louises Einladung annahm, dachte sie, dass die Ältere gesehen haben musste, wie niedergeschlagen sie wirkte. Debbie, die jüngste Dozentin im Fachbereich Englisch und Geisteswissenschaften, war normalerweise als die fröhlichste bekannt, da sie, wie Louise immer sagte, wesentlich mehr Energie besaß als die anderen »und Aussichten auf eine Zukunft, die dich aus diesem Saftladen rausbringt«. Sie verabredeten, sich später bei Louise zu Hause zu treffen. Louise ging nicht gern in Pubs, und Debbie stand der Sinn nach einem ruhigen Abend.
Rob Neave war zu Hause in seiner Wohnung, hörte Musik und ließ die Gedanken schweifen. Vielleicht wurde es langsam besser. Zumindest schien es nicht schlimmer zu werden. Die Wohnung war winzig, im Grunde nur ein Zimmerchen, wurde aber Wohnung genannt, weil sie in sich abgeschlossen war. Er verfügte über eine kleine Küche und ein Badezimmer, und das reichte ihm fürs Erste. Er hatte das erste Angebot angenommen, das er für das Haus bekam, in dem er mit Angie gelebt hatte, das erste Angebot, das die Hypothek abdeckte. Das Einzige, was er aus dem Haus mitgenommen hatte, waren seine Stereoanlage und ein paar Bilder. Alles, was er sonst brauchte, hatte er neu gekauft – Bett, Stuhl, Teppiche, Vorhänge, Herd. Das war alles, was er zu Stande gebracht hatte: eine neue Behausung und einen neuen Job zu finden.
Der Abend dehnte sich vor ihm aus, öde und leer. Er könnte ausgehen – aber wohin und warum? Er konnte auch zu Hause bleiben, lesen und Musik hören, wie er es unzählige Abende davor getan hatte. Er überlegte, ob er Lynne anrufen und bei ihr vorbeischauen sollte, ein bisschen über die Polizeiarbeit fachsimpeln, den neuesten Klatsch aufschnappen und ein paar Stunden in ihrem Bett verbringen. Es wäre eine Abwechslung, eine Beschäftigung. Obwohl sie wahrscheinlich schon etwas anderes vorhatte, wenn er sich so spontan meldete.
Vielleicht war es an der Zeit, woanders hinzuziehen. Solange er hier blieb, rief alles Erinnerungen hervor. Orte, die er aufsuchte, Leute, die er sah. Beim Heimkommen hatte ein Brief seines Exkollegen Pete Morton dagelegen. Morton hatte einen Sicherheitsdienst aufgemacht, droben in Newcastle, wo Neave seine Kindheit verbracht hatte. Er hatte geschrieben, um Neave zu fragen, ob er daran interessiert wäre, bei ihm einzusteigen. Es gibt massenhaft Arbeit hier, hatte Morton geschrieben. Ich fange schon an, Aufträge abzulehnen. Neave dachte ernsthaft über das Angebot nach und darüber, wieder nach Newcastle zu ziehen. Er musste verschwinden.
Die Bewerbung auf die Stelle am City College war Teil des Verschwindens gewesen. Dort kannte er niemanden, und niemand kannte ihn. Außerdem hatte der Job einen interessanten Eindruck gemacht. Das College stand sperrangelweit offen, Gegenstände wanderten einfach zur Haustür hinaus, die Gebäude wurden mutwillig beschädigt und Kollegium sowie anständige Studenten fühlten sich allmählich eingeschüchtert. Es war eine Herausforderung gewesen, die ihm gefallen hatte: der anarchischen Welt der Weiterbildung junger Erwachsener eine Ordnung aufzuzwingen. Es hatte ihm etwas zum Nachdenken gegeben, aber nun hatte er dort sein Möglichstes getan.
Er wusste, dass er nicht übermäßig beliebt war, aber das machte ihm nichts aus. Er besaß die Fähigkeit, gut mit Leuten auszukommen und Vertrauen zu wecken – das war bei seiner letzten Stelle von Vorteil gewesen, aber jetzt brauchte er es nicht mehr. Sein Gesicht wirkte in entspanntem Zustand jungenhaft und gutmütig, und seine Augen machten trotz – oder vielleicht gerade wegen – der Fältchen unter ihnen, die sich mittlerweile wohl fest eingegraben hatten, den Eindruck, als ob er viel lächelte. Wenn seine Mitmenschen herausfanden, dass er nicht der unbeschwerte Typ war, für den sie ihn hielten, nahmen sie ihm das übel. Aber er setzte sich durch.
Er dachte über sein Gespräch mit Deborah Sykes an diesem Nachmittag nach. Ihm fiel seine erste Begegnung mit ihr ein. Sie hatte sich den Kopf an der Backsteinwand der Collegeleitung eingerannt, als sie versuchte, ihren vollkommen berechtigten Wunsch nach anständiger Beleuchtung durchzusetzen. Die Reaktion hatte darin bestanden, ihr prinzipiell zuzustimmen, Taten aber erst dann folgen zu lassen, wenn es das Budget gestattete – also in ferner Zukunft. Er hatte sich in diesem Fall auf ihre Seite geschlagen und ihr bei der Durchsetzung geholfen. Sie und dann auch Louise, ihre scharfzüngige Vorgesetzte, waren im College seine ersten Anhängerinnen gewesen. Er war gern mit den beiden zusammen und hatte sich angewöhnt, in ihrem Zimmer vorbeizuschauen, um mit ihnen zu plaudern.
Er hatte Debbies missionarischen Eifer entflammt, als sie eine Debatte über Bücher und den Wert von Gedichten geführt hatten, und sie hatte begonnen, ihm Texte auszuleihen, von denen sie wollte, dass er sie las. Typisch Lehrerin. Er schmunzelte. Er mochte Debbie und war erleichtert gewesen, als er sie heute Morgen zur Collegetür hatte hereinkommen sehen. Seine Gedanken schweiften ab. Er sah sie jetzt vor sich, nicht besonders groß – ihr Kopf hatte gerade bis an seine Schulter gereicht, als sie an diesem Nachmittag neben ihm gestanden hatte. Sie hatte ihr dunkles Haar streng zurückgekämmt und hinten mit Nadeln und Kämmen zu einem Knoten zusammengefasst, und es duftete sauber und frisch. Er versuchte sich vorzustellen, wie es sich um ihr blasses, hübsches Gesicht ringelte und über ihre kleinen, hohen Brüste … Er schüttelte sich wach, schlug sich diese Gedanken aus dem Kopf – das hat dir gerade noch gefehlt – und nahm das Buch zur Hand, das sie ihm geliehen hatte. Er blätterte die Seiten um, zurück zu dem Gedicht, auf das sie ihn aufmerksam gemacht hatte.
Sie hatte Recht, er hatte sie gekannt, die Kinder mit den leeren Augen, die anscheinend nicht wussten – oder sich nicht darum scherten –,was ihr Leben für sie selbst oder andere bedeutete oder warum es überhaupt etwas bedeutete. Vielleicht gehörte er ja auch zu ihnen.
Er las noch ein paar andere Gedichte und entdeckte weitere Worte, die ihn ansprachen. Er fand sogar das Gedicht»Haltet alle Uhren an« aus dem letzten Film, den er mit Angie gesehen hatte. Das konnte er nicht lesen. Es hatte Angie zum Weinen gebracht, und jetzt würde es ihn zum Weinen bringen, wenn er weinen könnte, wenn er weinen wollte.
»Es ist so«, begann Debbie und schenkte sich noch ein Glas Wein ein. »Entschuldige, wolltest du auch etwas? Es ist so, dass ich gern allein bin und auch wieder nicht – falls du verstehst, was ich meine. Wenn alles glatt läuft, ist es herrlich, aber wenn einem etwas im Kopf herumgeht, hat man niemanden, mit dem man reden kann.« Sie stand auf, wobei sie den Wein spürte, den sie intus hatte, und holte die nächste Flasche aus der Tasche. »Ich habe roten gekauft. Ist dir das recht?« Sie war gegen halb neun gekommen, und sie hatten die erste Stunde damit verbracht, über die Arbeit und die Studenten zu plaudern und ein bisschen zu schnell zu trinken.
»Ja, bestens. Also, was dieses Darüber-Reden angeht, da weiß ich ja nicht.« Louise war seit zwölf Jahren verheiratet, und manchmal beneidete sie Debbie um ihre Freiheit. »Dan unterhält sich inzwischen nur noch mit dem Fernseher. Was hast du denn für Probleme? Willst du darüber reden?«
»Ach, es ist schwierig. Zum Teil hängt es mit Tim zusammen, glaube ich.«
»Tim Godber? Der war schon immer ein Problem. Am liebsten wäre mir, er würde verschwinden, ein richtiger Journalist werden und aufhören, meine Zeit zu verplempern.« Louise musste Lehr- und Stundenpläne entwerfen und war der Meinung, dass Tim seinen Lehrauftrag nicht ernst nahm. »Was hast du denn für Probleme mit Tim?«
»Na ja, wir hatten eine Art Affäre, aber ich wünschte, wir hätten es gelassen. Er hat irgendwie etwas Unheimliches.«
»Belästigt er dich?« Louises Stimme war schneidend geworden.
»Nein, nein gar nicht. Es wäre mir nur lieber, ach, ich weiß nicht, wenn ich die Finger von ihm gelassen hätte…«
»Hat es dir denn überhaupt Spaß gemacht mit ihm?« Louise schenkte sich Wein nach und sah Debbie mit hochgezogenen Brauen an.
»Ja, schon.«
»Na dann.« Für Louise war das Problem damit erledigt. »War das alles? Was dich bedrückt, meine ich? Du warst den ganzen Tag so still.«
»Louise?«
»Ich bin hier, ich höre.«
»Du kennst doch Rob Neave?«
»Den Sicherheitsbeauftragten? Klar. Was ist mit ihm? Du bist doch nicht etwa dem Rob-Neave-Fanclub beigetreten, oder?«
»Gibt es da einen?«
»Oh, ich glaube schon. Ich würde ihn auch nicht von der Bettkante stoßen. Na gut, ich würde auch Tim Godber nicht aus dem Bett werfen, wenn das alles wäre, was ich mit ihm zu schaffen hätte.«
»Jemand hat mir erzählt, dass er früher bei der Polizei war.« Debbie war schon länger neugierig wegen Rob gewesen, doch nun hatte sie zum ersten Mal Gelegenheit, Fragen zu stellen.
»Neave? Das stimmt. Ich weiß aber nicht viel darüber.«
»Warum hat er dort aufgehört, weißt du das?«
»Nein, ich glaube, wegen irgendeiner privaten Krise. Vielleicht hatte es was mit seiner Ehe zu tun. Mehr weiß ich nicht, obwohl irgendjemand behauptet hat, er hätte viel getrunken, bevor er zum City College kam.« Louise sah Debbie forschend an. »Sei vorsichtig«, sagte sie.
Debbie wollte das Thema damit beenden. Sie hatte nicht gewusst, dass Rob verheiratet war. Wenn er es noch war. Hastig und vom Wein ziemlich beschwipst, begann sie Louise von dem Mann am Bahnhof zu erzählen. Louise hörte schweigend zu, bis Debbie fertig erzählt hatte. »Und er, also Rob Neave, meinte, ich soll zur Polizei gehen. Ich weiß zwar nicht, wie das mit dem Mord zusammenhängen soll, aber…«
Louise war in ihre professionelle Arbeitshaltung geschlüpft. »Warte bis morgen, dann siehst du, was in der Zeitung steht. Falls es einer dieser Morde ist, dann geh und sag es ihnen. Falls nicht, brauchst du dir nicht weiter den Kopf zu zerbrechen. Und ich würde es niemandem sonst erzählen. Du willst doch nicht, dass es sich im ganzen College rumspricht.«
»Ich habe es Tim schon erzählt.«
Louise zog die Augenbrauen hoch. »Dumme Idee« war alles, was sie sagte.
Sie hatten keine Zeit verloren, seit sie die Leiche entdeckt hatten. Die Männer, die den Bahndamm an der Strecke absuchten, hatten eine Handtasche gefunden, die ins Gras geworfen worden war. Eine Geldbörse befand sich noch drin, unberührt mit dreißig Pfund, einer Geldkarte, einer Kreditkarte von einer Ladenkette, mehreren Kassenzetteln und anderen Papieren, die daraufhin untersucht wurden, ob sie irgendwelche Hinweise gaben, was die Frau in den Wochen und Tagen vor ihrem Tod getan hatte. Es schien festzustehen, dass die Sachen der Toten gehörten, da eine nagelneue Dauerkarte der Bahn mit Foto dabei war, und obwohl ihr Gesicht brutal verändert worden war, sah es ihr sehr ähnlich – die gleiche blonde Haarmähne, die gleichen zarten Gesichtszüge. Mick Berryman, der Fahndungsleiter, hatte das Foto einen Moment lang angesehen und gefragt: »Ist schon jemand bei dieser Adresse vorbeigefahren?«
Nun schaute er auf die Fotos vom Tatort herab, auf denen ihm Julie Fyfes blickloses Gesicht vom Rand des Gleises entgegenstarrte, halb maskiert von dem Klebeband über ihrem Mund, der dünne Draht in der Wunde an ihrem Hals eingebettet. Er sah auf den ersten Bericht des Pathologen herab: … Hände mit Klebeband um die Gelenke gefesselt… Schnittwunden an den Händen… zahlreiche Verletzungen, Blutergüsse und Abschürfungen am Körper… Verletzungen an beiden Augen … Er war nicht bereit, jetzt schon genauere Angaben zu machen. War sie vergewaltigt worden? Verletzungen im Genitalbereich lassen dies denkbar erscheinen, aber vor der Obduktion lässt es sich nicht sicher sagen. Waren die Verletzungen vor oder nach ihrem Tod entstanden? Ohne weitere Untersuchungen unmöglich festzustellen. Was für ein Wahnsinniger warf verstümmelte, tote Frauen neben Gleisanlagen? Wohl eher Ihr Gebiet als meines.
»Okay.« Berryman sah das Team an, das an den Morden des Würgers arbeitete. »Wir haben zwar noch keine offizielle Bestätigung, aber wir wissen alle, dass wir es hier mit seinem nächsten Opfer zu tun haben.« Er pinnte das Foto ans Brett und ging die bekannten Fakten über den Mord mit ihnen durch. »Junge Frau Mitte Zwanzig, die genau hier« – er zeigte auf die Karte – »außerhalb von Rawmarsh, in der Nähe der Abzweigstelle, gefunden wurde. Verletzungen an den Augen. Mund und Handgelenke mit Isolierband verklebt. Wunde am Hals, allgemeine Verletzungen, vermutlich sexuelle Gewalt. Was noch?« Berryman sah, wie Detective Sergeant Lynne Jordan, die seit dem ersten Mord dem Team angehörte, in ihrem Notizbuch zurückblätterte.
»Die erste Woche des Monats«, sagte sie, indem sie eine Seite überblätterte. »Das ist neu. Die anderen waren alle in der letzten Woche. Schlechte Sicht – es geht auf Neumond zu. Eine regnerische Nacht – als Kate und Mandy verschwanden, herrschte schönes Wetter.«
»Irgendwelche Einfälle dazu, Lynne? Sonst jemand?«
»Der Regen – wenn es dermaßen gießt wie letzte Nacht, dann macht uns das die Arbeit noch schwerer«, erklärte Lynne. »Zahlreiche Beweise könnten einfach weggespült worden sein. Andererseits erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass er Spuren hinterlassen hat. Fußspuren oder Reifenabdrücke.«
Berryman nickte. Das Problem war, dass ihnen der Killer bislang nichts dergleichen hinterlassen hatte, außer den Fingerabdrücken einer Hand auf der Handtasche des ersten Opfers.
»Woher konnte er das wissen? Falls er vorausplant?« Das war Steve McCarthy, ein anderer Detective Sergeant, der genau wie Lynne Jordan von Anfang an zum Team gehörte. Er sah Jordan jetzt mit einer gewissen Feindseligkeit an. »Was ist mit den Glassplittern?«
»Die Lampe über dem Mast wurde zerbrochen. Wann, wissen wir noch nicht. Sie suchen die Leiche nach Splittern ab.«
»Der Zeitplan.« Lynne meldete sich wieder zu Wort. »Wir dachten, die Abstände könnten kürzer werden. Zuerst waren es sieben Monate, dann sechs, aber jetzt sind es fast acht Monate.« Sie zuckte die Achseln. Sie wusste nicht, was sie mit diesen Daten anfangen sollte. Sie wollten ein Muster, keine reine Willkür.
»Zeigen Sie es uns auf dem Kalender, Lynne.« Berryman gab viel auf visuelle Präsentationen von Information.
Lynne ging zu dem Kalender hinüber, der neben dem Anschlagbrett an der Wand hing. »Der erste Mord war Ende März. Das Opfer war Lisa. Sieben Monate später Kate. In der letzten Oktoberwoche. Sechs Monate danach wird Mandy ermordet, in der letzten Aprilwoche. Das sieht zu sehr nach einem Muster aus, als dass man es ignorieren könnte. Wir hatten das nächste Opfer Ende September erwartet, aber nichts geschah. Bis jetzt. Und jetzt haben wir eine Tote in der ersten Dezemberwoche. Warum ist er umgeschwenkt?« Im Raum ertönte Scharren und interessiertes Gemurmel.
»Oder war das nur Zufall?« Wieder Steve McCarthy. Berryman verzog die Miene. Steve und Lynne neigten dazu, einander zu widersprechen. Anfangs hatte er sich glücklich geschätzt, sie beide in seinem Team zu haben, weil sie gute, erfahrene Fahnder waren. Als der Killer wieder und wieder zuschlug, hatte er sie dicht am Geschehen arbeiten lassen, während er das vielköpfige Team dirigierte, das nun die Ermittlungen durchführte. Doch langsam begann er sich zu fragen, ob das so klug gewesen war. Offenbar konnten sie nicht zusammenarbeiten. Er ging zum nächsten Punkt über.
»Wie hat er sie nach Rawmarsh geschafft?« Berryman tippte mit seinem Zeigestab auf die Landkarte. »Wenn er sie in ein Auto gezerrt hat, warum hat er sie dann dort liegen lassen? Da, wo er sie abgeladen hat, verläuft weit und breit keine Straße. Falls er sie am Bahnhof geschnappt hat, wie hat er sie dann die Strecke hinaufgeschafft?«
»Sie im Zug mitgenommen?«, schlug Dave West scherzhaft vor. Im Raum ertönte Gelächter und lockerte die Atmosphäre auf. West, ein junger Detective Constable aus Lynne Jordans Team, besaß für einen solchen Fall noch relativ wenig Berufserfahrung. Manche Detectives bekamen es nie mit einem Serienmörder zu tun oder mit dem Grauen, das ein sadistischer Sexualmörder auslöste.
Berryman behandelte es als brauchbaren Hinweis. Wenn auch nur die Möglichkeit bestand … »Erklären Sie mir, wie er eine Leiche in den Zug kriegt, ohne dass es jemand merkt, und wie er den Zug dazu bringt, ihn mit ihr mitten auf der Strecke aussteigen zu lassen, dann denke ich ernsthaft darüber nach.« Er wartete ab, ob noch jemand anders an dieser Stelle etwas zu sagen hatte.
»Ein plötzlicher Halt – mit Hilfe der Notbremse?« McCarthys Miene zeigte, dass er die Schwächen dieser Theorie kannte, aber er äußerte sie trotzdem. Berryman schüttelte den Kopf. Daran hatten sie schon gedacht. Kein Zug auf dieser Strecke hatte an jenem Abend außerplanmäßig angehalten.
»Es ist das gleiche…«
»Kate Claremont…«
McCarthy und Jordan hatten gleichzeitig zu sprechen begonnen. Berryman sah Lynne an. Sie sagte: »Es ist das gleiche Problem, das wir bei Kate hatten. Es gibt zwar einen Trampelpfad, aber ich hätte keine Lust, jemanden – ob tot oder lebendig – den ganzen Weg zu tragen. Wie hat er sie also dorthin gebracht?« Sie formulierte lediglich eine Frage, die sie bereits diskutiert hatten. Niemand wusste etwas hinzuzufügen.
Berryman fühlte sich erschöpft beim Gedanken an die Arbeit, die vor ihm lag. Sie hatten es alles schon durchexerziert, die Befragungen von Haus zu Haus, die Suche nach den Personen, die das Opfer zuletzt gesehen hatten, die Gespräche mit den Angehörigen. Bislang hatte es zu nichts geführt. Okay, sie mussten sich ihre Identität bestätigen lassen, und sie mussten ihre nächsten Angehörigen finden – wer vermisste sie mittlerweile? Sie mussten in Erfahrung bringen, wo sie an dem Abend, als sie ums Leben kam, hinwollte und wem sie Tage, Wochen, ja sogar Monate vor ihrem Tod begegnet war. Sie mussten in Erfahrung bringen, ob sie nur ein zufälliges Opfer war, das sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten hatte, oder ob sie sorgfältig ausgewählt worden war, vom Mörder ausgesucht, weil ihn irgendetwas an ihr angezogen hatte. Das mussten sie über sämtliche Opfer herausfinden, und dabei besaßen sie nur so wenig konkrete Anhaltspunkte. Vier Frauen: Lisa, Kate, Mandy – und nun Julie? Ihm schien, als könnte es gar nicht anders sein, und er hatte das Gefühl, als hätte er sie im Stich gelassen, jede noch mehr als ihre Vorgängerin. Und die Nächste und die Nächste?