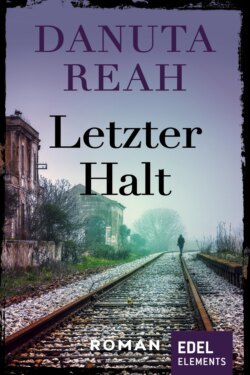Читать книгу Letzter Halt - Danuta Reah - Страница 9
Оглавление3
Die Morgenzeitung vom Samstag bestätigte Debbie, dass die Tote tatsächlich ein Opfer des Eisenbahnwürgers war. Debbie betrachtete das Foto der Frau und las dann den Artikel. Die Polizei gab die üblichen Ratschläge an Frauen aus, vorsichtig zu sein, bei Dunkelheit nicht allein aus dem Haus zu gehen und so weiter. Sie las den Artikel noch einmal durch und versuchte etwas zu finden, was den Mord mit dem Bahnhof in Verbindung brachte, doch wie Tim bereits gesagt hatte, war die Leiche mehrere Meilen die Bahnstrecke hinauf gefunden worden, bei Rawmarsh. Sie sah erneut auf das Foto von Julie Fyfe herab, die vierundzwanzig war – jünger als Debbie – und tot. Auf dem Bild lachte sie jemandem zu, der außer Reichweite der Kamera zu ihrer Linken stand, und ihr helles Haar bauschte sich ziemlich glamourös um das Gesicht mit den feinen Zügen. Debbie sah es sich lange Zeit an, dann nahm sie ein paar Zettel, die neben ihrem Telefon lagen, und arrangierte sie um das Gesicht auf dem Foto, um es sich mit einer elegant zurückgekämmten Bürofrisur vorzustellen. Ihr wurde wieder ganz kalt, da das Gesicht, das ihr nun entgegenblickte, das Gesicht der Frau hätte sein können – nein, ganz bestimmt das Gesicht der Frau war, die sie an so vielen Donnerstagabenden gesehen hatte, der Frau, die auf dem Bahnsteig gegenüber auf den Zug nach Doncaster wartete.
Bedeckt ihr Gesicht: meine Augen sind geblendet: sie starb jung.
In der Zeitung stand eine Telefonnummer, und nach mehreren Versuchen kam sie durch. Der Beamte, mit dem sie sprach, schien das, was sie zu sagen hatte, ganz gelassen aufzunehmen, was sie beruhigte, bat sie aber, aufs Revier zu kommen, um eine detaillierte Aussage zu machen. Er wollte, dass sie so bald wie möglich käme, was das kalte Gefühl in ihr wieder verstärkte. »Schaffen Sie es heute noch?«, hatte er gefragt. Debbie beschloss, noch am selben Vormittag hinzugehen. Sie wollte das ganze Erlebnis austreiben wie einen bösen Geist und sich von der Gleichgültigkeit der Polizei beruhigen lassen, weil sie nichts gesehen hatte und nichts wusste. Sie wollte nicht an die Folgen der anderen Möglichkeit denken, aber sie konnte es nicht lassen. Falls es wirklich… er gewesen war, war dann sie, Debbie, nur um Minuten davor verschont geblieben, tot neben den Gleisen zu liegen? Hatte das Gespräch mit Les Walker und Rob Neave ihr das Leben gerettet? Und Julie Fyfe ihres gekostet?
Der Mann, der ihre Aussage aufnahm, war freundlich, höflich und nicht so beruhigend, wie sie gehofft hatte. Er stellte ihr eine Menge Fragen, darunter einige über das Aussehen des Mannes, obwohl ihm Debbie nur sehr wenig sagen konnte, und manche Fragen waren die gleichen, die ihr Tim bereits gestellt hatte. Immer wieder kam er auf die zerbrochene Lampe zurück. »Ich weiß es einfach nicht«, sagte Debbie schließlich. »Damals hatte ich den Eindruck, es käme vom Bahnhof her, aber ich habe nicht richtig darüber nachgedacht, bis ich die Splitter sah. Ich habe es wohl nur vermutet.«
»Schon in Ordnung, Miss Sykes. Und jetzt bitte noch einmal – Sie glauben also nicht, dass der Mann in Ihren Zug eingestiegen ist?«
»Ich bin mir sicher, dass er nicht mitgefahren ist.«
»Okay, und Sie sind sich auch sicher, dass Sie ihn nie zuvor gesehen haben?«
»Da bin ich mir nicht sicher. Ich konnte ihn nicht gut genug sehen, aber nach dem, was ich von ihm wahrnehmen konnte, habe ich ihn nicht erkannt. Ich glaube nicht, dass ich ihn schon einmal gesehen habe.«
»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mit unserem Zeichner sprechen würden. Vielleicht können Sie ja doch ein Bild dieses Mannes zusammenbauen.« Er fegte ihre Einwände beiseite. »Nur einen allgemeinen Eindruck, wenn Sie nicht mehr beisteuern können.« Er stellte ihr noch ein paar Fragen nach der Frau auf dem Bahnsteig gegenüber, ohne zu bestätigen oder abzustreiten, dass sie das Mordopfer war, und einige Fragen über ihren Zeitplan am Donnerstagabend. Er bedankte sich für ihr Kommen, aber Debbie war immer noch beunruhigt. »Glauben Sie, dass er es war?« Sie wünschte sich, dass er ihr sagte, es sei nichts gewesen, ganz und gar nichts.
»Ich weiß es nicht, Miss Sykes. Überlassen Sie das uns. Es mag unwichtig sein, aber wir brauchen diese Angaben, um es herauszufinden. Es war richtig, dass Sie zu uns gekommen sind. Übrigens wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie mit niemandem darüber sprechen würden.«
»Ich habe es bereits zwei oder drei Leuten anvertraut – ich war beunruhigt.«
»Tja, wenn Sie vielleicht von jetzt an vermeiden könnten, darüber zu reden…«
Bei der Einsatzbesprechung am Samstag gingen Berryman und seine Leute die vorläufigen Ergebnisse der Obduktion von Julie Fyfe durch. Es war genauso wie bei den anderen. Nichts, das direkt auf den Mörder hingewiesen hätte, kein Haar, keine Fingerabdrücke, kein Blut, keine anderen Körperflüssigkeiten und keine Fußspuren. »Einen Dreck haben wir«, schimpfte Berryman. Was an Beweisen da gewesen sein mochte, war von den sintflutartigen Regenfällen weggespült worden. Der Boden unter der Leiche war ebenso nass wie die Erde rundum, was darauf schließen ließ, dass sie erst abgeladen worden war, als der gröbste Teil des Sturms vorüber war, doch sie war völlig durchnässt. Sie war während des Sturms im Freien gewesen.
Was sie hatten, sagte ihnen, dass sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit vom selben Mann getötet worden war. Der Tod war durch Erwürgen mit einem weichen Stoff eingetreten, aber was auch immer verwendet worden war, es war mehrmals um den Hals der Frau geschlungen worden. Der Draht war erst nach ihrem Tod benutzt worden. Der Pathologe meinte, der Mörder hätte sie eventuell erst einmal gewürgt, um sie sich gefügig zu machen, bevor er sie tatsächlich umbrachte. Es gab Hinweise auf sexuelle Gewalt – Quetschungen und Risswunden im Vaginal- und Analbereich und massive innere Verletzungen. »Er benutzt irgendein anderes Ding als sein eigenes Ding«, hatte der Pathologe zu Berryman gesagt. »Etwas Dünnes und Scharfkantiges, Spitzes. Sie wäre verblutet, wenn er sie nicht erwürgt hätte.« Die Augen waren gewaltsam herausgerissen worden – vermutlich mit der Hand. »Er hat Handschuhe getragen. Suchen Sie nach Blutflecken auf Handschuhen«, hatte Berryman seinem Team gesagt. Die großflächigen Prellungen und Schürfwunden rührten vermutlich daher, dass die bewusstlose und später tote Frau über den Boden gezerrt worden war. Dass bei einigen dieser Wunden Blutergüsse oder Blutungen fehlten, ließ darauf schließen, dass sie erst nach ihrem Tod entstanden waren. Man fand Verletzungen, die von einem Aufprall hätten herrühren können, so als wäre sie nach ihrem Tod schwer gefallen. Aus den Schnittwunden hatten sie Kieselsteinchen geholt. Splitter lagen auf der Leiche. Es war Lynne Jordan, die einzige Frau im Team, die fragte, welche der anderen Verletzungen vor, welche nach ihrem Tod eingetreten waren. Berrymann konnte ihr nichts Beruhigendes sagen. Die sexuellen Attacken hatten stattgefunden, als die Frau noch lebte. Und die anderen Wunden? »Etwa zum Todeszeitpunkt« war alles, was der Pathologe ihnen sagen konnte.
»Stammen die Splitter von der zerbrochenen Lampe im Bahnhof von Moreham?« Wieder Lynne. Berryman schüttelte den Kopf. Das Glas stammte von der zerbrochenen Lampe in der Nähe des Fundorts der Leiche. Es gab keine Garantie dafür, dass Julie zum Bahnhof von Moreham gegangen war, obwohl es wahrscheinlich war. Es war ihnen immer noch nicht gelungen, ihre Schritte zu rekonstruieren, nachdem sie aus der Arbeit gekommen war. Obwohl das Team ausführlich nachgeforscht hatte, war niemand gefunden worden, der zur fraglichen Zeit denselben Weg gegangen wäre.
»Wir haben noch eine Aussage, die soeben hereingekommen ist«, erklärte Berryman. »Sie bezieht sich auf die entscheidende Zeitspanne – kurz nach halb zehn. Diese Frau sagt, der Bahnhof sei menschenleer gewesen, abgesehen von einer Person, einem Mann, der sich etwas seltsam benommen hat. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass wir ihn finden müssen. Ich hoffe auch immer noch auf ein Auto. Es müssen doch Autos in diese Richtung gefahren sein.« Berryman holte tief Luft. »Okay. Gehen wir noch einmal alles durch, was wir haben. Schauen wir mal, was wir übersehen haben. Womöglich ist das Schwein ein Glückspilz, aber er kann nicht so etwas tun und gar keine Spuren hinterlassen. Es muss etwas geben, was wir übersehen haben.«
Am Abend saß Mick Berryman immer noch an seinem Schreibtisch. Er war am Morgen davor um vier Uhr durch den Anruf aus dem Revier geweckt worden, in dem ihm mitgeteilt wurde, was Cath Hill gefunden hatte. Vermutlich würde er heute weder seine Kinder zu Gesicht bekommen noch seine Frau. Seine Familie trat in den Hintergrund, bis diese Ermittlungen beendet waren – falls sie das je wären. Er ging gerade einige der früheren Aussagen durch und betrachtete die Angaben, die die Lehrerin heute Morgen gemacht hatte. Vielleicht steckte nichts dahinter, vielleicht war es ausgesprochen wichtig. Womöglich handelte es sich um die erste Gelegenheit, bei der jemand den Killer gesehen hatte. Wenn sie doch nur herausfinden könnten, wo Julie geschnappt worden war. Sie hatten den Bahnhof in Moreham abgesucht, aber dort gab es nicht viel zu sehen. Es sei denn, die Gerichtsmedizin entdeckte noch etwas. Sie mussten ihre Schritte zurückverfolgen. Er begann sich Notizen zu machen.
Sie war um zwanzig nach neun aus der Arbeit gekommen, wie es bei ihr donnerstags üblich war. Das war leicht festzustellen gewesen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war sie zu Fuß zum Bahnhof gegangen, trotz des schlechten Wetters. Es dauerte nur fünf Minuten. Sie hatte kein Taxi gerufen, und einen Bus gab es nicht. War es denkbar, dass sie sich hatte mitnehmen lassen? Ihre Arbeitskollegen waren sich ziemlich sicher: Julie nicht, sie war viel zu vorsichtig; sie würde nur bei jemandem einsteigen, den sie kannte. (Aber wie oft war es jemand, den sie kannten, jemand, dem sie vertrauten?) Es war nicht weit zum Bahnhof, sie war fast sicher dorthin gegangen. Aber ihr Zug war gestrichen worden. Vermutlich hätte sie das gleich auf der Anzeigetafel am Eingang gesehen, aber es war auch am Bahnsteig angezeigt worden. Hätte sie einen früheren Zug erwischen können? Nein, der frühere war fast eine Stunde vorher abgefahren, um zwanzig Uhr dreiunddreißig, und ja, er war pünktlich gewesen. Was hatte sie also getan? Hatte sie beschlossen, auf den nächsten Zug zu warten? Das war eher unwahrscheinlich, da es über vierzig Minuten gedauert hätte, bis der nächste Zug gekommen wäre. Bestimmt hätte sie versucht, den Bus oder ein Taxi zu nehmen. War sie so pleite, dass sie sich das nicht leisten konnte? Oder so knickrig? Er machte sich ein paar Notizen und überlegte weiter.
Laut Deborah Sykes’ Aussage war Julie um zwanzig vor zehn nicht am Bahnhof gewesen. Also: Sie kommt um zwanzig nach neun aus der Arbeit, ist – wann? – zwischen fünf vor halb zehn und halb zehn am Bahnhof. Um zwanzig vor zehn ist sie weg. Er griff erneut nach Deborah Sykes’ Aussage. Wer hatte sie aufgenommen? McCarthy. Es müsste alles drinstehen. Genau. Niemand war aus dem Bahnhof gekommen, als die Sykes dort angelangt war. Sie war auch auf dem Weg zum Bahnhof niemandem begegnet. Falls Julie den Bahnhof verlassen hatte, sowie sie die erste Anzeigetafel sah, wäre sie ziemlich sicher nicht auf der Straße gewesen, als Deborah Sykes vorbeikam. War sie aber auf den Bahnsteig gegangen, bevor sie sah, dass ihr Zug gestrichen worden war, hätte Deborah sie zurückkommen sehen müssen. Er brauchte genauere Zeitangaben. Er musste herausfinden, wie lang sie in diesem Bahnhof gewesen war.
Lynne Jordan saß im Zug nach Sheffield. Sie hatte sich angewöhnt, mit dem Zug zu fahren, wenn die Zeit dazu reichte. Wie die meisten ihrer Kollegen kannte sie die Straßen der Umgebung so gut, dass sie sie nicht nur mit geschlossenen Augen entlangfahren und das Verkehrsaufkommen für jede beliebige Tageszeit vorhersagen konnte, sondern auch wusste, welche Strecken die jugendlichen Autodiebe am liebsten benutzten, um mit quietschenden Reifen in ihren mal eben ausgeliehenen Vehikeln herumzurasen und ihre Kapriolen zu vollführen. Doch mit Zügen kannte sie sich nicht aus. Als das Team über den Landkarten brütete, als es die Fundorte der Leichen musterte, sah sie immer nur ein Stück Landschaft vor sich, kein nahtloses Ganzes.
Heute hatte sie einen Fehler gemacht. Sie würde den Abend in Sheffield verbringen, und es war ihr als eine ideale Gelegenheit erschienen. Aber natürlich war es dunkel gewesen, als sie in den Zug gestiegen war. Es war schon nach halb neun, und der Streckenverlauf vor dem Abteilfenster war nicht zu erkennen. Also beschäftigte sie sich eingehend mit ihren Mitreisenden. Hinter ihr saß ein junger Mann, aus dessen Walkman ein durchdringender metallischer Rhythmus drang. Etwas weiter hinten im Wagen war jemand, der immer wieder geräuschvoll die Nase hochzog. Eine Gruppe Jugendlicher hatte sich in Meadowhall in den Zug gedrängt. Sie brüllten und schubsten sich gegenseitig, lümmelten auf den Sitzen herum und legten ihre schweren Turnschuhe auf die Polster. Sie brachten den unverwechselbaren Geruch nach jungem Mann mit in den Wagen.
Lynne versuchte aus dem Fenster zu sehen. Das Innere des Wagens spiegelte sich schwach in der Scheibe. Sie konnte die leere Chipstüte sehen, die auf ihrem Tisch lag, und die Pfütze ausgelaufene Limonade. Sie nahm die Hände hoch, um ihre Augen abzuschirmen. Sie sah Licht, das von den Schienen reflektiert wurde. Sie drückte das Gesicht enger ans Fenster, nur um erschrocken zurückzuweichen, als etwas so nah vorbeirauschte, dass es sie fast zu streifen schien.
Sie fuhren an einem anderen Zug vorbei. Es war aber kein Personenzug – er schien aus niedrigen, flachen und offenen Güterwagen zu bestehen, auf die stapelweise lange, dünne Gegenstände gebunden waren. Ihr Zug bremste kurz ab, und sie merkte, dass der andere Zug stand oder nur sehr langsam fuhr. Dann sah sie die Lichter und den Tunnel weiter vorn, was hieß, dass sie gleich in Sheffield wären. Der Zug kam zum Stehen. Der Güterzug schlich vorüber. Sie seufzte und sah auf ihre Uhr. Sie würde zu spät kommen.
Debbie kam ebenso bedrückt vom Polizeirevier zurück, wie sie hingegangen war, vielleicht sogar noch bedrückter. Das Gespräch mit dem Polizisten ließ es noch realer wirken, dass sie womöglich den Mörder gesehen hatte. Ihr war nur noch danach, auszugehen und sich zu betrinken.
Also zog sie an diesem Abend durch die Nachtlokale. Sie rief Fiona an, eine Freundin von der Universität, die versuchte, als Jazzmusikerin und Sängerin Karriere zu machen, aber Fiona hatte an diesem Abend einen Auftritt. Sie schlug ihr vor, es bei Brian zu versuchen, dem dritten Mitglied ihres Trios aus Studienzeiten. Brian hatte Zeit, genau wie noch ein paar andere, und so trommelte Debbie alle zu einem feuchtfröhlichen Abend zusammen. Sie trank zu viel, tanzte ausgiebig, knutschte angeheitert mit Brian in den dunklen Ecken der Disko und fummelte später sogar noch betrunkener mit einem gut aussehenden Unbekannten herum, der zwischen ihren Erinnerungslücken auftauchte und dann wieder verschwand. Ihre Freunde brachten sie nach Hause und manövrierten sie durch die Haustür. Irgendwie musste sie es ins Bett geschafft haben, denn dort lag sie, allein, als sie am nächsten Morgen mit Brummschädel und Brechreiz aufwachte, die Schuhe noch an den Füßen. Und nichts war auch nur einen Deut besser geworden.
Die Musik ist laut und aufdringlich, und er verzieht den Mund vor gerechtem Zorn. Dann schließt er das Fenster. Er lässt das Fenster gern offen, weil im Zimmer ein leicht süßlicher, abstoßender Geruch hängt, den er – wie er zugeben muss – ein wenig unangenehm findet. Er kann die Musik immer noch hören, allerdings nicht mehr so laut. Der junge Mann in der Souterrainwohnung unten nimmt keine Rücksicht auf andere. Das kann er wirklich nicht gutheißen. Heute Morgen hat er beschlossen, sich den Tag frei zu nehmen, aber schon jetzt wird er ein bisschen unruhig. Er ist einer jener Menschen, die gern etwas zu tun haben. Er überlegt, ob er eine Stunde bei seinen Zügen verdient hat – schließlich hat er sehr hart gearbeitet. Ja.
Er zieht die Dachbodenleiter herunter. Der Dachboden war das, was das Haus für ihn so attraktiv machte, als er es besichtigte, er wog all den Lärm und die Unannehmlichkeiten auf, mit denen er sich abfinden musste, weil er Zimmer vermietete. Immerhin war es nicht die schlimmste Art von Lärm und Unannehmlichkeiten. Kein Mensch beachtete ihn. Jeder ließ jeden in Ruhe. So war er auch von seiner Mutter erzogen worden, dass er dergleichen guthieß. Leben und leben lassen.
Der Dachboden ist wirklich großartig. Das Dach schwebt hoch über seinem Kopf. Die Fußbodenträger sind mit Brettern verstärkt worden, damit er herumlaufen kann, ohne Angst haben zu müssen, mit dem Fuß durch die Decke seines darunter liegenden Zimmers zu brechen. Die Leitungen hat er selbst verlegt, sodass er so viel Strom hat, wie er will, aber keine Heizung. Heizung braucht er hier oben keine. Aber es gibt einen kleinen Gefrierschrank in der einen Ecke und einen Computer in der anderen. Er hat allen Komfort, den er braucht. Das Beste ist, wie geräumig der Dachboden ist. Er erstreckt sich über die gesamte Dachfläche des Hauses und verfügt, wie er eines Tages herausgefunden hat, über einen Zugang zum Dachboden des Hauses nebenan. Das Haus nebenan ist das Erste in einem Block von drei Reihenhäusern, jedes davon genau wie seines, die allesamt in mehrere Wohnungen umgewandelt worden sind. Es ist kinderleicht, hindurchzusteigen und dann auf die Feuerleiter an der Rückseite zu klettern. Niemandem fällt es auf, wenn noch jemand diese Treppe benutzt, die für alle Wohnungen im Block gedacht ist.
Er schaltet die Lampe ein, die vom Dachbalken hängt – nur eine nackte Birne, irgendwelcher Schnickschnack ist nicht nötig – und blickt voller Wonne auf seine Eisenbahn herab. Er hat versucht, sie so realistisch wie möglich zu gestalten und die landschaftlichen Gegebenheiten einzubauen, die Hügel, den Fluss, den Weg am Kanal. Als er sie plante, beschloss er, Schmalspurgleise zu verwenden, damit die Anlage nicht zu groß würde – trotzdem ist der Platz knapp. Er holt seine Landkarte heraus. Obwohl heute kein Arbeitstag ist, ist doch sicherlich nichts dabei, wenn er nur mal schaut. Schließlich muss er die nächste Jagd planen.