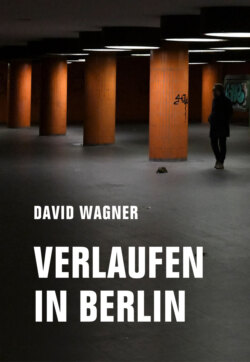Читать книгу Verlaufen in Berlin - David Wagner - Страница 12
DIE 69. MALL
ОглавлениеEröffnungsrabatt! Zehn Prozent! Zwanzig Prozent! Fünfundzwanzig Prozent im Drogeriemarkt!
Zettelverteilerinnen reichen gedruckte Reklame an, neben der Eingangstür klemmt ein Handwerker zwei aus der Wand ragende Kabel ab.
Ich wandere hinein in den karamell-orangefarbenen Innenraum der neuen East Side Mall und entdecke, Überraschung, es gibt einen Saturn, einen Elektrofachmarkt, der Flachbildfernseher und Waschmaschinen ausstellt. Ich betrete die nagelneue und schon veraltet wirkende Verkaufsfläche – möchte aber, trotz aller Eröffnungsangebote, lieber keinen Kühlschrank kaufen.
Und ich staune, welche erlesenen und in Berlin sonst nie gesehenen Geschäfte in dieser Mall Filialen eröffnen: Aldi, McPaper, Nordsee, Deichmann, Rewe. Eine Bioladenkette ist auch dabei, die Versorgung ist gesichert, keine Mangelwirtschaft mehr im Osten.
Glücksräder stehen vor einigen Geschäften, die Kunden des Glücks stehen Schlange. Das traurigste Glücksrad dreht sich vor dem Mobilfunkladen im Untergeschoss. Das heißt, es dreht sich nicht einmal, es ist nur eine Animation auf einem hochkant stehenden Monitor und auf diesem nicht einmal ganz zu sehen. Zu gewinnen gibt es, die Schlange ist zwanzig Meter lang, ermäßigte Vertragsverlängerungen und rote Lutscher. Der Kapitalismus hat nichts zu verschenken. Neben den apathisch anstehenden Glücksrittern turnt eine junge Frau in Sportkleidung, sie tanzt, sie hampelt und wirbelt mit einem pfeilförmigen Schild herum. »Macht xuperdrauf« steht auf dem Pfeil, sie wirbt für das neue Fitnessstudio im Haus.
Es ist gar nicht so leicht, in die 69. Mall von Berlin hineinzufinden. Das auffällig bunte, dunkelrot-orange-grau-weiß-gestreifte Gebäude liegt zwar gut sichtbar an der Warschauer Brücke in Friedrichshain-Kreuzberg, doch gibt es von dieser noch keinen direkten Zugang. Junge Menschen weisen mit großen Schildern den Weg über escherhafte Betontreppen unter der Fahrbahn hindurch. Die Polizei ist auch schon da, mehrere Beamte lehnen am Geländer der Brücke. So groß, dass sie eingreifen müssen, ist der Andrang am Eröffnungstag nicht. Es dauert, bis ich verstehe, dass sie bloß das Brückengeländer bewachen, an dem sie so lässig lehnen. Es versperrt den Zugang zu einem neuen, breiten Fußgängerübergang, der direkt ins Obergeschoss des Einkaufszentrums führen würde. Er darf jedoch nicht freigegeben werden, weil eine Öffnung des Geländers den Bestandsschutz des Bauwerks Warschauer Brücke aufheben würde.
Nach dem Zeitalter der »Center« und dem der »Arkaden« (beziehungsweise »Arcaden«) darf eine Mall in Berlin einfach »Mall« heißen. So wie die vor wenigen Jahren durch Gerichtsverfahren um vorenthaltene Bauarbeiterlöhne berühmt gewordene Mall of Berlin und nun die East Side Mall, die sich den anderen Teil ihres Namens von der nahen East Side Gallery geliehen hat.
»Mall«, erzählt mir ein Freund, soll auf Plattdeutsch »albern« oder »verrückt« heißen. Nun kann sich jeder seinen Reim auf diesen Namen machen.
»Hier wie üblich die Fressmeile«, höre ich einen wohlgenährten Blousonträger sagen.
»Och, noch nich allet fertig«, sagt seine Begleitung.
Und sie hat recht: Wie fast überall im Haus sind auch hier – heißt das Soft Opening? – noch Handwerker bei der Arbeit. Bei Zaddy’s hängen Drähte aus der Decke, bei Vincent Vegan und Goldene Schnitzel brutzelt es hingegen schon. Es riecht nach Fett – ob die Belüftung funktioniert?
Die niedrigen Raumteiler, die den Bereich mit den Tischen in dunkler Holzoptik von dem Anstehbereich trennen, sehen aus, als wären sie aus Sichtbeton – tatsächlich aber besteht ihre Oberfläche aus folienbeschichteten Platten. Und natürlich sind sie hohl. Mir gefällt, dass wie einst falscher Marmor heute falscher Sichtbeton gemalt wird.
Im Essbereich, der hier »Food Court Mahlzeit« heißt, gibt es eine Fensterfront, die Tageslicht einlässt, und dahinter eine schmale Terrasse mit Tischen und Stühlen. Von diesem Balkon geht der Blick auf die große Mehrzweckhalle, die erst nach einem Mobilfunkanbieter und später nach einem Mobilitätsanbieter benannt wurde. Fast alle, die dort ein Konzert oder eine Sportveranstaltung besuchen wollen, alle Eishockey- und Basketballfans, müssen in Zukunft an der Mall vorbei oder können, wie praktisch, durch sie hindurchmarschieren.
Der Blick fällt weiter auf die einfallslose, schuhkartonartige Bebauung des neu eröffneten Mercedes-Platzes. Ich sehe eine Baucontainersiedlung und das Gelände, auf dem die Berliner Stadtreinigung ihre Schneeräumfahrzeuge abgestellt hat, gleich hinter dem grünen Zaun die Galerie der orangefarbenen Schneeschieberschaufeln. Sie dürfen unter freiem Himmel rosten.
Die Turmspitzen der Oberbaumbrücke ragen ebenfalls ins Bild, die Spree ist nicht zu sehen.
Auf dem Weg hinaus in die frühere innerstädtische Peripherie, ich möchte mir den Mercedes-Platz ansehen, komme ich an drei Jugendlichen vorbei, die mit Besen und Kehrblechen bewaffnet sind. Sie kehren den frisch gepflasterten Vorplatz, sie lachen, einer von ihnen schiebt einen losen Pflasterstein auf seine Kehrschaufel. Neben ihnen fauchen und zischen vier Nebeldüsen und erinnern mit ihrer Dampfmaschinensimulation, wahrscheinlich unbeabsichtigt, daran, dass sich hier mal ein Industriegebiet und der Ostgüterbahnhof befanden.
Neben der nagelneuen und dezent bunten Fassade der East Side Mall sieht die Mercedes-Benz-Arena noch billiger und veralteter aus als am Tag ihrer Eröffnung. Der neue Mercedes-Platz ist trotz seiner Wasserspiele mit aus dem Boden spritzenden Fontänen ein systemgastronomiedekorierter Ort urbaner Hoffnungslosigkeit. Nichts erinnert daran, aber wieso auch, dass hier einst die Lagerhallen standen, in denen sich bis in die frühen Nullerjahre die aufregendsten Clubs der Stadt ausgebreitet hatten, das Ostgut zum Beispiel, ein Stück weiter Richtung Mitte die Maria am Ostbahnhof.
Die Renditebebauung dieses Möchtegern-Markusplatzes, das Wasser der Spree ist nah, sieht aus, als warte sie schon darauf, wieder abgerissen zu werden. Erlöse mich, scheint sie zu flüstern, verschrotte mich einfach, wie ein Auto. Bald. Seit das Land Berlin dem privaten Entwickler dieses Areal überließ, hat der Quadratmeterpreis sich hier etwa versiebzigfacht.
Auf dem Weg zurück zur Mall komme ich mit einem jüngeren sizilianischen Wachmann ins Gespräch. Er trägt einen neongelben Bauhelm, eine neongelbe Weste und eine Brille mit einem dicken schwarzen Rahmen. Und sieht aus wie ein Schauspieler, der sich als Baustellenwachmann verkleidet hat.
Zehn Stunden stehe er jeden Tag hier, er arbeite für eine Zeitarbeitsfirma, die ihn auch schon in Flüchtlingsheimen und auf Festivals eingesetzt habe. Er mache diesen Job wegen der Krankenversicherung, samstags und sonntags verkaufe er geröstete Esskastanien auf dem Boxhagener Platz und dem RAW-Gelände. Und er träume davon, eines Tages ein Café oder eine Pizzabäckerei zu eröffnen.
»Früher gab es hier nur Punks«, sagt er, »früher war hier alles ganz anders.«
Wie lange er in Berlin sei, frage ich ihn. »Seit sieben Jahren«, sagt er, und ich bemerke wieder: Jeder, der länger als vier Wochen in dieser Stadt wohnt, kann schon erzählen, wie es früher hier mal war. Davor. Wie wild, wie aufregend, wie improvisiert. Davon lebt die große Berlinerzählung.
Mir fällt in diesem Moment ein, dass ich im Mai 1990 zum ersten Mal am alten S-Bahnhof Warschauer Straße ausgestiegen bin, um zu Fuß über die damals noch nicht restaurierte Oberbaumbrücke – ihr fehlten die Türmchen und die Hochbahngleise – hinüber nach Kreuzberg zu gehen. Von einer Mall an diesem Ort habe ich damals nicht geträumt.
So, wie sie nun hier gelandet ist, gefällt mir die gestreifte Schachtel der East Side Mall mit ihren abgerundeten Ecken (entworfen vom niederländischen Architekten Ben van Berkel) ausnehmend gut. Die Lamellenfassade erinnert an eine Reptilienhaut und gibt dem Baukörper zugleich etwas Luftiges: Dieser parametrische Kasten möchte eine Skulptur sein und so aussehen, als wäre er aus der Zukunft – und mit seiner Retrofarbgebung zugleich mehr sein als nur eine Schachtel.
Und ich glaube, ich weiß jetzt, woran die große bunte Kiste mich erinnert: Sieht sie nicht aus wie ein gigantischer WLAN-Router? Wie das Ding, aus dem zu Hause das Internet kommt? Das Internet, in dem ich alles einkaufen könnte.
Wozu überhaupt noch Malls? Ich kann doch vom Sofa aus einkaufen. Oder im Bett liegend. Wieso soll ich überhaupt ein Einkaufszentrum besuchen? In Zeiten, in denen ich alles per Telefon ordern kann, brauche ich einen Grund, eine Mall zu betreten.
In mir keimt der Verdacht, dass die schöne neue Mall, durch die ich wieder wandere, ein Museum sein könnte. Ein nagelneues Museum, das seinen Besuchern bloß zeigen und vorführen soll, wie das Einkaufen früher funktionierte, bevor es Lieferdienste gab, die am selben Tag oder innerhalb einer Stunde an der Haustür klingeln.
Wer soll denn, ich schlendere an der heute »wegen technischer Probleme« geschlossenen Post vorbei, in dieser Mall einkaufen, wenn die zum Eröffnungstag angelockten Umlandbewohner nicht mehr kommen? Touristen? Kreuzberger, die über die Oberbaumbrücke spazieren? Die inexistenten Anwohner des Mercedes-Platzes? Die Umsteiger, die hier von der U-Bahn in die S-Bahn wechseln und umgekehrt? Die Kunden, die sich früher im heute zu einem Betonskelett zurückgebauten Kaufhof am Ostbahnhof versorgten? Alle, die kein Internet haben?
Wir werden sehen. Mall-Jahre sind Hundejahre. Die nur zwei S-Bahnstationen entfernte Alexa-Mall sieht viel älter aus als die elf Jahre, die seit ihrer Eröffnung vergangen sind. Und vielleicht erleben wir es noch, dass aus den 1998 mit großem Tamtam eröffneten Potsdamer Platz Arkaden eine Wärmehalle für neue Wohnungslose wird.
Der schönste Ort der bisher nur zu neunzig Prozent vermieteten East Side Mall ist das obere Parkdeck: freie Sicht, Luft und Sonne auf dem Dach. Am Eröffnungstag gegen halb zwölf stehen nur wenige Autos dort, die meisten mit Zwei- und Drei-Buchstaben-Kennzeichen. Hier könnte ein Dachgarten sein, eine Bar – stattdessen stapfe ich über dilettantisch gepinselte Linien, die weißumrahmte Parkplatzrechtecke auf den Betonboden malen. Schade.
Was mir noch gefällt, während ich durch diese im Vergleich eher bescheidene Mall spaziere – İstinye Park in Istanbul ist viermal so groß, Westfield London hat fast zehnmal so viel Verkaufsfläche: Im Untergeschoss kann ich beobachten, wie die Folie von einer Palette fabrikneuer roter Rewe-Einkaufskörbe gezogen wird. Bräuchte ich etwas, ich könnte mit einem jungfräulichen Korb einkaufen gehen. Schutzfolie klebt an einigen Stellen auch noch über dem Handlauf des Luftraumgeländers. Und am Vormittag stehen die silbernen Mülleimer wie Pinguine in einer Kolonie zusammen im Erdgeschoss. Gegen Mittag haben sie sich verteilt. Und mir gefallen die schwarzen, wohl mit Sand gefüllten Plastiksäcke mit East-Side-Schriftzug. Sie hindern die vergeblich an ihnen zerrenden Gasluftballons daran davonzufliegen.
Um zwanzig vor zwölf, endlich ist es so voll geworden, wie das Mall-Management sich das wohl zur Eröffnung gewünscht hat, ertönt auf einmal Alarm. Alle Besucher und Angestellten sollen das Gebäude verlassen.
»Es könnte ein Feuer ausgebrochen sein«, heißt es. Die Läden schließen. »Wo ist der Sammelpunkt?«
»Warum sagen sie nicht durch, was los ist?«
»Jetzt kommt echt die Feuerwehr.«
Panik bricht keine aus, während beeindruckend viele Menschen Richtung Ausgang strömen. So viele Personen passen in diese Schachtel?
Niemand weiß nichts Genaues, es folgt keine Durchsage, irgendwie ahnen alle schon, dass es sich um einen Fehlalarm handelt.
Ich gehe mit bis zu den Türen, die zur Warschauer Brücke führen, bleibe dann aber, es kümmert niemanden, im Gebäude zurück. Schon immer wollte ich einmal ganz allein in einer Mall sein. Und für drei oder vier Minuten stehe ich tatsächlich fast allein mit einer jungen Gutscheinverteilerin und zwei Männern in gelben Warnwesten auf dem Gang und schaue in die Gesichter der aus dem Einkaufsparadies Vertriebenen. Mehrere Hundert, vielleicht sind es sogar Tausend warten sehnsüchtig auf der anderen Seite der Glastüren. Wie die Untoten in George A. Romeros Dawn of the Dead wollen sie wieder hinein in die Mall, zurück an den Ort, der ihnen vielleicht nicht immer im Leben, jetzt, heute aber der wichtigste ist.
2018