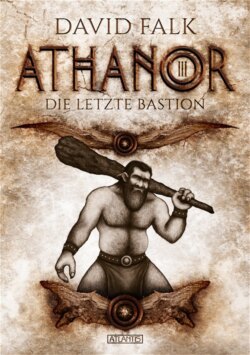Читать книгу Athanor 3: Die letzte Bastion - David Falk - Страница 6
3
ОглавлениеEs hat Vorzüge, Kaysar zu sein. Genüsslich brummend ließ sich Athanor in die Bronzewanne aus dem zerstörten Fürstenpalast sinken. Die Flüchtlinge hatten sie in ein anderes Anwesen getragen, dessen einziger halbwegs bewohnbarer Trakt nun als Residenz für den Kaysar diente. Wie alle Herrenhäuser Dions war auch dieses um einen Innenhof herum angelegt worden, der unter eingestürzten Mauern begraben lag. Von der einstigen Pracht kündeten nur noch rußgeschwärzte Malereien an den Wänden. Nach dionischem Brauch gab es nicht einmal Fenster, und ein Vorhang ersetzte notdürftig die im Feuer vergangene Tür.
Nemera schloss ihn, nachdem die letzte Magd mit leerem Eimer gegangen war. Da die Sonne noch hoch am Himmel stand, fiel genug Licht durch den dünnen Stoff, um den Raum zu erhellen. Für einen großen Mann war die Wanne etwas zu eng, doch Athanor machte es sich so gemütlich wie möglich. Für eine Weile wollte er die Menschen dort draußen samt ihren zahllosen Problemen vergessen. Schweren Herzens hatte er ihnen gestattet, den verdursteten Priester in einem der Totenhäuser vor der Stadt beizusetzen. War der Kerl nun endgültig tot? Athanor traute der Sache nicht, doch nachdem Rhea den letzten Wunsch des Toten verkündet hatte, wäre ein Scheiterhaufen zu grausam gewesen. Soll sich Laurion darum kümmern. Vielleicht war der Magier so übel gelaunt, weil er sich nutzlos fühlte.
»Du siehst durch mich hindurch«, stellte Nemera amüsiert fest. Schon ihre dunkle Stimme ging Athanor unter die Haut. Sie trug das schwarze Haar aufgesteckt, was ihren langen Hals und das schmale, fast schon hagere Gesicht betonte. Ihr Kleid ließ die Arme unbedeckt und wurde nur von zwei Spangen auf den Schultern gehalten. »Was kann einen Mann mehr beschäftigen als eine Frau, die sich vor ihm auszieht?«
»Wenig«, gestand Athanor schmunzelnd. Durch halb geschlossene Lider sah er zu, wie sie die erste Spange löste und der Stoff bis unter eine der kleinen Brüste hinabfiel. Vielleicht war er doch nicht so müde, wie er geglaubt hatte. »Es ist nur manchmal nicht leicht, ein Gott zu sein.«
Lächelnd öffnete Nemera die zweite Spange und ließ das Kleid zu Boden gleiten. »Der Kaysar ist nun einmal Herr über die Welt«, meinte sie, nahm einen Schwamm und trat zu ihm an die Wanne. »Wie könnte er da kein Gott sein?«
»Dein Volk kann nicht ernsthaft glauben, dass ich über mehr als diesen jämmerlichen Haufen hier herrsche.«
Nemera beugte sich vor, um den Schwamm ins Wasser zu tauchen. Sie duftete nach dem kostbaren Öl, das aus einer der Kammern unter dem Regentenpalast in Ehala stammte. »Weshalb wundert dich das so?« Sanft begann sie, Schweiß und Staub von seiner Haut zu waschen. »Du bist auf einem Elfenschiff über den Ozean gekommen und fliegst auf einem Drachen in die Schlacht.«
Athanor verdrehte die Augen. »Hältst du mich deshalb gleich für einen Gott?«
»Hm, nein, ich glaube, ein Gott nickt nach dem Beischlaf nicht einfach so ein.«
»Ha! Elende Ketzerin!«, rief er und griff nach ihr, doch sie wich lachend vor dem Wasser zurück, das aus der Wanne schwappte. Gähnend wartete er darauf, dass sie wieder in Reichweite kam. Er würde seine Menschlichkeit heute wohl wieder unter Beweis stellen.
* * *
Gedankenverloren stocherte Laurion in seinem Linseneintopf herum. Nach außen bemühte er sich um Gelassenheit, doch in seinem Innern gärte es, und das Schlimmste war, dass er mit niemandem darüber sprechen konnte. Von Nemera abgesehen, waren alle seine Freunde tot. Falls er überhaupt so vermessen sein durfte, die Regentin zu seinen Freunden zu zählen.
Sicher, er hatte Rhea, die ihm die meiste Zeit wie ein Schatten folgte. Auch jetzt hockte sie ganz in der Nähe auf einem Kissen und löffelte im Gegensatz zu ihm eifrig die Suppe in sich hinein. Nach dionischer Sitte aßen sie auf dem Dach der Ruine unter dem Sternenhimmel zu Abend. Von hier hatten sie sogar Blick auf den Hafen und das im Mondlicht schimmernde Meer. Laurion schenkte Rhea ein tapferes Lächeln. Sie beide hatten Familie und Zuhause verloren, aber für das kleine Mädchen wog der Verlust ungleich schwerer. Solange sie um ihn war, vergaß er nie, dass andere schlimmere Schicksale erlitten hatten als er.
»Du siehst traurig aus.«
Dass Kinder immer so geradeheraus sein mussten … »Könnte daran liegen, dass ich traurig bin«, erwiderte Laurion und bekam ein schlechtes Gewissen, als Rhea sogleich besorgt aussah. »Es ist nichts Schlimmes«, versicherte er. »Ich bin nur ein bisschen wehmütig, weil niemand mehr einen Magier braucht.« Das war zwar nicht der Grund für seine Zerrissenheit, aber wahr genug, um davon abzulenken.
»Jeder braucht einen Zauberer. Zauberer können doch Wünsche erfüllen.«
Laurion lächelte nachsichtig. Meine eigenen Wünsche erfüllen zu können, wäre für den Anfang nicht schlecht. »Da hast du recht. Bevor …« … die Drachen kamen, wollte er sagen, aber das hätte Rhea nur an jenen schrecklichen Tag erinnert. »Also, früher haben sich die Leute ständig etwas von mir gewünscht. Die Bauern wollten, dass ich Donnervögel rufe, damit es auf ihren Feldern regnet. Großmeisterin Thegea erwartete, dass ich alle Zauber lerne, die sie beherrschte. Und die Regentin …« Unwillkürlich sah er zu Nemera hinüber, die mit Mahanael und dem Kaysar an einem anderen Tisch saß. »… musste ich vor bösen Magiern beschützen, die sich in den Palast schleichen wollten.«
Rhea sah ihn mit großen Augen an. »Gibt es denn keine bösen Zauberer mehr?«
»Nein, kleine Schwester, der Große Drache und der Kaysar haben sie alle … gefangen und bestraft.«
»Ich bin deine Schwester?«, fragte sie erstaunt.
»Alle Magier und Magierinnen sind Brüder und Schwestern«, behauptete Laurion. Zumindest nannten wir uns so. »Und da du die Stimme dieses toten Mannes gehört hast, glaube ich, dass du eine Magierin werden kannst.«
Diese Aussicht gab Rhea offenbar so viel zu denken, dass sie schweigend weiterlöffelte und vollkommen abwesend aussah. Nemeras Lachen lenkte Laurions Aufmerksamkeit wieder auf die Regentin. Der Kaysar schien gerade etwas Amüsantes gesagt zu haben, denn auch Mahanael lachte. Wie ein glühendes Stück Kohle brannte sich die Eifersucht in Laurions Herz. Seit der Schlacht um die Ordensburg hatte Nemera nur noch Augen für Athanor. Dass sie Laurion schon zuvor kaum Beachtung geschenkt hatte, zählte nicht. Auch wenn er nur einer von vielen jungen Männern am Hof gewesen war, hatte er zu ihren Vertrauten gehört und sich eingebildet, dass sie mehr als nur freundlich zu ihm war. Die Verhältnisse am Hof und die ständige Bedrohung durch Sethon hatten eben nicht mehr Nähe zugelassen, ohne einen Skandal oder Sethons Rache zu provozieren. Habe ich mir das alles nur eingebildet?
»Laurion!«, rief Athanor und gab ihm einen einladenden Wink. »Willst du dich nicht zu uns setzen?«
Laurion lächelte und hoffte, dass es nicht allzu gequält aussah. Ja, der Kaysar war manchmal schroff und ungeduldig. Und er hielt Magier für nutzlose Memmen, die er ständig aus Gefahren retten oder umbringen musste. Doch Laurion wollte nicht ungerecht sein. Ein hartes Schicksal hatte Athanor zu dem gemacht, der er war, und dafür, dass er die Drachen und Nekromanten besiegt hatte, verdiente er jedes erdenkliche Glück. Aber musste es ausgerechnet Nemera sein?
Seufzend stand Laurion auf, um zu ihnen hinüberzugehen. Athanor war nun einmal der Kaysar. Wie es die alten Überlieferungen geboten, hatte Nemera in seinem Namen über Dion regiert. War es da nicht selbstverständlich, dass sie nun seine Königin wurde?
Laurions Blick fiel auf die wenigen Lichter der ansonsten dunklen Ruinenstadt. Manche waren nicht mehr als der matte Widerschein eines Dungfeuers auf eingestürzten Häusern, andere loderten heller, doch stets markierten sie einen Ort, an dem Flüchtlinge ihr karges Mahl teilten. Umso überraschter hielt Laurion inne, als er eine Art Fackelzug bemerkte, der sich wie ein kleiner Schwarm aus Lichtern auf das Anwesen zubewegte. Er musste wohl beunruhigt aussehen, denn sofort fragte Athanor: »Ist da unten etwas?«
Laurion trat an die niedrige Mauer, die das gesamte Dach umgab. »Es scheint eine Gruppe Leute herzukommen, aber ich kann noch nicht viel erkennen. Einige tragen Fackeln und Öllampen.«
»Neuankömmlinge?« Nemera klang hoffnungsvoll, als sie mit Athanor und Mahanael an Laurions Seite kam. Sie freute sich über jeden Dionier, der den Drachen entgangen war und nun den Weg nach Sarna fand.
»Eilig haben sie es jedenfalls nicht«, stellte Athanor fest.
Leise Stimmen drangen herauf. Sie klangen weder aufgebracht noch fröhlich. Laurion glaubte, im Lichtschein einige bekannte Gesichter zu erkennen. »Ich sehe mal nach, was sie wollen«, beschloss er, denn es ziemte sich nicht, dass die Regentin oder gar der Kaysar selbst an die Tür gingen, um Bittsteller nach ihrem Begehr zu fragen. Dass ausgerechnet er sich an die höfische Etikette klammerte, hätte er nie von sich erwartet, aber wenn er Nemera nicht einmal als Haushofmeister dienen konnte, gab es keinen Vorwand, ständig in ihrer Nähe zu sein.
Er stieg die Treppen hinab und ging zu der Tür, die einst nur eine Seitenpforte gewesen war. Nachdem das große Tor jedoch mit dem gesamten Ostflügel in Trümmern lag, gab es keinen anderen Eingang mehr.
Im Anwesen herrschte Stille. Die meisten der wenigen Bediensteten kehrten abends zu den anderen Flüchtlingen zurück, und Nemera fühlte sich zu sehr als Teil der Notleidenden, um Palastwächter zu ernennen. Sie besaß nichts mehr, das zu rauben sich gelohnt hätte. Laurion fand es dennoch etwas leichtsinnig, aber wer war er, der Regentin zu widersprechen? So näherte er sich allein der Tür, und die im Feuer zersprungenen Bodenfliesen knirschten unter seinen Füßen.
Als er öffnete, blendete ihn der Schein der Fackeln, sodass die Gestalt vor der Schwelle eine dunkle Silhouette blieb. Sofort fiel ihm auf, dass alle anderen Abstand von dem Mann hielten, der ein Schwert und eine Rüstung trug. Gespanntes Schweigen lag über den Versammelten, als warteten sie darauf, wie Laurion den Fremden aufnehmen würde. Eine Andeutung von Moder und Verwesungsgestank wehte Laurion in die Nase. Gütiger Drache! Instinktiv wich er einen Schritt zurück. Was sollte er gegen einen Untoten tun?
Doch der Wiedergänger stand reglos vor ihm. Allmählich konnte er das Gesicht des ausgedörrten Leichnams sehen, doch es war zu entstellt, um ihn an jemanden zu erinnern. Aber dieser Helm … das Schwert … »Hamon?« Der Erste Krieger Dions. Nemera hatte erzählt, dass der Oberbefehlshaber in der Schlacht von einer Drachenklaue durchbohrt worden war. Schwer verwundet hatte er versucht, die Regentin auch vor dem Angriff der Untoten zu beschützen, und sie bis in den Tod verteidigt. Laurions Blick wanderte zum Bauch des Wiedergängers hinab. Das Loch im Kettenhemd war nicht zu übersehen. Draußen raunten sich die Flüchtlinge Hamons Namen zu und stellten sich zweifellos dieselbe Frage wie Laurion. Was hat das zu bedeuten?
»Er möchte die Regentin sehen.« Rheas Stimme ertönte so unerwartet hinter ihm, dass Laurion zusammenzuckte.
»Natürlich. Was sonst.« Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Aber sollte er es dem Untoten gestatten? Bei allen Göttern, es ist Hamon! Der alte Recke hatte bereits Nemeras Vater treu gedient. Laurion wich dem Blick der leeren Augenhöhlen aus, die unter halb geschlossenen Lidern verborgen waren. »Tretet ein, Herr!« Mit einer einladenden Geste gab er den Weg frei und ließ den Wiedergänger an sich vorüberschreiten, bevor er die Tür wieder schloss.
Der untote Erste Krieger wartete nicht auf ihn. Steif marschierte er den Gang zur Treppe entlang, als ob er wüsste, wohin er sich wenden musste. Hastig eilte Laurion hinterher, um ihn zu überholen. Er durfte Nemera diesen Anblick nicht ohne eine Warnung zumuten.
Atemlos erreichte er das Dach und keuchte: »Hamon. Es … ist … Hamon.«
Athanor runzelte die Stirn, während Nemera entsetzt die Augen aufriss.
»Der Erste Krieger?«, fragte Mahanael verwirrt.
Laurion nickte. »Er ist tot. Untot«, platzte er heraus, als der Wiedergänger auch schon auf den obersten Stufen erschien.
Die Regentin wich zurück und schlug sich eine Hand vor den geöffneten Mund, als müsste sie einen Schrei ersticken. Wie ein Mann traten der Kaysar und der Elf vor, um sie abzuschirmen. Keiner von ihnen trug bei Tisch eine Waffe. Selbst Athanor, den Laurion kaum jemals ohne Kettenhemd gesehen hatte, war nur in die Gewänder eines einfachen Mannes gekleidet. Doch der Untote rührte sein Schwert nicht an. Stumm hielt er auf Nemera zu, die sich fasste und zwischen ihren Beschützern hervortrat.
»Wird deine Robe auch schwarz, wenn du tot bist?«, fragte Rhea.
Wie kam sie jetzt bloß auf eine schwarze … Nein! Für einen Lidschlag stand Laurion wie erstarrt, dann stürzte er hinter dem Untoten her. »Passt auf! Es ist Sethon!«
* * *
Orkzahn stapfte durch den Herbstwald. Für den Besuch bei Rotwange hatte er seine beeindruckendste Keule geschultert – einen Oberschenkelknochen des untoten Drachen, den sie in Theroia besiegt hatten. Er hoffte, unterwegs noch einer passenden Beute zu begegnen, damit er auch ein Geschenk mitbringen konnte. Mürrisch trat er gegen einen menschenkopfgroßen Stein, der raschelnd im Gesträuch verschwand. Unter dem nachlässig gegerbten Bärenfell, das er um die Hüften trug, juckten die Käferzangen in der Axtwunde. Seine Nieren schmerzten, und beim Pissen hatte er Blut im Strahl entdeckt. Verfluchte Orks! Aber Rotwange würde wissen, welches widerliche Grünzeug er kauen musste, um rasch gesund zu werden. Darüber machte er sich keine Sorgen.
Stattdessen kreisten seine Gedanken ständig um die untoten Orks. Wie hatten sie ihn am helllichten Tag angreifen können? Die theroischen Wiedergänger waren vor der Sonne in ihre Grabkammern geflohen. Hatte sie das Licht überrascht, waren sie einfach umgefallen. Tot. Gewöhnliche, reglose Leichen, an denen nichts verriet, dass sie sich bei Dunkelheit wieder erheben würden. Warum galt das nicht für diese Orks? Weshalb liefen sie überhaupt als Untote herum, anstatt sich in ihr Schicksal zu fügen?
In Theroia hatte dieser alte Elf gestanden, dass er die toten Menschen durch irgendeine Zauberei zu Wiedergängern gemacht hatte. Dafür war er von den Trollen bei lebendigem Leib zerrissen und roh verschlungen worden. Doch wer hatte die Orks wiedererweckt? Orkzahn war am nächsten Tag auf die Suche nach einem Verantwortlichen gegangen. Er mochte kein guter Fährtenleser sein, aber nichts deutete darauf hin, dass sich irgendein zaubermächtiges Wesen in der Gegend befand. Konnten die Orks einfach so wieder aufgestanden sein, um sich an ihm zu rächen? Das hatten sie doch sonst nie getan. Es musste einen Grund dafür geben. Es gab für alles einen Grund. Aber ihm fiel keiner ein, und so drehten sich seine Gedanken immer weiter im Kreis. Er war kurz davor, sich die eigene Keule überzuziehen, um endlich wieder Ruhe zu haben.
Wenn ich weiter vor mich hingrüble, werde ich gar nichts erlegen, erkannte er und achtete wieder auf seine Umgebung. Seit dem Kampf gegen die untoten Orks zweifelte er ständig, ob die Stille des Waldes um ihn herum noch üblich oder bereits wieder Vorbote neuen Unheils war. Der Wind rauschte zwar im bunten Laub, aber waren auch Vögel zu hören? Gelbe und rote Blätter segelten zu Boden, doch schwirrten auch noch Fliegen herum? Orkzahn grunzte. Neben ihm glitt eine Schnecke über einen bemoosten Stein. Zählte die nun oder nicht? Vielleicht kam sie nur nicht schnell genug voran. Diese Denkerei trieb ihn noch in den Wahnsinn.
Er ging weiter, hielt die Keule aber nun kampfbereit. »Zeigt euch, ihr toten Memmen!«, grollte er und ließ den Blick mal hierhin, mal dorthin schweifen, damit ihm keine verdächtige Bewegung entging. Irgendwo schrie ein Häher. Das Geräusch entfernte sich. War das nun gut oder schlecht? Allmählich hasste er sich für die vielen Fragen. Selbst das Knacken der Äste unter seinen Füßen ergab mehr Sinn.
Die Stille schien dichter zu werden, bedrückender. Orkzahn runzelte die Stirn. Durfte er seinen Zorn jetzt endlich an einem Gegner auslassen? Vor ihm rührte sich etwas zwischen den Bäumen. Breitbeinig blieb er stehen und spähte in das Spiel von Licht und Schatten unter den wogenden Baumkronen. Helle und dunkle Flecken huschten über eine große Gestalt. Ein Troll?
Orkzahn lehnte den Drachenknochen wieder an seine Schulter und ging auf den Fremden zu. Die Fremde. Für einen Kerl waren die Hüften zu breit. Jetzt sah er auch die großen, schweren Brüste, die ein straffer, breiter Lederriemen davon abhielt, bei jedem Schritt hin und her zu schwingen. »Rotwange?«
Die Trollin antwortete nicht, kam nur stumm auf ihn zu. Halb versteckt hinter der ausladenden Gestalt entdeckte er ihren kleinen Sohn, der den Arm heben musste, um sich an einen Zipfel ihres Rocks aus Büffelfell zu krallen. Ängstlich spähte der Junge aus seiner Deckung zu ihm auf. Orkzahn zog die Brauen noch enger zusammen. Seit wann waren Trollkinder so furchtsam?
Sein Blick kehrte zu Rotwanges Gesicht zurück. Sie lächelte nicht, obwohl sie es eigentlich immer tat, wenn sie ihn sah. Und ihre sonst so kräftig geröteten Wangen waren fahl. Täuschte er sich, oder ging bei jedem Schritt ein Zittern durch ihre fleischigen Lippen? Was sollte er tun, wenn sie anfing zu heulen?
Doch es liefen keine Tränen über die schmutzig-blasse Haut. Als sie vor ihm stehen blieb, konnte er es deutlich sehen. Ihre eingetrübten Augen blickten durch ihn hindurch. Für einen Moment weigerte er sich, es zu begreifen. Er starrte sie einfach nur an. Sie war tot. Untot. Und sie schleifte ein lebendes Kind hinter sich her.
Mit einem Mal stürmten so viele Gedanken auf ihn ein, dass ihm schwindlig wurde. Wie ein Ertrinkender in einem reißenden Fluss klammerte er sich an den erstbesten Halt in diesem Wirrwarr. Es ist eine Seuche. Alle Toten stehen wieder auf. Aber eine Krankheit konnte man bekämpfen. Es gab Kräuter, Wurzeln, Ahngeister, die … womöglich ebenfalls aufstanden.
Rotwange bewegte den Arm. Sie trat einen Schritt zur Seite, sodass der Junge besser zu sehen war, und deutete vage auf ihn. Noch immer blickte das Kind nur mit geweiteten Augen zu ihm auf.
Orkzahn begriff. Sie konnte nicht mehr für den Jungen sorgen. Sie gab ihn in seine Obhut, weil sie tot war. Untot. Ihr Geist sprach durch diesen kalten Leichnam zu ihm.
Er nickte. »Ich bringe ihn zu deiner Mutter. Sie wird sich um ihn kümmern.«
Ihre bleiche Pranke tätschelte den braunen Schopf und löste die Finger des Kleinen von ihrem Rock. Dann sackte sie ohne einen Laut zusammen. Fiel in Laub und Farn, als hätte ein Keulenhieb sie niedergestreckt. Ihr Geist war fort, einfach gegangen, und ließ ihn mit noch mehr Fragen zurück.
* * *
Als der Untote das Dach betrat, starrte Athanor ihm grimmig entgegen. Was konnte der Wiedergänger wollen? Im Leben mochte er der Erste Krieger Dions gewesen und einen verdienstvollen Tod gestorben sein, doch das Land brauchte ihn nicht mehr. Es gab nun einen männlichen Herrscher, um die Verteidiger in den Kampf zu führen. Erkennt der verfluchte Kerl meinen Anspruch immer noch nicht an? Der Hinterhalt, mit dem Hamon versucht hatte, ihn zu beseitigen, war nicht vergessen.
Unwillkürlich war er einen Schritt vorgetreten, um sich zwischen Nemera und den Untoten zu bringen. Doch er hörte Nemera durchatmen und sah aus dem Augenwinkel, wie sie sich straffte. Würdevoll schritt sie zwischen ihm und Mahanael hindurch, um Hamon wie die Königin entgegenzusehen, die sie war und immer sein würde.
Plötzlich schrie Laurion auf: »Passt auf! Es ist Sethon!«
Dass der Magier losrannte, nahm Athanor kaum noch wahr. Vergebens langte seine Hand nach dem Schwert, während er auf den Untoten zuschnellte. Auch der Wiedergänger stürzte vor und griff nach der Waffe an seinem Gürtel, doch statt Hamons Schwert blitzte in seiner Hand ein Dolch auf. Im gleichen Augenblick zerstob die Illusion. Helm und Kettenhemd waren verschwunden. Die ausgedörrte Klaue, die Athanor beim Handgelenk packte, ragte aus einer schwarzen Robe. Um die grinsende Totenfratze klebte strähniges dunkles Haar. Mit Nägeln wie Krallen fasste die zweite Hand nach Athanors Gesicht. Während er den Kopf wegdrehte, schlossen sich seine Lider von selbst. Die knochigen Finger schlugen sich ihm in Kehle und Nacken. Eisern hielt er mit beiden Händen den Arm mit der Klinge umklammert und stemmte ihn von sich weg.
Laurion sprang dem Untoten in den Rücken und umschlang den Hals, als könnte er die Leiche erwürgen. Zu Athanors Linker griff Mahanael nach der Hand des Wiedergängers und versuchte vergeblich, die Finger vom Heft des Dolchs zu lösen. Umso tiefer gruben sich die Nägel der anderen Hand in seinen Hals. Athanor spannte die Muskeln, kämpfte gegen den würgenden Druck an. Irgendwie musste er den Gegner zu Fall bringen. Mit voller Wucht trat er Sethon gegen ein Bein. Es brachte die Klinge des Dolchs gefährlich nah an seine Stirn, doch Mahanael stemmte sich hastig dagegen. Unter Laurions Gewicht auf dem Rücken gab das andere Knie nach. Athanor riss den Untoten mit einem Ruck von den Füßen. Mit Laurion im Nacken stürzte der Wiedergänger zur Seite und krallte sich noch fester in Athanors Hals. Ohne Sethons Arm loszulassen, warf sich Athanor mit den Magiern zu Boden. Sein Gewicht hielt den strampelnden, sich windenden Leichnam dort fest, während Laurion rasch davonkrabbelte.
»Fesselt ihn, verdammt!« Es kam nur noch krächzend aus Athanors Kehle. Die Totenklaue schnitt ihm den Atem ab. Mahanael beugte sich über ihn und fingerte am Gürtel des Nekromanten herum, während Athanor mit ihm rang. Er konnte nicht sehen, was der Elf mit dem gelösten Gürtel trieb, hoffte nur, dass er dem Untoten die Knöchel zusammenzurrte. Über ihm tauchte Laurion wieder auf. Der Magier hielt den weißen Seidenstrick, mit dem er seine Robe gürtete, und schlang ihn ums Handgelenk der Klaue an Athanors Hals. Als gelte es, einen Opferstier für die Donnervögel zu bändigen, stemmte sich Laurion mit einem Fuß gegen Sethons Schulter und zerrte am Strick. Athanor spürte, wie die Nägel des Toten brennende Striemen in seine Haut rissen.
Im nächsten Augenblick war der würgende Griff fort. Luft strömte so unvermittelt in Athanors Lunge, dass ihm ein Keuchen entfuhr. Laurion taumelte rückwärts. Der Untote trat nicht mehr um sich, wand sich dafür aber umso heftiger. Wie eine Schlange krümmte er sich, warf sich hin und her, dass der morsche Leib knirschte. Noch immer hielt Athanor nur mit äußerster Anstrengung den Dolch von sich fern. Niemals hätte der schmächtige Kerl eine solche Kraft entwickeln können, solange er am Leben gewesen war.
Mahanael sprang Laurion zur Seite. Gemeinsam zogen sie an dem Strick und bogen den Arm des Wiedergängers auf die Hand mit der Klinge zu.
»Halt durch!«, rief Nemera, die plötzlich neben ihm kniete. Beherzt fasste sie beide Arme und presste sie mit vor Anspannung verzerrter Miene immer enger zueinander. Rasch kam Mahanael mit dem Seil zu Hilfe, legte es um das Handgelenk, das auch Athanor umklammerte, und schlang es blitzschnell zu einem Knoten, wie ihn nur Seemänner beherrschten.
Widerstrebend ließ Athanor los. Schnell rollte er sich zur Seite, falls Mahanaels Knoten doch nicht hielt. Aber der Elf verstand sein Handwerk. Mit einem Ruck zog er die doppelte Schlinge zu und band Sethons Arme damit fest aneinander. An Händen und Füßen gefesselt, wand sich der Untote am Boden. Sich aufbäumend versuchte er, nach Mahanaels Beinen zu stechen. Hastig wich Nemera vor ihm zurück.
»Es gibt nur einen Weg, dem ein Ende zu machen.« Athanor packte das in der Nähe stehende Kohlenbecken beim dreibeinigen Ständer und schüttete den glühenden Inhalt auf den Wiedergänger aus. Sofort sprangen Flammen auf. Dampf quoll aus den Ritzen der brüchigen Haut, und der Untote zappelte wilder denn je. Athanor klemmte ihn unter dem Kohlenbecken fest, lehnte sich mit seinem Gewicht darauf, damit es der Nekromant nicht abschütteln konnte. Zu oft hatte er gesehen, wie Wiedergänger das Feuer erstickt und sich erneut erhoben hatten.
Stumm standen alle, die sich auf dem Dach befanden, um ihn herum und sahen mit Grauen zu, wie sich der Leichnam in den Flammen wand. Nur Rhea hatte sich unter einem der niedrigen Tische verkrochen. Es dauerte quälend lang, bis der Wiedergänger aufhörte zu zucken. Kaum mehr als die Knochen war übrig geblieben. Es stank so stechend nach verbranntem Haar, dass Nemeras Zofe würgte. Erst jetzt wagte Athanor, von Sethon abzulassen.
»Es … es tut mir leid«, stammelte Laurion. »Ich wusste nicht, dass Untote zaubern können.«
Athanor nickte. »Er hat uns alle getäuscht.« Und wie hättest du ihn schon aufhalten können? Er war der Schlimmste von allen.
Sichtlich erschüttert blickte Nemera auf die Klinge hinab, die neben den Knochen lag. »Das ist Hamons Dolch. Der Dolch, mit dem ich Sethon umgebracht habe.«
»Wahrscheinlich wollte er sich rächen«, schätzte Athanor und betastete seinen zerkratzten Hals. »Aber nun ist es vorbei.«
»Nein«, sagte Rhea leise unter dem Tisch hervor. »Er ist hier. Und er will nie wieder fortgehen.«
* * *
Chria glitt auf leisen Schwingen durch die Nacht. Im Mondlicht breiteten sich die Wälder der Elfenlande wie dunkles Moos unter ihr aus. Die fahle Scheibe war hell, beinahe wie immer, und doch bemerkte die Harpyie den Schleier, der wie kaum wahrnehmbarer Dunst zwischen ihr und den Gestirnen hing. Das Antlitz Hadons, des dunklen Gotts, spiegelte nicht länger ungetrübt das Licht seines Bruders Aurades. Zu viele Nächte hintereinander hatte sie es gesehen, um noch an eine Laune des Wetters zu glauben. Ein Vorbote. Doch für was?
An dem Riemen, den sie im Schnabel trug, ruckte es. Wärme und ein verlockender Duft stiegen auf. An jedem Ende hing eines der Farnhühner, die den Faunen in die Schlingen gegangen waren, und sie am Leben zu lassen, war eine Qual. Die meiste Zeit rührten sie sich nicht. Sie hatten sich längst in ihr Schicksal ergeben. Doch von Zeit zu Zeit kehrte ein Funken Lebenswille zurück, und sie flatterten, wenn auch nur noch schwach.
Chria stieß einen unwilligen Laut aus, den der geschlossene Schnabel dämpfte. Der Drang, die Krallen in diese zappelnden, raschelnden Federbündel zu schlagen, packte sie wie eine Windböe. Quälte sie mit Erinnerungen an frühere Beute, deren Leben unter ihren Klauen zerronnen war. An die Lust, den Schnabel in frische Eingeweide zu tauchen und einen blutigen Brocken herauszuzerren. Mühsam kämpfte sie dagegen an. Diese Gabe war nicht für sie bestimmt.
Vor ihr kamen im Zwielicht die Heiligen Acht in Sicht. Die gewaltigen Bäume bildeten die Ecken der großen Halle Ardareas, und ihre silbrigen Kronen dienten als Dach. Wenn die Elfen aus der Sippe Ardas Häuser errichteten, bezogen sie bis heute kleinere Nachkommen der Acht in die Gebäude mit ein und ließen sich von ihnen gegen Sonne und Regen beschirmen. So ähnelte ihre Stadt einem mit Lichtungen durchsetzten Wald.
Um nicht gesehen zu werden, schwang sich Chria höher in den Himmel hinauf, denn Elfen schliefen wenig. Sie nutzen die ruhigen Stunden zu Müßiggang und Besinnung. In etlichen Fenstern schimmerte deshalb noch Licht. Eine Weile kreiste Chria über der Stadt und vergewisserte sich, dass niemand um Omeons Haus herumstrich. Es stand einsam und düster, als sei es verlassen. Als ob der Schleier vor dem Mond dort dichter wäre.
Lautlos landete Chria im Garten vor dem Haus und stakste zur Tür. Nervös sah sie sich dabei um. Am Boden fühlte sie sich unbeholfen und war sich ihres watschelnden Gangs bewusst. Sie hatte lange geübt, um die Unsicherheit vor den Elfen zu verbergen, aber über einem Abgrund, in den sie sich rasch fallen lassen und dann davonfliegen konnte, fiel es doch leichter als hier.
Als sie auf die Schwelle trat, klickten ihre Krallen auf dem Gestein. In der Dunkelheit kam es ihr verräterisch laut vor. Wieder sah sie sich um. Wenn sie jemand beobachtete, würde man Omeon unangenehme Fragen stellen, und noch brauchte sie den alten Widerling. Leise klopfte sie mit dem Schnabel an. Die Tür gab nach. Chria musste sie nur aufdrücken, um ins Haus zu gelangen.
Bei ihrem Eintreten hörte sie Omeons Gewänder rascheln. Er kam ihr entgegen, ein hoher, schlanker Umriss im nur vom Mondlicht erhellten Raum. »Willkommen, werte Freundin. Wie aufmerksam von Euch, mir ein Geschenk mitzubringen.« Gierig griff er nach dem Riemen und zog ihn ihr förmlich aus dem Schnabel. Die Farnhühner flatterten matt, als spürten sie die Nähe ihres baldigen Mörders.
»Ein kleines Zeichen unserer ’ertschätzung«, gab Chria zurück. Ohne Lippen konnte sie bestimmte Laute nicht formen und ließ sie einfach aus. Es war klüger, Omeon nicht daran zu erinnern, dass er von diesen Geschenken abhing wie ein Bach von seiner Quelle. Umso wirkungsvoller konnte sie diesen Trumpf ausspielen, wenn sie ein Druckmittel brauchte.
Während Omeon die Tiere nach nebenan trug, stakste Chria durch den zentralen Raum des Hauses, in dessen Mitte sich nach elfischer Sitte eine Feuerstelle befand. Die Glut darin war erloschen. Chria warf einen Blick durch eines der hohen Fenster in den Wänden, die aus schlanken, durch Magie aus dem Boden gewachsenen Steinsäulen und Baumstämmen bestanden. Die Abkömmlinge Ardas schätzten die Verbundenheit mit der Natur und verabscheuten die Glasfenster ihrer Verwandten aus der Blutlinie Piriths. Um Regen und Wind zu brechen, setzten sie nur kunstvolle Gitter ein.
»Wir sind allein«, versicherte Omeon. »Ich habe seit Sonnenuntergang hier gesessen und nichts Verdächtiges gehört.« Weder seine Robe noch der von Besuch zu Besuch kahlere Schädel hoben sich von den Schatten des Zimmers ab. Es war fast, als hätte sie einen Geist vor sich. Doch wenn er die Augen bewegte, glänzten sie im Mondlicht und bewiesen, dass er noch lebte. Noch. »Seid Ihr sicher? Was ich zu berichten habe, ist nur für Eure Ohren bestimmt.«
Kraftlos ließ sich Omeon auf die Bank fallen, die halbkreisförmig die Feuerstelle umgab. Chria legte den Kopf schief, um den Elf genauer zu betrachten. Er war alt, älter als jeder andere Elf zwischen den Trollhügeln und dem Fallenden Fluss, aber hatte er bei ihrer letzten Begegnung schon so gebrechlich gewirkt?
»Ihr könnt frei sprechen«, behauptete er. »Ich habe im Lauf der Jahre … gewisse Vorkehrungen getroffen, die mich vor ungebetenen Gästen warnen. Wie macht sich mein neuer Schüler? Hat er das geheimnisvolle Dion erreicht?«
»Er ist tot.«
»Hm. Das … ist ein wenig enttäuschend.«
»Davaron war sein ganzes Leben lang eine Enttäuschung«, befand Chria. »Wenigstens hat er sich am Ende als nützlicher Idiot erwiesen und Athanor tatsächlich über den Ozean gelockt.«
»Wenn auch anders, als Ihr es geplant hattet«, stichelte Omeon.
Obwohl er es im Zwielicht vielleicht nicht bemerkte, warf Chria ihm einen kalten, herablassenden Blick zu. »Meine Pläne zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch dann gelingen, wenn sich die Dinge unerwartet entwickeln.«
»Das müsst Ihr mir erklären. Ihr hattet doch so ehrgeizige Ziele für Elanyas ungeborenen Bastard.«
»Zweifellos wäre es besonders vorteilhaft gewesen, einen König auf Dions Thron zu setzen, der die Kaysarwürde der Menschen mit elfischem Blut vereint.« Seine Untertanen hätten ihm zu Füßen gelegen, gerade weil er eine Chimäre war, ein durch Magie entstandenes Mischwesen wie sie selbst, und doch einer von ihnen. »Mit den richtigen Beratern an seiner Seite wäre es leicht gewesen, ihn für unsere Zwecke einzuspannen.«
»Und was ist stattdessen geschehen, dass Ihr dennoch von einem Erfolg sprecht?«, hakte Omeon nach. Auch seine Stimme war seit dem letzten Zusammentreffen brüchiger geworden. Der Dunkle ließ sich anscheinend doch nicht beliebig lange zum Narren halten, bevor er sich eine Seele holte.
»Nun, Davaron hat Athanor nach Dion geführt, und nun haben sie ihn zum Kaysar ausgerufen – ganz, wie ich es vorgesehen hatte.«
»Er hat die Drachen besiegt?«, staunte Omeon. In gewohnt elfischer Arroganz hatte er prophezeit, dass Dion wie Theroia enden würde.
Sehr weit sind wir davon allerdings nicht entfernt. Chria war davon ausgegangen, dass der Große Drache Athanor rechtzeitig beistehen und das Volk Dions in größerer Zahl retten würde. Doch irgendein Narr hatte den Beschützer des Landes getötet und damit die verbündeten Drachen erzürnt. So dumm konnte wohl nur ein Mensch sein. Nach allem, was ihr die Schwestern aus den Donnerbergen berichtet hatten, wären die aufgebrachten Echsen beinahe davongeflogen. Erst die Fürsprache des Sohns des Großen Drachen hatte die meisten zum Bleiben gebracht. Doch das musste Omeon nicht wissen. »Er hatte den geplanten Beistand«, sagte sie nur. »Und unser Schwert.«
»Ausgezeichnet«, lobte der Alte. »Wann werdet Ihr ihn anweisen, den Turm für uns zu öffnen?«
»Läuft Euch die Zeit davon, dass Ihr es eilig habt?« Er sollte nicht glauben, dass sie keine ebenso spitze Zunge besaß wie er.
Omeon verschränkte lediglich die Arme und sah sie erwartungsvoll an.
»Er hat es bereits getan«, eröffnete sie ihm.
»So schnell? Aber Ihr sagtet doch …«
»Ich weiß, was ich gesagt habe«, fiel sie ihm ins Wort. »Natürlich musste ich davon ausgehen, dass er nach dem Krieg gegen die Drachen eine Weile brauchen würde, um seine Herrschaft zu festigen und ein neues Heer aufzustellen, bevor ich ihn um diesen Gefallen bitten kann.«
»Was hat Euch bewogen, Eure Meinung zu ändern?«
»Nichts!«, schnappte Chria und wandte sich ab. Dieser Punkt zählte zu den ärgerlichsten Eigenmächtigkeiten, die sich je einer ihrer Mitstreiter erlaubt hatte. Der verfluchte Sphinx hatte Athanor das Schwert mit großer Geste an den Hof in Ehala bringen sollen, um seinen Anspruch auf die Kaysarwürde zu unterstreichen. Wie sie von den Meermännern erfahren hatte, war Athanors Schiff jedoch von einem Seedrachen versenkt worden, weshalb sie ihn bewusstlos auf die Insel des Sphinx geschleppt hatten. Was danach geschehen war, wusste ihr niemand zu berichten. Fest stand nur, dass ihre dionischen Schwestern die Knochen des Sphinx in der Wüste vor dem Turm gefunden hatten. Und der Wächter, ein gewaltiger Riese, lag tot in der Nähe.
»Einer unserer Verbündeten hat sich nicht an den Plan gehalten und damit alles aufs Spiel gesetzt«, erklärte sie wütend. »Imeron sei Dank hat Athanor mehr Glück als Verstand und die Aufgabe allein gemeistert.«
»Allein? Gegen den Riesen und Rakkathor?«, krächzte Omeon. »Wollt Ihr mich zum Narren halten? Er ist nur ein Mensch!«
»Der Narr war der Sphinx!«, schimpfte Chria. »Athanor sollte beiden mit einem Heer begegnen. Er hätte sterben können, und unsere Pläne wären zunichte gewesen!«
»Könnte unser Freund nicht einen guten Grund für seine Entscheidung gehabt haben?«
»Glaubt Ihr, darüber hätte ich nicht nachgedacht?« Vor Zorn spreizte Chria die Nackenfedern. »Wie ich es auch drehe und wende, es gibt keinen! Entweder war er dumm und übereifrig, oder er wollte Imeron auf eigene Faust befreien, um seine Gunst zu gewinnen. Was auch immer es war, er hat seine verdiente Strafe dafür erhalten.« Die Vorstellung der bleichen Knochen im Wüstensand besänftigte sie ein wenig.
Omeon hob beschwichtigend die Hände. »Mäßigt Euch! Eure Stimme wird … ein wenig schrill, wenn Ihr Euch ereifert. Wir wollen doch kein Aufsehen erregen.«
Am Liebsten hätte Chria seine Ohren mit einem gellenden Schrei zum Bluten gebracht, aber sie beherrschte sich. Auch wenn die Kräfte des Alten offenbar nachließen, konnte er immer noch nützlich sein. »Dann reizt mich nicht!«, fauchte sie nur.
»Es fällt mir eben schwer zu glauben, dass dieser dahergelaufene Mensch zwei solche Gegner bezwungen haben soll.«
»Er hat zunächst nur den Riesen besiegt. Warum auch immer er Rakkathor entgangen ist, der Drache flog davon und schwang sich zum Anführer des feindlichen Drachenheers auf. Athanor tötete ihn erst in der Schlacht.«
Omeon nickte, als ob ihm diese Erklärung genügte. »Dann steht uns der Turm also offen. Wer hätte gedacht, dass wir am Ende von den Ränken der Drachen profitieren würden … Habt Ihr auch schon einen Plan, wie wir jetzt vorgehen?«
»Mir wäre wohler, wenn ich wüsste, was hinter dem Feldzug der Drachen steckt«, gestand Chria. »Glaubt Ihr etwa, dass es hier nur um Rache geht?«
»Den Drachen? Sicher. Sie handeln stets aus den niedersten Motiven. Aber wenn Ihr es so andeutet, ja, es wäre nicht abwegig zu glauben, dass sie jemand aufgestachelt hat, um sie für seine Zwecke zu benutzen.«
»Aber wer könnte das sein?« Chria war nicht sicher. Es gab viele Götter und noch mehr halbgöttliche Wesen, die seit jeher im Wettstreit um die Macht über Ardaia lagen. »Habt Ihr irgendwelche Anzeichen bemerkt?«
Nachdenklich rieb sich der Elf das Kinn. »Doch, ich habe etwas bemerkt. Ich spreche nicht gern über … gewisse Rituale …«
Und ich bin nicht erpicht darauf, viel darüber zu hören, erwiderte Chria im Stillen. Sie wusste, dass es heuchlerisch war. Ob sie Beute schlug, um zu fressen, oder er tötete, um mit dem Blut sein erbärmliches Leben zu verlängern, spielte für die Opfer keine Rolle. Und doch trieb ihr das Wissen um sein Tun ein Schaudern über den Rücken.
»Die Wirkung hat nachgelassen«, gestand er. »Seit ein paar Monden hält sie nicht mehr so lange an wie zuvor. Ich muss sie in immer kürzeren Abständen wiederholen, sonst erlebe ich Imerons Rückkehr nicht mehr.«
»Könnte es denn nicht sein, dass nur … Eure Kräfte nachgelassen haben?«, fragte Chria gehässig. Nicht nur Drachen fanden an Rache Gefallen.
Omeon straffte die Schultern und reckte überheblich das Kinn. »Zügelt Euren Neid auf jene, die über Magie verfügen, und kommt zur Sache zurück! Wir müssen das weitere Vorgehen planen.«
»Wir können nicht weitermachen, als ob nichts wäre«, entschied Chria. »Die Toten erheben sich. Über den Himmel legt sich ein Schleier und trennt uns von den Kräften des Lichts. Irgendetwas hat sich verändert, und wir haben es – abgelenkt durch die Drachen – viel zu lange nicht bemerkt.«
»Ihr habt recht«, stellte Omeon fest. »Und eine Welt ohne Leben hat für Imeron keinen Reiz. Von uns ganz zu schweigen …«
»Wir müssen diese Entwicklung aufhalten!«, bekräftigte Chria. »Erst dann können wir uns wieder Imerons Befreiung widmen. Seid Ihr …« Skeptisch musterte sie den gebrechlichen Alten. »… in der Lage, nach Anvalon zu reisen? Ich will, dass Ihr nachlest, ob die Chroniken Eures Volkes von ähnlichen Vorgängen berichten.«
»Das wird nicht leicht«, gab der Elf zu. »Das Laufen fällt mir schon lange schwer. Aber ich werde einen Weg finden«, versprach er.
Das will ich hoffen. Sonst würde es mit den Geschenken, die ihm die Faune Imeron zu Ehren brachten, bald ein Ende haben. »Seid bei Euren Nachforschungen vorsichtig! Thuris starb beim Versuch, herauszufinden, was vorgeht.«
»Der alte Zentaur?«
»Er war der beste Schamane in unseren Reihen. Sein Tod könnte ein Zufall gewesen sein, doch darauf dürfen wir uns nicht verlassen. Leichtsinn ist der gefährlichste Gegner von allen.«
* * *
Schon lange hatte Athanor den Morgen nicht mehr so herbeigesehnt. Ungeduldig wartete er auf den Gesang der Drosseln, mit dem sie die Dämmerung begrüßten. Noch hörte er nur Laurions gleichmäßiges Atmen und das leise Wimmern, das Rhea manchmal im Schlaf von sich gab. Athanor kannte es von seinen Nachtwachen auf ihrem Marsch zur Küste. So tapfer das Mädchen tagsüber schien, in den Nächten holten es die Schrecken der Schlacht wieder ein. Oder träumte Rhea von Sethons Geist, der hier irgendwo im Zimmer lauerte?
Verfluchte Zauberer! Wie konnte Laurion seelenruhig schlafen? Bemerkte er den Blick des Toten nicht auf sich? Athanor glaubte, Sethons Gegenwart beinahe körperlich zu spüren. Es war zu kalt im Raum, die Luft zu dick. Bei jeder Regung fühlte er sich beobachtet. Wahrscheinlich ergötzte sich der verdammte Mörder daran, dass er ihn um den Schlaf brachte.
Obwohl Mahanael bei Mondaufgang aufgestanden war, um die Wache zu übernehmen, hatte Athanor kaum ein Auge zugemacht. Auch Nemera wälzte sich unruhig unter ihrer Decke. Athanor wusste nicht, wie er Rhea und ihr mehr Sicherheit geben sollte. Er konnte nicht mehr tun, als sie alle im Blick zu behalten, indem er sie in einem Raum schlafen ließ.
Hol’s der Dunkle! Wenn er ohnehin wach war, konnte er ebenso gut aufstehen. Barfuß ging er zu Mahanael hinüber. Der Elf lehnte am Türrahmen und sah auf den von Ruinen umgebenen Hof hinaus, der nur noch umgestürzte Säulen und verkohlte Sträucher beherbergte. Auf die Drosseln hätte ich lang warten können, erkannte Athanor. In ganz Sarna gab es keinen einzigen Garten mehr.
»Treibt dich die Drohung dieses Geists um?«, fragte Mahanael mitfühlend.
»Und ob. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass sich das Mädchen alles nur einbildet, aber …«
»Sie hat ihn als Einzige erkannt.«
Athanor nickte. Laurion hatte den Anstand besessen, Rheas Verdienst nicht als den eigenen auszugeben. Doch das war es nicht allein. Seit Rhea wie aus dem Nichts aufgetaucht war und den fliehenden Davaron zu Fall gebracht hatte, umgab sie etwas Rätselhaftes, das Athanor Respekt einflößte. Sie war nicht irgendein Kind. Wissentlich oder nicht – sie hatte ihm zu seiner Rache verholfen und keine Angst vor ihm gezeigt, obwohl er Davaron vor ihren Augen die Kehle aufgeschlitzt hatte. Wenn jemand unheimliche Fähigkeiten besaß, dann sie.
»Vielleicht kann sie mit ihm sprechen und ihn dazu bringen, sich in sein Schicksal zu fügen«, hoffte Mahanael.
Athanor schnaubte. »Der Dreckskerl hat Nemera seit Jahren bedroht. Er hat ihren Vater auf dem Gewissen und Hunderte Unschuldige abschlachten lassen, um sie gefügig zu machen. Glaubst du ernsthaft, dass er verschwindet, nur weil ihn ein kleines Mädchen darum bittet?«
Mit einer Geste mahnte ihn Mahanael, die Stimme zu dämpfen, damit sie die anderen nicht weckten. »Es klingt nicht, als könnte irgendetwas sein Herz erweichen, aber welche Wahl haben wir? Ich verstehe nichts von Geistern. Wir Elfen gehen ins Ewige Licht, oder unsere Seelen werden von den Jägern aus der Schattenwelt geraubt.« Bereits die Vorstellung ließ Mahanael schaudern.
»Wir Menschen mögen kein Ewiges Licht haben, aber Hol’s der Dunkle bedeutet genau das: Seine verfluchten Diener sollen die Toten ins Schattenreich bringen! Nur dann gehen sie nicht unter den Lebenden um. Seit wann erledigen sie ihre verdammte Aufgabe nicht mehr? Und vor allem warum?«
Der Elf nickte nachdenklich. »Ich mag nur ein Seemann sein, aber ich weiß, dass sich die Götter den niederen Wesen niemals erklären. Wir bedeuten ihnen nicht mehr als einem Fischer die Algen im Meer. Wenn wir Antworten wollen, müssen wir die Wahrheit selbst ergründen.«