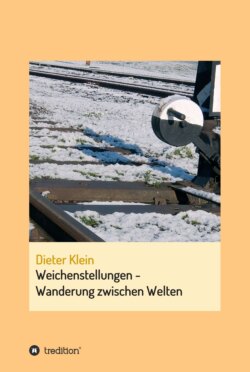Читать книгу Weichenstellung - Wanderung zwischen Welten - Dieter Klein - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Kapitel 1947 – 1954 Vertraute Nähe
Neunzehnter November 2017
Nasskalt draußen, die Hügel der Rhön zumeist im Nebel. Wo sie zu erkennen sind, hat der erste Schnee des bevorstehenden Winters Spuren gelegt. Der aus Fulda kommende ICE nimmt Fahrt auf, soll mich nach Leipzig bringen, wo ich den Regionalexpress nach Riesa erreichen möchte. Kilometer für Kilometer geht es in schneller Fahrt in die Vergangenheit. Ziel soll meine Geburtsstadt Mittweida sein.
Der Großraumwagen der Bahn ist nicht ganz besetzt, einige Fahrgäste sind in Bücher, andere in Zeitschriften oder in ihr Mobiltelefon vertieft, oder sie betrachten die vorbeifliegende Landschaft. Mich lädt bei wohliger Wärme das gleichförmige Rauschen von Fahrtwind und Rädern zum Dösen ein. Was soll man während der langen Reise anderes tun? Im Kopf beginnt es zu rattern.
Tack – tack / tack – tack / tack - tack
Die Eisenräder des Zugs knallen an jedem Schienenende auf den kleinen Spalt zwischen den Schienen. Das Stakkato des Interzonenzuges von Leipzig nach Frankfurt am Main verfolgt mich in tiefste Träume.
Die Wagen hatten in den frühen 50er Jahren viele enge Einzelabteile, die anfangs nicht durch einen Gang miteinander verbunden waren. Jedes Abteil war über seine eigenen Türen mit der Außenwelt verbunden. Im Abteil saßen sich die Reisenden auf zwei hölzernen Bänken gegenüber, über den Köpfen eingenetzt zumeist reichlich Gepäck.
Die Luft im Abteil stickig, abgestanden und die Hitze nur regulierbar über an beiden Außenseiten des Abteils angebrachte Fenster, jedes mittig horizontal geteilt. War einem nach Frischluft zumute, so musste man den am unteren Rand des oberen Fensters eingelassenen Lederriemen aus einem Dorn lösen, womit die obere Fensterhälfte in der unteren Wand bzw. in der Türverkleidung verschwand. Lediglich der Riemen schaute noch aus seinem Versteck heraus und musste kräftig gezogen werden, wollte man das Fenster wieder schließen. Mit Hilfe von Löchern, wie bei einem Gürtel, konnte man die Öffnung variabel am Dorn fixieren. Erst in den Interzonenzügen der späteren 50er Jahre hatten die Waggons durchgehende Gänge, von denen aus man die Abteile betreten konnte. Damit reichte es dann, an Anfang und Ende eines Waggons je zwei Türen für Ein- und Ausstieg zu haben. Unter den neuen Platzverhältnissen konnten sich nun zweimal drei Reisende auf Kunststoff bezogenen Sitzen in die Gesichter schauen.
1947 – 1954: Die ersten Jahre sind die schwersten
Glück prägte die Kindheit, wobei ich mir dieses erstrebenswerten Zustandes gar nicht bewusst war. Es ist eine spätere Einschätzung. Worin bestand das Glück? Es war trotz gelegentlicher Konfliktsituationen das Gefühl des Einsseins mit der Umgebung, mit Stadt und Landschaft, mit Freunden, Eltern, Verwandten. Bemühungen um alltägliche materielle Notwendigkeiten, wie Arbeitsplatz, Nahrung oder Kleidung, waren einem als Kind fremd, konnten lediglich im reiferen Alter zu Beunruhigung führen. Der geneigte Leser mag berücksichtigen, dass auch die Bedeutung von „Glück“ sich im Laufe der Jahre wandelte, zumindest wenn es – wie es heute erscheint - vorwiegend materiell definiert ist. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass man in allen sozialen Schichten, historischen Epochen, kulturellen Phasen, in allen Ethnien jeglichen Zivilisationsgrades glücklich sein kann. Das Vorhandensein von Glück und Unglück wird sehr häufig von Menschen späterer Zeiten aus der Position ihrer gesellschaftlichen Eingebundenheit festgestellt. War eine in purem Luxus lebende und von den Eltern zur Heirat gezwungene Prinzessin von zwölf Jahren glücklich? Oder der ebenfalls zwölfjährige Sohn eines armen Bauern unglücklich, weil tagtäglich harte Arbeit verrichten musste? Jede Epoche und jeden Menschen muss man aus deren speziellen Bedingungen heraus verstehen und beurteilen. So werden sich Kinder heute vielleicht darüber wundern, dass jenseits von Smartphone und Playstation jemals Glücksgefühle entstehen konnten. Und man könnte auch darüber nachdenken, warum Menschen in deutlich ärmeren Ländern zuweilen lachend und glücklich in Kameralinsen blicken.
Vater und Sohn er
Der Geburtsort ist entscheidend für das Heimatgefühl des Menschen. Die ersten Eindrücke auf dem noch unbeschriebenen Blatt der Kindheit bleiben Richtung weisend für spätere Eindrücke. Ganz sicher kann man sich sein, dass meine Eltern trotz großer Sorgen glücklich waren, als ich in entbehrungsreicher, sehr frostiger Winterzeit im Dezember 1947 in der Melanchthonstraße 6 von Mittweida gesund zur Welt kam. Schlägt man im Internet unter „1947“ nach, so stößt man auf folgenden Eintrag:
„'Deutschland, Deutschland ohne alles. Ohne Butter, ohne Speck. Und das bisschen Marmelade frisst uns die Besatzung weg' - so dichtet der deutsche Volksmund zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg das Deutschlandlied um. Die Versorgungslage ist schwierig. Am 30. Dezember 1947 (also einen Tag nach meiner Geburt, d. Verf.) zieht das "Westdeutsche Tageblatt" eine bittere Bilanz: "Betriebsschließungen wegen Kohlemangel, Viehabschlachtungen aus Nahrungsmangel für Mensch und Tier, Überfälle auf Kohlezüge und latente Ernährungskrise, … Demontage und Reparationen, dazu Kälte und Dürre - kurz: ein immer schärferer Kampf um das nackte Überleben, das war das Jahr 1947.1
Ich freilich merkte von jenen Existenznöten nichts, aber war gewiss ebenfalls wenig glücklich, den Rundumschutz des mütterlichen Leibes verlassen zu haben, und schrie diesen Unmut in sächsischen Frost hinaus - ob im passenden Dialekt, ist nicht mehr zu klären. Sorgenfrei war die Freude der Eltern allerdings nicht, galt es doch, den neuen Erdenwurm in seinem sozialistischen Windel- Kokon angesichts schwieriger Versorgungslage durch den extremen Winter zu bringen. Zum Glück gab es die große Verwandtschaft meines Vaters, die auf Dörfern der Umgebung, in Topfseifersdorf, Grünlichtenberg, Kockisch wohnend und wirtschaftend, ebenso hilfreich mit Notwendigstem unterstützte wie die gerade aus ihrer sudetendeutschen Heimat vertriebene Großmutter mütterlicherseits, die aus dem neuen, fern in Hessen gelegenen Zufluchtsort Altenmittlau nach Sachsen angereist gekommen war.
Noch schwieriger ist die Sachlage bei der Frage, welchem Staat ich zugerechnet werden müsste. Das Deutsche Reich war 1945 erloschen, die beiden Nachfolgestaaten DDR und BRD wurden erst 1949 ausgerufen. War ich da- mit staatenlos oder Bürger der Sowjetischen Besatzungszone, die allerdings kein Staat war? Ein Zoni? Wie dem auch sei: Ich kann die juristische Frage nicht klären und machte mir damals garantiert darüber keine Gedanken, obwohl genug Zeit dafür gewesen wäre.
Früheste Erinnerungen ankern in meinem 5. Lebensjahr, vielleicht auch früher. Da gab es einen hochgewachsenen Mann, den das Kriegsende aus dem Sudetenland nach Stuttgart verschlagen hatte und der nun als Gast meiner Eltern mich wie Christophorus das Jesuskind auf seinen breiten Schultern von Lauenhain nach Mittweida trug - immerhin ein paar Kilometer. Eine andere Erinnerung betrifft den ersten Spielplatz: Es gab den schmalen Hofgang zwischen Haustür und Melanchthonstraße, vorbei an zwei Arkadenbögen, auf denen die darüber liegenden hölzernen Balkons des Hauses ruhten. Bei schlechtem Wetter war der Platz unter den Arkaden ideal, bot er mit einem kleinen Sandhaufen doch einen regengeschützten Platz zum Spielen.
Bei wärmerem und besserem Wetter waren es die gegenüberliegenden großen Rhododendronbüsche, in denen ich erste Kletterübungen durchführte oder in deren mit Gras bestandenem Schatten sich auf einer Decke gut spielen ließ. Nicht nur mit den begehrten Glasmurmeln spielten wir Kinder, zu denen später auch mein Bruder Günter gehörte, sondern auch mit Peitsche und Holzkreisel - und mit Bleisoldaten und Militärfahrzeugen der vergangenen NS-Zeit, was die Eltern vergeblich zu unterbinden suchten.
Das Revier
Zugang zur Melanchthonstraße 6
Die Melanchthonstraße, in deren Nr. 6 sich der größte Teil meiner Kindheit ereignete, war damals ein ruhiges, kleines und - wie damals üblich – gepflastertes Verbindungssträßchen zwischen der Lutherstraße - und der Leisniger Straße, alle drei so schwach befahren, dass nahender Lärm von Auto-, LKW- und Motorradmotoren uns Kinder neugierig aus den Höfen an den Straßenrand sog. Dröhnend, durch ihre eigenen Rußwolken die Lutherstraße heraufschnaufende Lastkraftwagen, darunter auch mit Holzgas betriebene, sind mir ebenso in Erinnerung geblieben wie einige Personenkraftwagen (IFA F8, Opel P4, Hanomag) und vor allem Pferdefuhrwerke, die den Anstieg im Winter bei Schnee und Eis kaum schafften. Es kam vor, dass ein Pferd ausrutschte oder vor Erschöpfung zusammenbrach und erst nach etwas Ruhe, aufmunternden Worten und Peitsche von den Fuhrleuten zur Wiederaufnahme seiner Arbeit bewegt werden konnte.
Unangefochtenes Zentrum der Kinderspiele jener Frühzeit war der Huckel, wie das große Wiesengelände hieß, das sich am unteren Ende der Melanchthonstraße wie eine rechteckige Pfanne in einer Senke erstreckte, auf der einen Längsseite die verlängerte Lutherstraße mit dem Elektrizitätswerk, das wir nur als "Eltwerk" kannten, und dem hübschen Jugendstilhaus der Familie Horn. Auf der gegenüberliegenden Seite Felder. Hier traf sich zu allen Jahreszeiten fast die gesamte Kinderschar der Umgebung, genauer gesagt, die Jungs. Im Winter konnte man mit dem Schlitten von den weiter oben liegenden Feldern den Hang in die tieferliegende Wiese hinab rodeln, allein, zu zweit oder in einer Bob-Formation. Später durfte ich dafür und für die ersten Sprungübungen die Holzski meiner Mutter mit Lederriemenbindung benützen - bis eines Tages bei einem Sturz das hintere Ende eines Skis verloren ging. Es dauerte bis zum nächsten Weihnachtsfest, bis ich stolz ein paar neue Bretter mein Eigen nennen durfte. Im Sommer diente die Wiese einer Kuhherde als Weide. Dass diese an allen Seiten durch Böschungen begrenzt war und durch sie hindurch ein Bächlein lief, das an der tiefsten Stelle in einem Gitterrost verschwand, um unterirdisch dem Kanal der Lutherstraße zugeführt zu werden, bereitete uns Kindern besondere Freude. Denn wenn man geschickt vorging, konnte man im Bach Stichlinge fangen, allerdings auch die weniger beliebten Blutegel an den Beinen hängen haben. Besonders interessant war das Verstopfen des Bachauslaufs. Wann immer wir das machten, geschah es gegen Abend vor dem Nachhausegehen. Anderntags standen die stoischen Wiederkäuer muhend bis zum Bauch im Wasser. Ob sie das angesichts heißer Sommer immer als Glück schätzten oder dann nur Magermilch produzierten, vermag ich nicht zu sagen. Dem Bauern jedenfalls gefiel's ganz und gar nicht, und er jagte uns, sobald er einen der Jungs innerhalb seiner vom Weidezaun markierten Kuhwiese erspähte. Überhaupt jener Zaun: Er konfrontierte uns Kinder der Ingenieurstadt Mittweida erstmals mit den Gesetzen der Physik, mit der unsichtbaren Kraft des Stroms, die uns zwar fernhalten sollte, aber bald ihren Schrecken verlor und uns magisch anzog. Einer aus unserer Schar empfand die zuckenden elektrischen Impulse sogar als angenehm, was kindlichen Forscherdrang beflügelte: In einer Kette mehrerer sich an den Händen halten- der Kinder berührte der Erste den Zaun, was für den Letzten in der Kette zum wahrlich umwerfenden Ereignis gedieh. Bald wussten wir unsere Entdeckung der Sichtbarmachung von Strom gegenüber allen physikalisch ungebildeten Mitmenschen heimtückisch einzusetzen. Learning by doing, würden wir heute sagen. Nach der Ernte mutierte der Huckel allherbstlich mit den angrenzenden Feldern, die zuvor mit den Eltern sorgfältig nach liegengebliebenen Kartoffeln abgesucht worden waren, zum Flugplatz selbst gebauter Drachen. In aller Regel waren sie von viereckiger Form, doch präsentierten einige Jungs auch stolz sechseckige Fluggeräte. Selbst die Erwachsenen ließen sich begeistert vom alljährlichen Drachenfieber anstecken. So baute mein Vater mit Herrn Kirchhübel von gegenüber einen großen Kastendrachen, der dank einer Batterie gespeisten Taschenlampe die ganze Nacht über vom Himmel grüßte.
Mädchen spielten für uns Jungen, die wir uns stolz als
„Bande“ fühlten, keine große Rolle. Da ist mir nur eine Christel in Erinnerung, die gelegentlich Babysitterdienste verrichtete, wenn meine noch jungen Eltern abends ausgingen, oder die im Nachbarhaus wohnende gleichaltrige Ilona B., mit der nach dem Kindergarten die gemeinsame Schulzeit begann. Insgesamt spielte sich das Kinderleben hauptsächlich im Freien ab. In den wärmeren Monaten waren wir fast immer barfuß unterwegs. Erst nach dem dritten Frühlingsgewitter, so versicherte uns die Mutter, sei Barfußlaufen im Freien möglich. Heute kaum vorstellbar, barfüßig durch die Stadt zu rennen. Bei großer Hitze gern zur Eisdiele „Dal Asta“ wo, es für einige Pfennige eine Kugel in der Waffeltüte, zwei Kugeln zwischen zwei aufeinanderliegenden Waffel-Halbschalen gab.
In den Wintermonaten freilich war's zu kalt dafür. Da gab es je nach Wetterlage entweder lange Hosen, sonntags Knickerbockerhosen und grundsätzlich lange Strümpfe. Diese von den Eltern an kühlen Herbsttagen bis ins noch kühle Frühjahr hinein verordneten Beinkleider liebten wir nicht. Sie wurden eng über die Beine bis zum Oberschenkel hochgezogen und dort mittels zweier Klemmen am Strumpfhalter befestigt, einer Art Korsett, das um die Hüfte lag und „Leibchen“ hieß. Oftmals gaben die Klemmen nach, die Strümpfe rutschten runter und behinderten den natürlichen Bewegungsdrang erheblich. Stabile, schützende und höhere neue Schuhe gab es oftmals nur über Beziehungen und nach langer Wartezeit.
mit Günter als Sozius
Unbestrittener Höhepunkt des Jahres war das Weihnachtsfest gewesen. Das begann schon mit den Vorbereitungen. Päckchen von der nach dem Krieg in Westdeutschland und in Wien gestrandeten mütterlichen Verwandtschaft trudelten ein. Ein Teil des wertvollen Inhalts diente der Herstellung der obligatorischen Weihnachtsstollen, wie Rosinen, Mandeln Zitronat. Unsere Mutter brachte alles zum Bäcker Böhme in der Leisniger Straße, von wo wir nach wenigen Tagen mit dem Handwagen alljährlich die schwere Stollenpracht abholten. In einem Jahr allerdings fehlten dem uns bis ins Frühjahr hinein begleitenden Backwerk die Rosinen. Mein Bruder und ich hatten die Schüssel, in denen sie vor dem Gang zum Bäcker in Rum lagerten, entdeckt und alles komplett vertilgt. Das gab Ärger und in diesem Jahr Stollen light.
Der größte Teil der Westpäckcheninhalte lag unterm Weihnachtsbaum. Diesen bekamen wir Kinder nicht vor dem Heiligabend zu sehen. Überhaupt jener alljährlich mit dem Flair von Geheimnis und Zauber umhüllte 24. Dezember! Vormittags schickten die Eltern uns Kinder zum Spielen auf die Straße. Bei Regenwetter freilich blieben wir zuhause. Aber nur in der Küche, wo bald der Geruch von Bratwürsten und Linsenbrei die Luft durchzog, während mein Bruder und ich, um in der allgemeinen Enge nicht im Wege zu stehen, unter dem Tisch spielten. Das Wohnzimmer war bis zum Abend verbotenes Territorium, weil da das Christkind beim Schmücken des Baums keine menschlichen Blicke duldete. Selbst das Schlüsselloch war gegen eventuelle Spionage verhängt. Unser Vater war zu dieser Zeit, in der das Christkind emsig im Wohnzimmer werkelte, nie zuhause und tauchte erst vor dem Abendessen wieder auf. Am Heiligabend schmeckte, weil das Mittagessen regelmäßig ausfiel, das Bratwurst-Linsenessen doppelt gut. Auch weil wir wussten, dass danach die feierliche Bescherung folgen würde. Festlich gekleidet standen dann Vater, Mutter, Bruder und ich vor der Wohnzimmertür. Vater öffnete die Tür: Ein prachtvoller, bis an die Decke reichender Weihnachtsbaum, dicht behängt mit silbern spiegelnden, feinen Glaskugeln, Glöckchen, Süßigkeiten und ganz viel Lametta, das die brennenden Kerzen reflektierte und für offene Münder, für Ah! und Oh! sorgte. Das Anzünden und Ausblasen der Kerzen war nur in den erreichbaren Höhen problemlos möglich, für die höheren Regionen stand ein Blasrohr bereit, auf das man beim Anzünden eine brennende Kerze steckte. Seit einer Beinahekatastrophe, wo die gesamte Pracht in die Gardinen strauchelte, stand auch stets ein Wassereimer bereit. Unter dem Weihnachtsbaum für uns Kinder Schokolade, Strümpfe, Anorak, Nüsse, eine Dose Nivea-Hautcreme und die immer gleiche Schneelandschaft aus Pappe, inwendig von einer Kerze zum Leuchten gebracht. Der leibhaftig erscheinende Weihnachtsmann zauberte im Laufe der Jahre, nachdem er ein Gedicht gehört und das Versprechen bekommen hatte, im nächsten Jahr recht brav zu sein, für uns Kinder wahre Wundersachen aus dem großen Sack: einen Stabilbaukasten, eine Holzfeuerwehr, eine elektrische Eisenbahn. In lebhafter Erinnerung ist mir ein Weihnachtsfest, an dem er mir mit einem Paar schwarzer Gummistiefel aus Igelitt Freudenschreie entlockte, in den Schäften Walnüsse, Pfefferkuchen und ein Paar Strümpfe. Der Igelitt-Geruch steht mir noch heute in der Nase. Das gemeinsam empfundene Glück - sichtbar an meinen leuchtenden Augen und der Freude der Eltern über meine Begeisterung - endete jedoch jäh nach wenigen Tagen. Schnell hatte ich bemerkt, dass das wertvolle neue Schuhwerk einen erheblichen Fehler aufwies: Eine starke Profilsohle verhinderte den eigentlichen Zweck, den ich darin sah, mit den Spielkameraden die etwa 300 Meter Melanchthon- und Lutherstraße auf schneeglatter Bahn hinunterzurutschen. Kurzum: Allein in elterlicher Wohnung setzte ich den Gasherd in Gang, brachte eine Messerschneide zum Glühen und operierte das störende Profil sauber weg. Nun teilten die Eltern die Freude über mein neues Rutschgerät unverständlicher Weise nicht mehr. Es setzte ein Paar hinter die Ohren oder war es mit dem Ochsenziemer auf den Hosenboden oder Hausarrest???
Stets beendete die um Mitternacht beginnende Christmette am anderen Ende der Stadt diesen aufregenden Tag, dem wir schon seit Monaten entgegengefiebert hatten. Irgendwann in meiner reiferen Kindheit kam das Gerücht auf, es gäbe den Weihnachtsmann gar nicht. Faktencheck. Ich sagte, obwohl ich es gelernt hatte, das obligatorische Gedicht nicht auf und war auch nicht zum Versprechen eines weiteren Unterwürfigkeitsjahres bereit. Seine Drohung, mich in den Sack zu stecken und in seinem Schlitten mitzunehmen, reizte mich. Wusste ich doch, dass draußen gar kein Schnee lag. Im Hausflur hörte ich - im Sack gespannt der Dinge harrend - die Eltern aufgeregt mit dem Weihnachtsmann brabbeln. An der Haustür durfte ich aus dem Sack krabbeln und erkannte unseren Nachbarn, den lieben Herrn K.. Ende einer Illusion.
Ein aufregendes Abenteuer ergab sich, als unsere „Huckelbande“ wieder einmal an den Steilhängen der Zschopau zwischen der Mittweidaer und der Lauenhainer Aue herumkraxelte. Wir hatten bei unseren Streifzügen in diesem wegen der Felsen und steilen Hänge nicht ungefährlichen Gebiet bemerkt, dass es einen alten Trampelpfad gab, der vermutlich noch aus Kriegstagen stammte und zu reger Spekulation Anlass gab. Ob man dort Waffen und Munition finden könnte? Wir fanden. Aber kein Kriegsgerät, sondern mitten auf dem Pfad hing aus dem großen Astloch eines hohlen Baumes in etwa einem Meter Höhe der Schwanz eines Fuchses heraus. Im nächsten Moment sahen wir seinen Kopf herauslugen, der aber sofort wieder verschwand. Fast gleichzeitig kam Meister Reinecke zwischen den Baumwurzeln hervor und verkrümelte sich im Wald. Unsere Neugier war geweckt, denn was hatte der Fuchs in einem Baum zu suchen? Zu unserer großen Überraschung erblickten wir im Baumloch fünf süße Fuchsbabys. Da die Mittweidaer Fuchsfarm nicht weit entfernt lag, rannten drei der unseren sofort dorthin, wir anderen beiden hielten tapfer Wache am ungewöhnlichen Fuchsbau. Nach kurzer Zeit erschien ein Mitarbeiter der Fuchsfarm und steckte drei Rotfuchsbabys in einen mitgebrachten Sack. Als wir Kinder tags darauf kontrollierten, was mit den verbliebenen zwei Füchslein geschehen war, war das Nest leer. Mutter Fuchs hatte sie vermutlich geholt und in Sicherheit gebracht. Für uns hatte das Ganze unerwartete Folgen: Die Fuchsfarm war für uns bislang nur eine übel stinkende Anlage gewesen, bei deren Passieren man tunlichst die Luft an- und die Nase zuhielt. Wo man ohne Atem möglichst weit kommen wollte, um dem vorzeitigen Stinketod zu entgehen. Jetzt war alles anders: Als tapfere Fuchsfänger wurden wir hineingebeten und durften fortan jederzeit dort auftauchen und mithelfen. Was uns mächtig stolz machte. Galt es doch, frisch vom Schlachthof geholte ganze Schweine in Fresshäppchen für die vielen Füchse auseinander zu hacken und zu schneiden. Im häuslichen Wohnzimmer hätten wir derart anrüchige Freuden niemals erleben können. Soweit ich weiß, hat aber trotz dieses Anschubs keiner von uns die Chirurgie- oder Pathologielaufbahn eingeschlagen. Und gestunken hat uns die Fuchsfarm seitdem auch nicht mehr.
die junge Familie im Fabrikgarten
Gefühlt allsonntäglich war ein Spaziergang mit den Eltern zu bewältigen, für den nach heutigem Maßstab der Begriff „Wanderung“ eher angemessen wäre. Denn wir gingen nicht nur die vier Kilometer ins idyllische Waldhaus an der Zschopau oder ins Flussschwimmbad der Mittweidaer Aue hin und zurück, sondern auch schon mal die ca. elf Kilometer nach Topfseifersdorf zu Vatis Geschwistern Lotte und Hubert. Der Rückweg freilich war nach legendärer Kaffeetafel im Wohnzimmer oder - wann immer möglich – im Garten zwischen frei grasenden Ziegen und Hühnern nur noch motorisiert zu schaffen, entweder mit einem aus Mittweida herbeigerufenen Taxi oder mit zumeist Onkel Fritz und Tante Frieda, die uns mit ihrem IFA (einem DKW-Nachbau) nach Hause brachten. Überhaupt diese beiden: In Onkel Fritz' Küchenmöbelfabrik am Ende der Leipziger Straße von Mittweida hatte meine Mutter als junge Frau am Ende der 30er Jahre ihre erste berufliche Anstellung gefunden. Dafür war sie nach der Ausbildung in Freudenthal (heute Bruntal) aus ihrer Heimat, dem Dorf Lobnig im Sudetenland in der heutigen Tschechischen Republik, von Freunden, Eltern und Bruder weg nach Sachsen umgezogen. Noch lange nach ihrem frühen Tod im Jahre 1979 sprachen die Nachfahren von Fritz und Frieda Oehme in höchsten Tönen von ihrer Arbeit, davon, dass die damals gut 20 Jahre junge Frau mit ihren betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten die in finanzielle Schieflage geratene Firma gerettet habe. Sogar eine Möbelkollektion hatte sie entworfen, die nach ihr „Anni“ benannt und zum Verkaufsschlager wurde. In ihre lebenslang handlungsbestimmende Pflichtauffassung und Selbstdisziplin brach die erste Liebe herein. Denn im Clan der Topfseifersdorfer Naumann-Klein-Familie, dem auch Frieda Oehme entstammte, fühlte sie sich äußerst wohl. Und irgendwann - wie Zeitzeugen berichteten, nicht ohne äußeren Anschub - kamen sich Josef Klein und Anna Dittrich näher, verliebten sich ineinander und heirateten noch während des Krieges. Für mich als Nachkriegsgeburt bedeutete dies, dass ich schon im Kinderwagen sehr oft im Oehmeschen Garten hinter der Fabrik geparkt wurde. Die Zugehörigkeit zu jener weit verzweigten Familie brachte uns Vorteile, die ich als Kind erst in späteren Jahren würdigen und schätzen konnte: Ob von den Bauernhöfen von Fritz Naumann in Kockisch, von Herbert Voigtländer in Grünlichtenberg, Hubert, Lene und Lotte Klein in Topfseifersdorf oder dem weitläufigen Obst- und Gemüsegarten der Küchenmöbelfabrik mit seinen darin grasenden zwei Schafen - die kargen, durch Lebensmittelkarten begrenzten Nahrungsmittelrationen jener Zeit erfuhren eine wichtige Ergänzung, um zwei hungrige Kindermäuler satt zu bekommen.
Längere Ausflüge als nach Topfseifersdorf oder Grünlichtenberg waren äußerst selten. Nahe Ziele, wie Dresden und Chemnitz, gerieten zu tagesfüllenden Reisen und prägten sich damit besonders ein. Wie eine Tagesreise ins noch immer in Trümmern liegende Dresden, wo wir eine Frau besuchten, deren Bezug zu unserer Familie unklar bleibt. Mit dieser verhärmt aussehenden Frau mit Kopftuch und Kittelschürze gingen wir durch das Zentrum, beiderseits der Straße Ruinen und Steinberge und mitten durch das dunkle Grau hindurch eine helle Straßenbahn. Nahmen Kinderaugen schon dieses Gefährt in dieser Umgebung als unwirklich wahr, so wurde es am Elbufer noch skurriler: Auf dem Wiesengelände nahe dem Fluss stand ein hell erleuchtetes Zirkuszelt.
Die Kinderkrippe, gar die Wochenkrippe, blieb mir dank home office unserer Mutter erspart. Sie konnte ihre Bürotätigkeit per Schreibmaschine vom Schreibtisch im Wohnzimmer verrichten. An Internet und Faxgerät war zu dieser Zeit noch gar nicht zu denken, ein Wählscheibentelefon stand nur wenigen Menschen zur Verfügung.
Freilich sehen Kinderaugen vieles anders als Erwachsene, die Verantwortung tragen für die täglichen Bedürfnisse eines Haushalts und einer Familie. So empfanden wir es als völlig normal und aufregend, mit den Eltern im Herbst auf abgeernteten Kartoffeläckern die nach bäuerlicher Lese liegen gebliebenen kleinen Kartoffeln zu sammeln, an Wegrainen und in Hecken Hagebutten und Holunderbeeren zu pflücken. Die Beeren verwandelte unsere Mutter zu leckerer Holunderbeerensuppe, zusammen mit den Hagebutten ergaben sie auch schmackhafte Marmelade. In späteren Jahren kam aus den Hagebutten gewonnener Fruchtwein hinzu, der, in einem großen Glasballon vor sich hin blubbernd, in der Küche heranreifte. Normal war auch, dass wir Fleisch nur an Feiertagen genossen, gelegentlich auch an Sonntagen. An besonderen Festtagen wurde Kalbsnierenbraten aufgetischt, und wenn Bratwurst mit Linsenbrei auf dem Teller lag, wussten wir, dass Heiligabend war. In den Zeiten dazwischen gab es Gemüse, Mehlspeisen, auf die sich meine Mutter mit habsburgischer Backtradition besonders verstand, wie Quarkkeulchen, Omelett, Grießbrei, Kaiserschmarrn, Suppen und Blutwurstscheiben auf Kartoffelbrei. Einen besonderen Genuss erlebten wir, wenn es Vater gelang, im Fischgeschäft am Markt einen Hering zu ergattern. Einmal im Jahr brachte er einen in Pergamentpapier gewickelten Schweinskopf nach Hause. Man glaubt kaum, was man aus einem Schweinskopf alles zubereiten kann. Weil es keinen Kühlschrank gab, musste alles auch in überschaubarer Zeit vertilgt werden. Da wurde der Kopf, aus dem nach einigen chirurgischen Eingriffen Teile als Braten aufgetischt wurden, mittels Handkurbel durch einen Fleischwolf gedreht. Aus Knorpel und Knochen, Weichteilen, Fett, Ohren, Schnauze entstand eine Masse, die, Kuchenteig gleich, in eine große Schüssel gefüllt, dort allmählich fest wurde und die ganze Familie über viele Tage hinweg als Schweinskopfsülze erfreute. Recycling pur - selbst der Name des Rüsseltieres war noch als Schimpfwort zu gebrauchen.
unser Wohnzimmer links neben dem Erker
Dass man Wünsche nicht sofort erfüllt bekam, war für uns Kinder - und vermutlich erst recht für die Erwachsenen - selbstverständlich. So gelang es meinem Vater nach einigen vergeblichen Versuchen erst im zweiten Jahr, für mich ein Paar Rollschuhe herbeizuzaubern, auf deren Eisenrollen ich lautstark über die Pflastersteine der Melanchthonstraße ratterte, was wegen häufiger Stürze nie verheilende Knie zur Folge hatte. Mit ca. 10 Jahren erhielt ich nach langen vergeblichen Bitten endlich das erste Fahrrad. Es war ein vom Vater im Keller sorgfältig restauriertes, knallrot lackiertes altes Herrenrad, mit dem ich seltener als mit den Rollschuhen hinfiel, dafür waren die Wunden größer. Es wurde mein ganzer Stolz, und es glänzte sogar mit Tachometer und Kilometerzähler. Noch im Wachsen begriffen, reichten meine Beine anfangs nicht von der Querstange bis zu den Pedalen. Diese konnten nur mit artistischer Körperverrenkung durch den Fahrradrahmen erreicht werden; dafür blieb in dieser Position der Sattel unerreichbar hoch.
Mit etwa 11 Jahren fuhr ich ganz allein auf unbefestigten, staubigen und tief zerlöcherten Straßen nach Topfseifersdorf, nach Grünlichtenberg und Burgstädt und zurück – für heutige Kinder angesichts des Straßenverkehrs und sonstiger Unwägbarkeiten undenkbar.
Doch nochmal zurück zum Haus in der Melanchthonstraße: Nicht nur, dass ich dort am 29. Dezember 1947 pünktlich zum Mittagessen, also kurz vor 12.00 Uhr, das Licht der Welt erstmals erblickte, sondern dieser Bau aus rotem Ziegelstein sollte bis 1961 fast ununterbrochen mein Zuhause bleiben, das heißt, selbst während der Ferienzeiten war wegen der sehr seltenen Möglichkeiten für Urlaubsfahrten dieses Haus und diese Wohnung Lebensmittelpunkt.
Betreten wir unsere Wohnung in der zweiten Etage: Vermutlich hatte sie früher mehr als unsere drei Zimmer umfasst, denn mit dem Hauseigentümerehepaar Ottinger teilten wir uns einen fensterlosen Flur, von dem aus weitere drei Türen in die uns Kindern verbotene Ottinger- Wohnung führten. Für die Annahme, dass es früher eine einzige große Wohnung gewesen war, spricht auch, dass es in unserem Wohnzimmer eine stets verschlossene Tür zu einem Ottingerschen Zimmer gab. Weil wir Tür an Tür wohnten, bemerkten selbst wir Kinder, dass das Eigentümerpaar selten anwesend war. War es der von uns ausgehende und zuweilen in den Flur verlegte Kinderlärm, über den sie sich gelegentlich beschwerten, der sie in ihr Elternhaus in Crossen trieb? Wenn ein Mitglied der über uns wohnenden Familie Brandt das Haus verlassen wollte oder heimkam, mussten wir Kinder eilends unsere Spielsachen von der Haustreppe räumen, Platz schaffen für große Füße in großen Schuhen. Lediglich Ursula, die schon erwachsene Tochter der Familie Brandt, balancierte durch unsere Spiellandschaften und stieg über uns Zwerge einfach hinweg. Sie gehörte zu den freundlichsten Bewohnerinnen, was nicht heißen soll, dass die anderen unfreundlich gewesen wären. Ihren Vater, einen Dozenten der Mittweidaer Ingenieurhochschule, sahen wir selten, dafür umso häufiger, aber ohne bleibende Erinnerung die Mutter. Ursula dagegen kam auch öfters in unsere Wohnung, wo Vati sie zwecks Herstellung von Kleidern und Kostümen sorgfältig vermaß.
Das Kinderzimmer musste ich nicht mit meinem Bruder teilen - es gab keins. Zu Schlafzwecken diente der ganzen Familie ein einziges unbeheizbares Zimmer mit Blick auf den Hof des Elektrizitätswerks. Neben einem breiten Ehebett an der linken Seite des Raumes stand, durch schmalen Gang getrennt, das Bett meines Bruders unter einem Fenster an der Außenwand. Mein Bett quetschte sich zwischen das Fußende des Ehebettes und die Wand zur Küche. Als mein Wachstum die Bettmaße überstieg, wurden wir weitblickender sozialistischer Fürsorge teilhaftig, denn wir erhielten ein zwar den Durchgang weiter schmälerndes, mich aber hoch erfreuendes, im Krankenhaus ausrangiertes altes eisernes Krankenbett. An eisigen Wintertagen stand beim Aufstehen der Atem vor dem Gesicht. Nur einige wenige Male öffneten die Eltern wegen der Polarkälte abends die Zwischentür zum Kachelofen beheizten Wohnzimmer, wobei dort erst die Couch wegzuschieben war.
Für dringende Bedürfnisse gab es auf der Halbetage des Treppenhauses eine stets verschlossene Holztür, hinter der sich ein Plumpsklo allen Hausbewohnern der unteren und der mittleren Etage anbot - ohne Wasserspülung, ohne Heizung, ohne Toilettenpapier. Letzteres musste man selbst mittels Schere und Messer zurechtschneiden, was der Tageszeitung „Volksstimme“ dauerhaft Abonnenten sicherte. Da saß man dann im Winter, drohte bei längeren Sitzungen auf der breiten Holzplatte festzufrieren, in deren Mitte sich ein mit einem Holzdeckel verschließbares Loch befand. Obwohl es darunter zunächst schräg, dann geradewegs nach unten ging und deshalb eigentlich wenig Wasserspülung notwendig gewesen wäre, war es absolute Pflicht, jedem Geschäft ausreichend Wasser hinterher zu schütten. Dieses musste in einer großen Blechkanne aus der Wohnung herangeschleppt werden. Das auf diese Weise in der Klärgrube sich ansammelnde Spülungswasser ermöglichte die mehr oder weniger reibungslose Absaugung der Grube. Einmal im Jahr war dies ein aufregend anrüchiges Erlebnis für uns Kinder, besonders wenn die bis zum Jaucheauto auf der Straße verlegten Schläuche undicht waren oder sich einzelne Bajonettverschlüsse lösten und das Getöse der motorbetriebenen Saugpumpe die unter Druck gleichmäßig in die Gegend verspritzten Hinterlassenschaften melodisch begleitete.
Von späteren Jahrgängen nicht mehr nachvollziehbar das fast elektrizitätsfreie Leben. In Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer gab es jeweils eine Deckenlampe mit einem Kippschalter neben der Tür. Einzig das Wohnzimmer wies zusätzlich zwei Steckdosen auf für eine Leuchte auf Mutters Schreibtisch und mittels Verteiler auch für das Radio. Fernsehen war völlig unbekannt. Erst in späteren Jahren gab es so etwas wie Fernsehen im städtischen Pionierhaus – für uns Jüngere auf den hinteren Stuhlreihen allerdings flimmerte nur etwas auf weit entfernter Bühne, das man weder genau erkennen noch verstehen konnte. In den letzten Jahren bot sich dieser Luxus gelegentlich in Schwarz-Weiß-Qualität in der Wohnung des Klassen-kameraden Hans Peter S.. Die zweite Wohnzimmer-steckdose war für Vati reserviert, wenn er abends bei der häuslichen Schneiderarbeit mit dem Bügeleisen hantierte. Wasser konnte man in der Küche aus einem Messinghahn zapfen, der über halbrundem Emaillebecken aus der Wand ragte. An diesem Becken unterm Hahn wurde auch die Morgentoilette erledigt, wurden Zähne und Gemüse geputzt, Hände gewaschen. Dicht daneben der Küchen-herd, der mit Holz und Braunkohle aus dem Keller seiner Bestimmung nachkam. Auf ihm wurde gekocht, gebraten und in seiner Röhre gebacken, er strahlte Wärme aus und sorgte mit seiner in die Herdplatte eingelassenen Wasserwanne für abgekochtes Trinkwasser. Aufregend wurde es, wenn unregelmäßig an Freitagen Badetag war. Ein großer Zinkbottich blockierte, nachdem der Küchentisch beiseite geschoben und er aus dem Keller in unsere Etage herauf geschleppt war, die Zimmermitte, gefüllt mit heißem Wasser. Zuerst absolvierten wir Kinder die Waschprozedur, und wenn wir anschließend bereits im Bett lagen, erfreuten sich die Eltern an und in der trüben Brühe.
Der düsterfeuchtkühle Keller des Hauses war uns Kindern gut bekannt, denn häufig mussten wir aus einem Verschlag Holz und Kohle für die beiden Öfen in Küche und Wohnzimmer holen, Äpfel und Birnen warteten auf Regalbrettern auf ihren auch im Winter möglichen Verzehr, wie übrigens auch Kartoffeln, die unaufhörlich keimten und deshalb regelmäßig kontrolliert werden mussten. Der Handwagen stand dort und mein feuerrotes Fahrrad. In einer Ecke des gemeinschaftlichen Kellerteils befand sich die Tür zur Waschküche, die nach festem Plan Tag für Tag von einer anderen Familie genutzt wurde. Wir waren freitags dran, was bedeutete, dass die Mutter nahezu ganztägig nur noch im dichten Wasserdampf dieses Waschsalons zu erahnen war. Heiß war's dort wie in einer finnischen Dampfsauna, denn in der Mitte des Raumes stand ein großer, von Feuer erhitzter Bottich fest gemauert in der Erden, in dem die Schmutzwäsche Bekanntschaft mit (fast) kochendem Wasser machte. Die mit einer Gummischürze über einem Trainingsanzug vor heißen Spritzern geschützte Mutter bearbeitete mit einem Wäschestampfer heroisch die Textilienmasse im brodelnden Wasser. (Warum kam mir viel später beim Anblick der Laokoongruppe immer unsere Mutter in den Sinn?) Die gewaschenen und triefnassen Teile wurden entweder auf der Leine im Hof aufgehängt, weiße Bettwäsche dagegen bleichte im Gras des Huckels in praller Sonne. Mit rumpelndem Handwagen voller Wäsche ging es zur etwa 250 Meter entfernt liegenden Mangel in der Leisniger Straße. Auf dem glatten Holzboden dieses mechanischen Ungetüms wurden die Wäschestücke sorgfältig ausgelegt, bevor der mit Steinen besonders beschwerte Schlitten darüber glitt und jede Falte platt machte, plättete.
Bei regnerischem Wetter wurde die nasse Wäsche die Kellertreppe, an drei Stockwerken vorbei auf den weiträumigen Dachboden hinauf gewuchtet, wo sie auf zahlreichen Leinen trocknen konnte. Wir Kinder entdeckten diesen Ort erst spät als Abenteuerspielplatz, was vielleicht auch daran lag, dass die Tür vor der steilen Bodentreppe oftmals verschlossen war und wir uns dort oben möglichst leise verhalten mussten, um nicht die darunter wohnende Familie Brandt auf unser Treiben aufmerksam zu machen. Denn zu entdecken gab es viel: Jede Familie besaß ein von Latten begrenztes und einem Vorhängeschloss gesichertes Abteil. Durch die Zwischenräume erspähten Kinderaugen viel Unbekanntes. Das Lösen einiger Latten verschaffte uns bald den Zugang zu jedem Abteil. Hoch gefährlich wurde es, wenn wir Erwachsenenschritte auf der Bodentreppe vernahmen, dann galt es sich schnell zu verstecken und mucksmäuschenstill zu sein. Erst in späteren Jahren wurde auch von den Erwachsenen toleriert, dass wir ihnen aufs Dach stiegen. Grund waren die gemeinsamen Kampfmanöver von Volksarmee und städtischen Betriebskampfgruppen. Während dieser Kriegsspiele der Großen gab es zum kindlichen Leidwesen Ausgangsverbot. Dabei hätten wir die gepanzerten Kampfwagen und die von Hauseingang zu Hauseingang sich vorkämpfenden Vertreter der einen oder anderen Seite gern aus der Nähe betrachtet, Gewehre begutachtet und vor allem Patronenhülsen aufgesammelt. Geschützsalven, das Rattern von Maschinengewehren, peitschende einzelne Schüsse, Kampfgetümmel, eine Rauchwolke über der Stadt – und wir Kinder durften nicht mitmachen! Unser Dachboden sollte sich als Teillösung erweisen. Denn durch die Dachluke konnten wir Kinder auf das schmale Brett steigen, über das sonst der Schornsteinfeger zur Esse balancierte. Von hier bewerteten wir - Monarchen gleich - aus luftiger Höhe das kriegerische Geschehen zu unseren Füßen, warnten vor heranrückenden Kämpfern, die wir von hier oben viel früher erspähten als die Kombattanten tief unter uns.
Obgleich unser Vater nie Teil der Kampfgruppen war, war doch sein gesamtes Leben durchaus vom Arbeitskampf geprägt, auch das spätere im Westen. Auf dem schmalen und langen Schneidertisch an der Wand zur Ottinger-Wohnung saß er damals bis spät in der Nacht im Schneidersitz und tat, was man vielleicht auch damals Schwarzarbeit nannte, vermutlich notwendig bei einem Stundenlohn von weniger als 1,00 Ost-Mark an der staatlichen Arbeitsstelle. Seine Singer-Nähmaschine hatte es uns besonders angetan. Als Kleinkind konnte man sich auf der Fußwippe, die als Antrieb diente, schaukeln lassen, später betätigte man die Wippe selbst – allerdings musste zuvor der Riemen vom Antriebsrad genommen werden, sonst hätte es oben Garnsalat gegeben. Nach einem unbeobachteten Nähversuch, bei dem ich die Maschinennadel komplett durch meinen Daumen jagte, stand fest, dass ich diesen Beruf nicht anstreben sollte. Wenig anziehend empfand ich auch den ständigen Nebel, der zwar erstaunlicherweise ins Zimmer fallende Sonnenstrahlen sichtbar machte, aber stank und von Zigaretten der Marken „Turf“ und „Casino“ ausging, die mein Vater fast pausenlos rauchte. Auch wenn wir Kinder das Rauchen als untrügliches Kennzeichen des Erwachsenseins empfanden und deshalb Zigarettenkippen aus dem Rinnstein sammelten, um sich mit den noch brauchbaren Resten in Tabakspfeifen wenigstens einen Anstrich von Reife zu geben, hat mich diese Freizeitbeschäftigung nie begeistern können. Tabakersatz aus zerbröseltem Eichenlaub verstärkte wegen der nicht vorherzusehenden enormen Durchschlagskraft – so mancher schaffte es nicht mehr bis zum rettenden Klo - meine Abneigung gegen den blauen Dunst.
„Freizeit“ - heute von allen begehrt, in aller Munde, mit Streiks erstritten und Quell einer milliardenschweren Industrie - war damals ein Wort, das wir gar nicht kannten. Denn zu tun gab es immer etwas, selbst wenn es das in regelmäßigen Abständen erfolgende Ausklopfen des Teppichs auf den Teppichstangen im Hof war. Die tägliche Nahrungsbeschaffung beanspruchte viel Zeit und hielt fit. Supermärkte mit großem Warenangebot waren unbekannt. Für Wurst und Fleisch war der Gang zum Fleischer, für Brot und Brötchen der zum Bäcker notwendig. Für aus dem Holzfass in eine mitgebrachte Schüssel gefülltes Sauerkraut, von einem großen Block geschnittene, sorgfältig gewogene und in Papier gewickelte Margarine, Marmelade aus einem weiteren Fass und Limonade - gelb, rot oder grün - war der Gang zum Lebensmittelgeschäft Richter in der Leisniger Straße unvermeidbar. Milch gab es in einem Molkereiladen der Rochlitzer Straße, in deren Nähe auch eine Konditorei für seltenere Torten- und Kuchenvergnügen. Spielsachen bei Vogelsang am Tzschirnerplatz, Fisch am zentral gelegenen Marktplatz. Öfters besuchte unsere Mutter eine Hutmacherin an der Ecke Rochlitzer-Poststraße und eine Damenschneiderin auf dem Weg nach Kockisch. Nur den Sonntag könnte man im heutigen Sinn als freien Tag bezeichnen. Denn nach dem Kirchgang stand neben den Spaziergängen mit den Eltern, später mit den Freunden im Sommer, häufig Schwimmen auf der Liste, an Schlechtwettertagen aber zog es uns ins Kino. Oder man las Kinderzeitschriften, in späteren Jahren Bücher, und das nicht nur bei schlechtem Wetter, sondern auch bei Sonnenschein auf der Decke im Garten der Oehmeschen Küchenmöbelfabrik. Kinos gab es zwei in der Stadt, das (noch heute bestehende) Theaterhaus-Kino und das Casino-Kino am Hotel Stadt Chemnitz. Wunderbar die russischen und tschechischen Zeichentrickfilme, die Naturfilme aus Gebirgen, der Taiga und aus den Tiefen der Ozeane, letztere vom österreichischen Forscher Hans Hass. Später waren auch andere westliche Filme beliebt, wie der unvergessene Zirkusfilm „Trapez“ mit Gina Lollobrigida in der Hauptrolle.
Feste Mitglieder unserer „Huckelbande“ waren neben meinem Bruder und mir die gegenüber wohnenden beiden Rogler-Jungs und Jürgen K., Wolfgang K. von der oberen Lutherstraße und vor allem der etwa ein Jahr ältere Willi S., der mit seiner kränklichen Mutter in der unteren Etage unseres Hauses wohnte. Er war trotz seiner Körperkraft und seiner unumstrittenen Rolle als Häuptling von ruhigem und ausgleichendem Wesen. Häufig stießen Wolfgang B. aus den oberen Technikumanlagen, Bernd Sch. und Bernd K. aus der Leisniger Straße zu uns. Volkmar St. und Frank V. waren seltenere Gäste, war deren Revier doch eher der Schwanenteich. Dort freilich war auch unsere Huckelbande häufig zu finden, besonders im unteren Teil der Goethestraße, wo die dort wohnenden Jungs zu uns stießen, Wolfgang G., Peter E., Marian M. und Dieter M..
Eine Familie aus unserem Haus hätte sich beinahe der Erinnerung entzogen: Familie F. wohnte neben der Familie S. ebenfalls in der unteren Etage. Sie führte ein zurückgezogenes Leben. Obwohl sie drei Kinder mit den weniger geläufigen Namen Neidhard und Erdmuthe und eine jüngere Tochter hatten, die wir nur Puppi nannten, gab es auch zwischen uns Kindern wenig Kontakt. Den etwa zwei Jahre älteren Neidhard bewunderte und hasste ich gleichzeitig. Letzteres wegen eines Zwischenfalls, der für mich sehr böse hätte ausgehen können: Auf der Hofseite des Hauses kletterte ich verbotenerweise auf den schmalen Sims der Hauswand und tastete mich, dicht an die Wand geschmiegt, voran. An der gefährlichsten Stelle, nämlich genau über der Außentreppe hinunter zur Waschküche, erblickte mich Neidhard und rief sofort nach meiner Mutter. Zutiefst erschrocken verlor ich das Gleichgewicht und stürzte auf die Kellertreppe. Glücklicherweise ging die Sache mit einer Gehirnerschütterung glimpflich aus. Abgesehen von diesem bösen Zwischenfall war das Verhältnis zu Neidhard von wohlwollender Neutralität geprägt. Dankbar war ich ihm noch lange Jahre danach, weil er in mir die Leidenschaft zum Briefmarkensammeln geweckt und mich in die Gruppe der Mittweidaer Philatelisten geführt hat, die sich regelmäßig im Pionierhaus zum Briefmarkentausch traf. Weil mangels Telefon und Internet die gesamte Kommunikation mit weiter entfernt wohnenden Verwandten, Bekannten und Behörden auf postalischem Weg stattfand, gab es viel zu sammeln, auszuschneiden, mit warmem Wasser abzulösen, zwischen Löschblättern zu trocknen und einzusortieren. Meine Schwerpunkte waren Briefmarken des Kaiserreichs, des Deutschen Reichs, der DDR und der BRD, wobei ich dank des Philatelistenausweises mit den Briefmarkensätzen auch die begehrten und nicht frei verkäuflichen Sperrwerte erhielt – später sollten sie mir nützlich werden. Irgendwann fiel uns Kindern auf, dass Herr F. abhanden gekommen war. Dem Getuschel der Eltern war zu entnehmen, dass er als einer der Leiter in einer Mittweidaer Textilfabrik wegen seiner Ansichten bei der SED in Ungnade gefallen und eingesperrt worden war. Als wir ihn nach einiger Zeit wiedersahen, sollte das nur von kurzer Dauer sein, denn samt Familie war er eines Tages plötzlich weggezogen – in den Westen (nach Hildesheim, wenn ich mich richtig erinnere).
Es war ein in sich geschlossenes Kinderleben, in dem jeder Tag für sich seinen Wert erhielt. Ob in der damals noch üblichen schneereichen Winterwunderwelt strenger Frost herrschte, wir dicke Eisblumen am Fenster bewunderten und kleine Gucklöcher hinein hauchten, bei Regengüssen in Pfützen sprangen oder Tannenzapfen hineinwarfen, um aus ihnen ins Wasser strömende, regenbogenfarbene Ölschlieren herzustellen, - alles wurde als völlig normal akzeptiert, gehörte so selbstverständlich zum Kinderleben wie Spiele im Wohnzimmer, zu denen uns längere Wetterunpässlichkeiten oder besonders Wochenendabende zwangen. Da wurde mit den Eltern Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, Halma, Dame oder Mühle gespielt, später oft auch Rommé. Ich tauchte ein in wunderbare Welten, die sich zwischen Buchdeckeln verbargen, die Hausmärchen der Brüder Grimm, Struwwelpeter, Max und Moritz und viele mehr. Allein versuchte man, aus farbigen Holzteilen Mosaike herzustellen oder flache, gelochte Metallstäbe aus dem Stabil-Baukasten mittels Schrauben zu größeren Konstruktionen zusammenzufügen. An einem Weihnachtsfest kam eine elektrische Eisenbahn dazu, deren breite Schienen mit stromführender Mittelschiene samt Weichen wir um den Wohnzimmertisch verlegten. Als die Lokomotive aus Hartplastik eines Tages wegen eines Trafodefekts den Dienst verweigerte, steckte ich das stromführende Schienenkabel direkt in die Steckdose – mit unerwartetem Erfolg, denn sofort raste die Lok los, blieb aber nach dem Blitzstart bald funkensprühend, rauchend und stinkend stehen und war fürderhin nie mehr zur Weiterfahrt zu bewegen. Apropos Elektrizität: Gar nicht so selten fiel der Strom komplett aus, weshalb sich immer eine Petroleumlampe mit Glaszylinder und auch Kerzen samt Ständer in erreichbarer Nähe befanden. Ist ein Stromausfall wegen der Abhängigkeit von Kühlschrank, Tiefkühltruhe, Uhr, Fernsehapparat, Radio, Computer, Rollläden, Kaffeemaschine usw. heute eine mittlere Katastrophe, so störte uns das damals wenig. Wir Kinder schätzten sogar die durch das funzelige Dämmerlicht entstehende geheimnisvolle Atmosphäre. Dass die ältere Generation andere als unsere kindlichen Glücksgefühle hatte, ist leicht nachvollziehbar.
Die Kinderwelt beschränkte sich auf unser begrenztes Wahrnehmungsfeld und wurde innerhalb dieser Grenzen intensiv gelebt. Das Mehrfamilienhaus mit den roten Backsteinziegeln, dem vorgesetzten hölzernen Balkon mit der sich darunter befindlichen Spielfläche und den großen Rhododendronbüschen, in denen man sich gut verstecken, ja mittels Textilplanen Häuser bauen konnte. Der Huckel als Dauerspielfläche für uns Kinder, Weidefläche fürs liebe Rindvieh und Bleiche für frisch gewaschene Wäsche. Die industrielle Kleinstadt Mittweida mit teils holprigem Pflasterbelag, teils einer grau-schwarzen Staub-Dreck-Steine-Mischung auf Wegen und kleineren Straßen. Der Küchenduft, wenn unsere Mutter backte oder kochte. Die mittels einer gegabelten Stange hochgestützte Leine im engen Hinterhof, auf der zu allen Jahreszeiten Wäsche flatterte, die im Winterwind als vereiste Platten aneinanderschlug. Die Dörfer Grünlichtenberg, Topfseifersdorf und Kockisch mit ihrer Tierwelt, die sanften Bäche und Wiesen. Felsen und Abhänge der Mittweidaer und Lauenhainer Aue mit dem stets magisch anziehenden „Waldhaus“ am Zschopaufluss. Abenteuer in den nahen Schwanenteichanlagen. Nicht zu vergessen die Laurentiuskirche, die wir katholischen Kinder nicht nur sonntags, sondern auch zum Kommunion- und Firmunterricht aufsuchten. Sie war trotz entfernter Stadtrandlage fester Bestandteil des Kinderlebens, weil sie eine andere als die schulisch vorgegebene Struktur bot. Da ging man in den Ministrantenstunden gemeinsam an die nahe Zschopau und sprang trotz des für Fußgänger geltenden strengen Verbotes von der hohen Eisenbahnbrücke ins Wasser, konnte frei heraussagen, was man in der Schule tunlichst verschwieg, konnte Bücher finden, die auf der sozialistischen Indexliste standen. Der Pfarrer Bruno Jitschin, ein gemüticher Großvatertyp, mit dem es nie irgendwelche Probleme gab, besuchte alle seine über die ganze Stadt verstreuten katholischen Schäfchen in ihren Wohnungen. Für mich bedeuteten die Kirchenbesuche viel, weil sie für angstfreies Reden und Handeln standen, für das freiwillige Zusammentreffen mit Gleichgesinnten und abenteuerliche Schwimmaktionen am nahen Fluss.
Erstkommunion 1957
Die Küchenmöbelfabrik Friedrich Oehme entwickelte sich neben der Wohnung zu einem weiteren Alltagsmittelpunkt meiner Kindheit. Nicht nur wegen Onkel Fritz, der als mein Taufpate und Möbeltischlermeister die Geschicke der von ihm begründeten Firma mit großem Humor leitete, nicht nur wegen seiner Frau, meiner Tante Frieda, die emsig im ausladenden Fabrikgarten mit Hühnern, Schafen, zahlreichen Obstbäumen, Beeren und Gemüse für Abwechslung auf der heimischen Speisekarte sorgte, oder wegen Onkel Hubert, dem ältesten Bruder meines Vaters, der als Tischlermeister täglich mit dem Bus aus dem Topfseifersdorfer Zentrum der weitläufigen Kleinfamilie anreiste. Über die Bedeutung der Firma in meinem noch jungen Leben habe ich im Frühjahr 2015 für die heutigen Eigentümer, die Firma IMM und den umtriebigen Leiter und Erfinder Prof. Dr. Detlev M., einen Hörbuchtext geschrieben, den ich hier auszugsweise wiedergebe2:
Die Fabrik
1
Endlich Sonnabend.
Die Murmeln aus Glas und Ton sind im kleinen Stoffsäckchen, den Ball bringen die Rogler-Jungs von gegenüber mit, Wolfgang K. aus der Lutherstraße, die beiden Bernds aus der Leisniger sind garantiert da und vielleicht auch Willi S. aus unserer Melanchthonstraße Nr. 6. Obwohl wir uns auch während der Woche immer wieder auf dem Huckel treffen, besitzt der Sonnabend immer ein besonderes Flair - jedenfalls bei mir. Denn endlich können wir länger draußen bleiben, weil am nächsten Tag Sonntag ist und Zeit zum Ausschlafen, und ich sehe meinen Vater schon früher von der Arbeit im Kaufhaus Bester heimkommen. Dort arbeitet er als Schneider in der Herrenkonfektion.
Jäh wird die allgemeine Vorfreude auf den Spielenachmittag am Wiesenhang gestoppt: Unser Vater eilt mit seiner Aktentasche die Lutherstraße herauf. Aber anstatt stehen zu bleiben, ein paar Bälle zu treten, nur ein kurzes „Dieter, Günter, kommt, wir gehen in die Fabrik!“ Widerrede zwecklos (und nicht üblich).
Dabei hätten wir mit so was rechnen können und dann lieber im Park am Technikum gespielt, - war uns das doch schon ein paar Male passiert! Aber welches Kind denkt in den warmen Sommermonaten schon pausenlos daran, Holz für die kalte Jahreszeit zu besorgen; dafür muss man in der widersprüchlichen Welt der Erwachsenen leben und diese – vielleicht – auch noch verstehen.
Nicht etwa lusterfüllt und keinesfalls von frenetischem Jubel begleitet, zerren wir unseren schweren Handwagen über die Kellertreppe ins Freie, von wo uns das Rumpeln der vier eisenbereiften Räder über die Gehwegplatten der Melanchthon- und der Leisniger Straße begleitet. Den Mühler-Bäcker gleich nach der Kurve, die Müllerwohnung, wo wir oft bei Tante Ruth, Onkel Butz sind und mit Harald spielen, das für uns Kinder hoch interessante Geschäft von Richters und die Bäckerei Böhme lassen wir rechts, die Fleischerei Uhlemann und die Wohnung von Onkel Fritz und Tante Frieda links liegen, bevor wir kurz hinter der Tankstelle Fiedler links in die Körnerstraße abbiegen und den Wagen nun zurückhalten müssen, denn es geht bergab. Dort rumpelt‘s nicht mehr, weil an trockenen Tagen der Boden fest, an nassen dagegen matschig ist. Einfach ist das Gefährt jedoch nie zu steuern, immer muss man entweder schieben oder zurückhalten, schwerer als normal ist es auch noch wegen der Seitenbretter, die Vati vor die fast senkrechten Holzstreben des Wagens gesteckt hat. Der Sportplatz bleibt links, die Müllkippe rechts liegen, wobei letztere uns Kinder jedes Mal auf die Probe stellt: den Dauerbrandstellen entströmen Rauch-, Dampf-, Rußwolken und alle möglichen undefinierbaren Gerüche. Und finden kann man dort auch immer mal was Nützliches, - aber nie, wenn die Eltern dabei sind. Diese haben für solche Genüsse leider kein Verständnis, halten sich sogar die Nasen zu und beschleunigen ihre Schritte.
An der Küchenmöbelfabrik meines Onkels Fritz angekommen, fühlen wir uns wie zu Hause. Durch das offenstehende Tor weisen uns getrocknete Schlammspuren des Lieferwagens den rumpligen Weg in den Hof. Gerade vor uns die Trockenhalle, rechts um die Ecke, unter dem Übergang zwischen Fabrikation und Trocknungshaus hindurch halten wir vor einer leicht in den Erdboden versetzten Tür. Tante Frieda, die gerade ihre beiden Schafe aus dem Garten in den Stall holt, in dem auch noch der Lieferwagen der Fabrik seinen Platz findet, begrüßt uns herzlich und ruft Onkel Fritz, der dann auch gleich auf der oberen Plattform der ins 1. Geschoss führenden Hoftreppe erscheint. Er kommt aus dem Allerheiligsten der Firma: Unsere Mutter hat meinen Bruder und mich vor und nach unserer Geburt ungezählte Male dahin mitgenommen, die Buchhaltung der „Küchenmöbelfabrik Friedrich Oehme“ geleitet und diese in den 40er Jahren durch Fachkönnen und die Ausweitung der Produktpalette aus bedrohlich roten Zahlen ins ruhige Fahrwasser profitabler Produktion geführt. Kümmerte sie sich um Ausgaben, Einnahmen und Kundenpflege, so oblagen Onkel Fritz alle Planungen, Durchführungen und Auslieferungen der Produktion. Unterstützt wurde er dabei von einem tatkräftigen Team an Tischlern, zu dem auch mein Onkel Hubert aus Topfseifersdorf gehörte. Er war der älteste Bruder meines Vaters. Und die Mutter der beiden, also meine Oma Flora aus Topfseifersdorf, war eine Schwester von Tante Frieda. So kam es, dass ich ihr Neffe wurde und Onkel Fritz sogar mein Taufpate. Verstanden? Falls nicht, ist’s nicht schlimm. Wichtig eher ist, dass die Fabrik auf diese Weise zum Teil unserer Familie geworden war.
Onkel Fritz besaß die Fähigkeit, stets zu Scherzen aufgelegt zu sein und – trotz der Zeiten – gern und oft herzhaft lachen zu können, - Eigenschaften, die er seiner Tochter Ruth vererbt hat. Jetzt also steigt er aus den Höhen des „Bureaus“ in unsere Hofniederung herab und schließt nach freudiger Begrüßung jene niedrige Tür vor unserem Wagen auf.
Mein Bruder Günter und ich wissen schon, was uns jetzt erwartet – Kinderarbeit: Ein niedriger Kriechkeller, in dem unser Vater nicht aufrecht stehen kann, ist deckenhoch mit Holzabfällen gefüllt, Holzscheite, dick, dünn, scharfkantig, rund, lang und kurz. Keineswegs sortiert, sondern direkt aus Körben in jene Holzgruft hineingekippt. Und nun sollen wir die Holzscheite als Heizmaterial für unseren Kachelofen aus stickiger Enge ans Tageslicht befördern. Eine funzelige Deckenbirne beleuchtet unser Tun. Während wir wegen der Splitter, scharfen Kanten und der beklemmenden Enge in Luft verknappender Hitze gelegentlich Flüche ausstoßen, übernimmt unser Vater das Hinaustragen zum Handwagen und das saubere Einschichten des Holzes.
Bis zu den ersten Frösten sind viele Fahrten nötig, um unseren Keller in der Melanchthonstraße zu füllen. Mit jenem Fabrikholz, zusätzlich gekauften Torfziegeln und Braunkohlenstaub kann der im Allgemeinen lange, kalte und schneereiche Winter kommen. Der Kachelofen im Wohnzimmer und der Herd in der Küche haben ihr Futter, im Schlafzimmer dagegen grinst der Erfrierungstod durch die Doppelfenster.
2
Refugium
Ertrugen wir Kinder die jährlich wiederkehrenden Holzsammelfahrten als Vorsorge für den Winter wie schlechtes Wetter, so gewann die Firma während der warmen Sommermonate für mich eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Den großen Garten habe ich schon erwähnt: Neben den zwei Schafen, die dort mit stoischer Ruhe angepflockt ihrem Fresswerk nachgingen, gab es Platz im Übermaß. Direkt an der Rückwand der Trocknungshalle befand sich ein von mehreren Bienenvölkern emsig angesteuerter Bienenstock., um den sich meine beiden Onkel Fritz und Hubert kümmerten. Hielt ich mich aus jammervoller Erfahrung vom Stechzeug möglichst fern, so zog mich der zum Schutz vor den Schafen eingezäunte Bauerngarten links hinten magisch an. Büsche von Himbeeren, Brombeeren, roten, weißen und schwarzen Johannisbeeren, Stachelbeeren und Erdbeeren wechselten mit Erbsen, Bohnen, Kohlrabi, Radieschen, Möhren, Gurken und weiterem Gemüse. Nicht erinnern kann ich mich, dass mich jemals ein mäßigendes Wort von meinen Raubzügen durch jenen Garten Eden abgehalten hätte.
Auch nach meiner Einschulung in die Fichteschule im September 1954 fand ich nachmittags regelmäßig den Weg an der olfaktorischen Herausforderung des Schuttplatzes vorbei den Weg in den Fabrikgarten, auf meinem kleinen Holzwägelchen Schulsachen, die „Mosaik“ oder „Fröhlich sein und Singen", gelegentlich auch ein vom vielen Lesen zerfleddertes Micky-Maus-Heft aus dem Westen und eine Wolldecke. So wie Hunde und Katzen bestimmte Stellen meiden, andere dagegen bevorzugen, so zog es mich im großen Garten immer an meinen Stammplatz. Unter dem Birnbaum, so schief gewachsen, dass man problemlos den Stamm hinaufklettern konnte, wartete ein altes Tischgestell mit schmaler Bank auf mich, - für die Hausaufgaben. Auf die Decke fläzte ich mich erst danach zum Lesen der Heftchen, zum Betrachten der Wolkenformationen und Dösen. Im Spätsommer gewann „mein“ Plätzchen wegen der großen, süßen Birnen besonderen Reiz, allerdings auch für die stechenden Plagegeister, die tunlichst zu meiden waren.
Oftmals wanderte die Sonne bereits in Horizontnähe, bevor ich mich auf den Heimweg machte und dabei nicht selten am Sportplatz durch Lücken in den hohen Zaunbrettern Leichtathleten und den Fußballern der „Einheit“ beim Training zuschaute.
3
Abenteuerspielplatz
Ein bedeutender Teil des magnetischen Kraftfeldes der Fabrik bestand in der familiären Verbundenheit. Der fast immer sehr gut aufgelegte Onkel Fritz vermittelte mir immer den Eindruck, willkommen zu sein, wenn ich im Büro in der 1. Etage auftauchte. Dort bewunderte ich ehrfurchtsvoll die säuberlichen Reihen der Ordner, das Klappern der Schreibmaschine, das Schnarren des einzigen Telefons, die wuchtigen Holzregale, Schreibtische und Schränke. Nicht selten rief Onkel Fritz dann Onkel Hubert herbei, was mich besonders freute. Denn dann stand die Mitnahme in den Produktionssaal bevor. Vermutlich habe ich nur wenig von Onkel Huberts Erklärungen verstanden, der sich alle Mühe gab, mir Produktionsabläufe und Maschinenfunktionen nahe zu bringen.
Viel beeindruckender und noch gut in der Erinnerung ist mir die lange, unter der Decke durch den ganzen Saal sich hinziehende Welle mit zahlreichen von ihr durchbohrten Rädern, von denen breite Transmissionsriemen zu Maschinen den Luftraum durchschnitten.
Das Lackier- und Trocknungsgebäude jenseits des Hofs, das über einen schmalen Überweg mit dem Maschinensaal verbunden war, wurde mir auffällig wenig und dann nur kurz gezeigt. Waren ungesunde Dämpfe die Ursache, oder traute man mir nicht? Anlass zu letzterem hätten sie schon gehabt:
Eines Tages, es muss, weil niemand arbeitet, ein Sonntag oder nach Feierabend gewesen sein, sind die Eltern mit mir in der Fabrik. Während die Erwachsenen im Büro Kaffee trinken und über die Rettung der Welt sprechen, nutze ich die Gelegenheit zum Herumstromern im Produktionssaal mit seinen vielen Maschinen. Ein großer Knopf erregt mein besonderes Interesse. Kaum gedrückt, beginnen dröhnend die Räder unter der Decke zu rotieren. Eine Bandschleifmaschine, noch immer mit der Antriebswelle verbunden, setzt sich in Gang. Und weil auf der Innenseite des langen Schleifbandes ein Holzklotz liegt, der nun ins Räderwerk gerät, reißt das ledergleiche Band und schnellt aufheulend durch den Saal, wie wenn man einen Gummiring vom Finger schnellen lässt. Glücklicherweise passiert sonst nichts weiter! Erschrocken schalte ich das Ungetüm ab und eile zu den Großen zurück ins Büro, wo man vom Geschehen gar nichts bemerkt hat und ich deshalb auch keinen Grund zur Beichte sehe. Erst einige Tage danach erwähnt Onkel Fritz, dass an jenem Tage das Schleifband gerissen sein musste, es hätte ohnehin bald erneuert werden müssen… Eine sehr diplomatische Lösung.
Auch Onkel Hubert, der Älteste von fünf Geschwistern meines Vaters, war oftmals Ziel meiner Fabrikbesuche. Er kam täglich mit dem Bus aus dem Elternhaus in Topfseifersdorf. Nicht nur verwandtschaftlicher Instinkt zog mich zu ihm in die Leipziger Straße, sondern ganz egoistisches Nützlichkeitsdenken: Im Werkunterricht der Fichteschule verlangte unser gestrenger Herr Eisenreich von jedem Schüler ein holzgefertigtes Vogelhäuschen, dessen Ecken verzapft und verleimt sein sollten. Zwar schaffte ich das so-la-la, wollte aber vor der zensurträchtigen Abgabe des Prachtstückes noch die Expertise meines Onkels vom Fach einholen. Dem Tischler Hubert Klein jedoch gefiel mein Kasten gar nicht. Innerhalb eines Tages brachte er mir dann eine Vogelvilla nach Hause: perfekte Verzapfung ohne Zwischenräume, alles fest und gut verleimt, solide, mit abgerundeten Kanten… Herr Eisenreich konnte sich bei seinen lobenden Worten mit seltsamem Blick auf mich die Bemerkung nicht verkneifen, dass er einen gewissen Hubert Klein in der Küchenmöbelfabrik Oehme als Arbeitskollegen gehabt hätte, der doch mein Onkel sein müsste …
An späterer Stelle werde ich die für lange Zeit letzte Begegnung mit der Fabrik wiedergeben. Bevor es dazu kommt, gilt es, zuerst die Schulzeit zu beginnen und zu bestehen:
Der Kindergarten ist mir aus der kindlichen Vorschulphase in guter Erinnerung. Nach jedem Kindergartentag musste sich mein Teddybär den Tagesablauf anhören. Auf heimischem Wohnzimmersofa, mit teils abgeschabtem, angegrautem Pelz, wartete er bereits geduldig auf mich und antwortete, wenn ich ihn bewegte, beifällig mit tiefem Brummen.
1954, am Schluss jener Phase, ein prächtiger Zuckertütenbaum, mit dem wir Kindergartenkinder in die Schulzeit entlassen werden sollten. Aufgeregt sah ich diesem Abschied entgegen. Er war uns Kindern mit gemeinsamen Liedern, Tänzen und Spielen, dem Essen aus Blechnäpfen, Bau von Drachen, dem Sammeln von Kastanien und Herbstblättern, dem Nachmalen derselben, mit Wanderungen in die schöne Umgebung und dem gemeinsamen Mittagsschlaf ein Hort der Geborgenheit gewesen, den ich mit dem kleinen ledernen Umhängetäschchen mit einer in Papier gewickelten Schnitte fürs Frühstück Tag für Tag freudig besuchte. Nun aber sollte Schluss damit sein, womit sich die Frage stellte, ob und wie das Leben danach weiter gehen sollte. Das Ob war schnell geklärt, denn sowohl im Kindergarten als auch zu Hause war eine Mischung aus Nervosität, Abschiedsschmerz und Vorfreude spürbar. Und dass auf die Kindergartenzeit die Schulzeit folgen würde, man damit etwas erwachsener wäre, darauf wurde man schließlich von allen Seiten schon seit langem vorbereitet. Nach Lage der Dinge kamen für die Zeit danach zwei Schulen der Stadt in Frage. Die in der Nähe der evangelischen Stadtkirche stehende altehrwürdige Pestalozzischule und der in unserer Nähe majestätisch auf Bergeshöhe prangende Ziegelsteinbau der Fichteschule. Beide Schulen waren „Zehnklassige Politechnische Oberschulen“, beide schon durch Größe und Alter beeindruckend. Selbst wenn ich hätte auswählen können, hätte ich mich für die näher gelegene Fichteschule entschieden, der ich letztlich auch zugeteilt wurde. Und weil andere Kinder aus gleichem Grund für die nächsten Jahre die Pestalozzischule besuchten, wurden die Kindergartengruppen nicht nur auseinandergerissen und verloren sich aus den Augen, sondern es entstand zwischen den Schüler*innen beider Lehranstalten eine lang andauernde Rivalität. Denn natürlich hielten alle Kinder ihre Penne für die beste und wären nie im Leben zu einem freiwilligen Wechsel zur Konkurrenz bereit gewesen.
Vom kleinen Kindergarten in die große Fichteschule
1 Wikipedia, 1947
2 IMM, Labor omnia vincit, Mini Hörbuch, prounic GmbH Mittweida, 2016