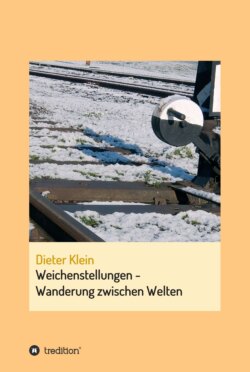Читать книгу Weichenstellung - Wanderung zwischen Welten - Dieter Klein - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Kapitel 1954 – 1961 Schule des Lebens
Mit dem Eintritt ins Schulleben erweiterte sich der Kinderhorizont, der Verstand wuchs – erste Konflikte waren unvermeidliche Folgen. Die Schulzeit, wohl für jeden Menschen eine prägende Entwicklungsphase, erscheint im Rückblick als spannend und generell schön, ein möglicherweise leicht rosa gefärbtes Bild. Die wenigen markant negativen Erfahrungen verblassen im Licht einer erfüllungsreichen Kindheit, sollen aber nicht verschwiegen werden. Auch wenn der erste Schultag im September 1954 in grauer Vorzeit zu liegen scheint, gibt es bleibende Erinnerungsfragmente:
Schulanfang mit Ilona B
Der Zuckertütenbaum im Kindergarten etwa, von dem jeder Schulanfänger zum Abschied eine bunt gemusterte Tüte voll Backwaren und Süßigkeiten abgeschnitten bekam. Anschließend saß man erstmals in einer hölzernen Schulbank mit hochklappbaren Sitzen, schräg stehender Tischplatte und oben angebrachter Aussparung für's Tintenfässchen. Eine junge Frau sprach zu uns, wovon mir ihre Aussage erinnerlich ist, dass wir Kinder nicht geschlagen werden dürften. Ich hing förmlich an ihren Lippen: die erste Klassenlehrerin, Frau T., außerordentlich sympathisch – das ging gut los! Auch wenn wohl keiner von uns Schulanfängern von der Schule körperliche Züchtigungen erwartete, sollten wir später schmerzlich erfahren, dass die Definition von Gewalt gegen Schüler sehr dehnbar ist.
Um zur Fichteschule auf dem Deckerberg zu gelangen, gab es zwei Fußwege. Entweder zunächst bergab über Melanchthon- und Lutherstraße, vorbei am Tzschirnerplatz mit den verlockenden Schaufenstern des Spielwarengeschäfts Vogelsang, um auf der anderen Seite, die Rochlitzer Straße überquerend, den Postberg hinaufzugehen. Der andere Weg war ein wenig länger und wurde eher für den Rückweg gewählt; von der Schule die Schillerstraße hinunter, quer über die Bahnhofstraße die Leisniger Straße hoch. War am Heimweg die Bergabstrecke am dichten Buschwerk der Firma Schnaps-Kunze unbeschadet überstanden, denn oft schubsten wir uns in die Büsche oder den Steilhang zu Kunze hinunter, wartete auf der anderen Seite der Anstieg der Leisniger Straße, wo wir Kinder - ungeachtet daheim wartender Mütter - uns nahezu alltägliche Auszeiten gönnten. Immer aufs Neue bewunderten wir die beiden nackten, lebensgroßen griechischen Götterfiguren aus Stein in luftiger Höhe des Technikumgebäudes. Nicht nur konnte man als wesentlichen Teil sexueller Aufklärung die biologischen Unterschiede der Geschlechter anschaulich und genau in Augenschein nehmen, noch mehr eigneten sie sich hervorragend dazu, im Winter unsere Treffsicherheit mit Schneebällen zu schulen. Gewinner war, wessen Geschosse am häufigsten auf den Geschlechtsmerkmalen der Beiden landeten. An heißen Sommertagen dagegen überwanden wir den Zaun zur Linken und kletterten verbotener Weise auf den Teufelssteinen im Garten der Villa Oster, Findlingsbrocken aus der letzten Eiszeit, und sehr oft umlagerten wir die Frische spendende Wasserpumpe im Hof des Schulkameraden Wolfgang B., wo vereinbart wurde, wie man nach erledigten Hausaufgaben die Nachmittage füllen wollte, z.B. mit Fußballspiel auf der staubigen Freifläche vor seinem Wohnhaus oder im Winter mit Schlittschuhlaufen auf dem Schwanenteich oder zu allen Jahreszeiten mit Spiel auf dem Huckel inklusive verbotener vegetarischer Versorgungszüge in die angrenzenden Schrebergärten im Sommer. Auf dem schon oben erwähnten Huckel allerdings, dort wo heute die uniformen Neubauten der Lauenhainer Straße für gepflegte Lange-weile sorgen, vergnügten sich vorzugsweise Kinder aus der Melanchthon- und Lutherstraße, was einige Klassenkameraden ausschloss, die sich eher auf dem Technikumgelände oder in den Schwanenteichanlagen herumtrieben. Oder wir vereinbarten eine der selteneren Plünderungen im Hühnerstall der Holzbau-Firma. Zur eigenen Verwunderung blieb unser Treiben dort recht lange unbemerkt, weil wir, vom Fabrikgelände her nicht einsehbar, durch das Dachfenster des leicht zu erklimmenden Flachbaus kletterten und im Stall bequem die Eier des Federviehs einsammeln konnten. Einige Eierdiebe tranken sie an Ort und Stelle aus.
Doch zurück zum Heimweg von der Schule: Nicht nur Unsinn stellten wir an mit unserer Teufelssteinkletterei oder den Attacken auf die beiden Vertreter der griechischen Götterwelt, sondern auch Unterrichtsinhalte wurden wissenschaftlich exakt nachbereitet. Unter den Augen von Prometheus und Athene sollte sich die im Unterricht vermittelte Ansicht, Religiosität sei antiquierter Aberglaube, als besonders strittig erweisen. Der Lehrer, dem aus unserer etwa 30-köpfigen Klasse niemand zu widersprechen gewagt hätte, um sich und andere nicht als Christen ins Abseits zu stellen, war weit weg, und hier - unter den Augen des Blitze schwingenden Griechengottes - sollten kompromisslos und verbissen theologische Streitgespräche geführt werden. Herrschte im Unterricht angesichts der sozialistischen Aufklärungsversuche unseres Lehrers noch christlich kollektives Schweigen, so explodierte nun der Dampfkessel, wir gaben die in der Schule selbst auferlegte Einheit der Christenmenschen auf. Konnte Gott eine Mutter und damit einen Anfang haben, wo er doch ewig sein sollte? Und konnte Maria ohne einen irdischen Mann ein Kind gebären? War sie eine Heilige? Evangelische und katholische Pennäler gaben ob dieser existenzwichtigen Fragen jegliche Zurückhaltung auf und gingen nach Erschöpfung der argumentativen Auseinandersetzung zum Religionskrieg über, in wärmeren Monaten zu Rangeleien, im Winter zu erbitterten Schneeballschlachten. Zu den Menschen, die unser Christenkollektiv übrigens durch stillhaltendes (feiges?) Schweigen schützte, gehörte auch der beliebte Musiklehrer H.. Er hätte - so erfuhren wir Kinder in den Räumen der katholischen Kirche - wegen seiner allsonntäglichen Tätigkeit als Organist in der Laurentiuskirche um seine Lehrerstelle bangen müssen. (Später wird näher auf Konflikte zwischen Schule und Glaube einzugehen sein.)
Laurentiuskirche
Rätselhaft blieb mir oft genug die Rechenkunst, wo es so manche „3“ setzte. Der längst pensionierte Mathelehrer L., der ein Stockwerk unter uns wohnte, ein hochgewachsener, dürrer, grauhaariger Mann mit abgenutzter Stimme und einem Hauch von Überreife im Bouquet, versuchte mit großer Geduld und stets einer Tasse Tee, mir die Geheimnisse mathematischer Logik nahe zu bringen. Minus mal Minus sollte Plus ergeben. Wenn meine Eltern kein Geld mehr hätten, sondern nur noch Schulden, und unsere Nachbarn das gleiche Schicksal ereilte, so hätten wir nach den mathematischen Regeln darüber sehr froh sein sollen, weil wir durch das Multiplizieren zweier Minussummen zu Reichtum hätten kommen müssen. Wie weltfremd war doch diese Mathematik!
Besser lagen mir die Fächer Geschichte und Deutsch, wobei nach intensiverer Betrachtung der vorreformatorischen Zeit des 16. Jahrhunderts mit der Betonung der Bauernkriege und der Verfehlungen von Adel und katholischer Kirche ein gewaltiges historisches Schwarzes Loch die Weltgeschichte bis zur Oktoberrevolution von 1917 verschluckte. Dass diese während des Ersten Weltkrieges stattgefunden hatte, erfuhren wir zwar, dafür aber kaum etwas über jenen Krieg und die wichtige Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Machtübernahme durch das NS-Regime Adolf Hitlers. Und was wir lernten, drehte sich hauptsächlich um die kommunistische Tradition damals, personifiziert in Lenin und Stalin sowie ihren deutschen Wegbereitern Ernst Thälmann, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und in der aus der Nähe von Mittweida stammenden Clara Zetkin. Die Gründe für das Entstehen des Nationalsozialismus, seine Strömungen und die Resonanz in anderen europäischen Ländern blieben uns gänzlich verborgen. Dabei wäre genau das am wichtigsten gewesen, weil Personen wie Hitler sich zwar nicht wiederholen können, sehr wohl aber bestimmte sozioökonomische und ideologische Situationen als Bedingungen für das Wiederaufleben nationalsozialistischen Gedankengutes. Leicht lässt sich vermuten, dass die NS-Zeit noch nicht lange genug zurück lag, um eine wertende Distanz aufzubauen. Zu viele Menschen gab es in beiden Teilen Deutschlands, die nach 1945 in höhere Positionen aufgestiegen waren und kein Interesse am Aufrollen der Vergangenheit hatten. Die Behauptung der DDR, alle Faschisten von einst befänden sich in Westdeutschland, war eine reine Propagandalüge zum Selbstschutz und hält seriöser Prüfung nicht stand.
Auch wenn wir etwas über das KZ Buchenwald erfuhren, so gab es - aus heutiger Sicht sträflicherweise - keine Auseinandersetzung mit der Ideologie des Nationalsozialismus, mit der menschenverachtenden Rassenwertlehre, erst recht nicht mit der weiteren Verwendung des KZ Buchenwald durch die sowjetischen Besatzer. Dafür erhielten zweifelhafte weltgeschichtliche Akteure, wie Stalin und Lenin, den Nimbus von Göttern, ihre Paladine Pieck und Ulbricht den ihrer deutschen Erzengel. Schwerpunkt des Geschichtsunterrichts war damit die Zeit nach 1945, besonders die seit 1949 bestehende Deutsche Demokratische Republik.
Ein mit dem jeweiligen Fachlehrer durchaus kontrovers diskutierter Gesprächsstoff ergab sich regelmäßig bei dem Versuch, uns Schülerinnen und Schülern unser Dasein im Sozialismus schmackhaft zu machen, der als Vorstufe des kommunistischen Paradieses uns angesichts von Bezugskarten für Lebensmittel und allgemeiner Warenknappheit wenig attraktiv erschien. Die Prognose, dass im Kommunismus mit dem Wegfall des Staates es auch kein Geld mehr gäbe, dafür aber alle Güter in ausreichender Zahl, führte bei uns Naivlingen zur Frage, ob es dann so viel Torte gäbe, wie wir essen wollten. Natürlich befanden wir uns mit dieser Frage noch im frühsozialistischen und damit unzureichenden Bewusstseinszustand. Der Lehrer bezweifelte, dass es dann überhaupt noch ein Bedürfnis nach Torte gäbe, weil Torten als Ausdruck bürgerlicher Dekadenz für die Ernährung des Volkes nicht notwendig wären. Wenig beeindruckend, denn bis zum Ausbruch des Kommunismus schien es ja noch eine Weile hin zu sein, und so drückten wir auch weiterhin an den Schaufenstern der Konditoreien unsere bürgerlichen Nasen platt und erstrahlten, wenn an Geburtstagen eine bunte Platte konditorischer Prachtstücke oder eine ganze Torte auf dem Tisch prangte.
Schwierigkeiten mit Lehrern waren selten. An jedem Montag wurde die Schulwoche mit einem Fahnenappell auf dem Schulhof eröffnet, wobei nach Durchzählen der im Karree und in „Stirnreihe“ aufgestellten Klassen von deren Klassen-Pionierleitern die Zahl der anwesenden Schüler dem Pionierleiter der Schule gemeldet wurde. Dieser meldete es mit Pioniergruß dem danebenstehenden Schulleiter, wonach feierlich die Nationalflagge der DDR gehisst wurde, nach kurzer Ansprache und Ausgabe des Wochenmottos die neue Woche begann.
Lehrerbezogene Besonderheiten gab es wenige. Lediglich mit der Russischlehrerin, Frau K., hatten es wohl alle schwer. Saßen Vokabeln nicht, so musste man sich während der großen Pause bei ihr erneut zur Vokabelprüfung vorstellen. Auch schien sie der Auffassung zu sein, dass sich Russisch am leichtesten durch heftiges Klopfen auf die Köpfe erlernen ließe. Sie vollzog diese Lernhilfe mit den Knöcheln ihrer Finger so kräftig, dass zumindest mir die Augen feucht wurden. Freudentränen über den erzielten Lernerfolg waren es jedenfalls nicht. Diese stellten sich erst bei unseren spitzbübischen Racheakten ein. Um ihre Wohnung unter dem Dach eines hohen Bürgerhauses der Rochlitzer Straße wissend, war dort öfters Klingelputzen angesagt. Aus sicherer Entfernung konnte man dann beobachten, dass sie nach einiger Zeit des Heruntersteigens aus dem obersten Geschoss vor der Haustür erschien, um den vermeintlichen Besucher zu empfangen. Als das Gerücht vom Freitod zweier Mitschüler aus anderen Klassen die Runde machte und Frau K.'s Lehrmethoden als Ursache genannt wurden, machte sich allgemein Angst vor dieser Frau in einem Maße breit, dass ich erstmals in meinem Leben Unterricht schwänzte mit der Entschuldigung, ich hätte wegen Unwohlseins in der nahen Poliklinik einen Arzt aufsuchen müssen. Natürlich führte das Gerücht auch zu einer Eskalation unserer Strafaktionen. Das Klingelputzen wurde mit Hilfe eines sorgfältig zugeschnittenen Korkens, durch dessen Mitte eine Nadel geschoben wurde, deutlich verfeinert. Nun blieb der Korken, der den vorsichtig herausgedrehten Klingelknopf ersetzte, stecken und löste in der Wohnung unserer Peinigerin Daueralarm aus. Der Versuch der herunter geeilten Frau K., den Daueralarm zu stoppen, musste für sie, die in der Dunkelheit den Klingelknopfersatz nicht erkennen konnte, wegen erneuten Drückens ebenso schmerzhaft gewesen sein wie ihre Kopfnüsse für uns Schüler.
Ein Ereignis, das auch hätte schief ausgehen können, brachte der gesamten Klasse eine Gardinenpredigt des Schulleiters und kollektives Nachsitzen ein. Im Zuge heftiger Rangeleien hatten wir Jungs aus dem obersten Stockwerk der Fichteschule eine ganze Schulbank aus dem Fenster geworfen - glücklicherweise befand sich niemand im Hof darunter. Wir bekamen danach von höchster Schulstelle zu hören, dass unsere Klasse die disziplinloseste der ganzen Schule sei und wir nun allesamt an mehreren Nachmittagen zum Nachsitzen anzutreten hätten. Andernfalls müssten wir die Schule verlassen und unsere Karriere in der anderen städtischen Schule, der Pestalozzischule, fortsetzen. Zähneklapperndes Entsetzen pur und sofortige Bereitschaft zum Nachsitzen! Der mit unserer Nachmittagsbetreuung beauftragte Deutschlehrer machte aus der Not eine Tugend, indem er uns die Regeln von Interpunktion und Grammatik einbläute. Jahrzehnte sollte ich davon zehren.
Gemischte Erinnerung bleibt an den Sportunterricht, besonders an den Lehrer T.. Wohl dem Prinzip „Was einen nicht umbringt, macht einen hart“ folgend, scheuchte er uns auch zur Winterszeit um das schneebedeckte Rund des Stadions - barfuß, nur mit Sporthemd und kurzer Turnhose bekleidet. Seine Geräteturnübungen jagten mir Angstschauer über den Rücken, und nur selten konnte ich an der Kletterstange oder am Seil das Hallendach erreichen. Die rasanten Schlittenfahrten im nahen Stadtwald sind mir dagegen in angenehmerer Erinnerung.
Alle Schülerinnen und Schüler meiner Klasse waren Jungpioniere – bis auf Marian. Während wir bei Leistungsschwächen eines Schülers vom Fachlehrer aufgefordert wurden, diesem während einiger Wochen bei den Hausaufgaben helfend zur Seite zu stehen, war es uns untersagt, Marian zu helfen. Auch diese Diskriminierung konnte Marian nicht zum Eintritt in die sozialistische Jugendorganisation „bekehren". Dennoch blieb er mein Freund und Mitministrant in der katholischen Kirche, bewundert wegen seiner ungewöhnlichen Streiche. So las er als Messdiener im Rücken des dem Altar zugewandten Pfarrers und unsichtbar für die Gemeinschaft der Gläubigen anstatt im Gebetbuch Micky-Maus-Heftchen, die er gut unter seinem Ministrantenkittel zu verstecken wusste.
Die wöchentlichen Pionierstunden empfanden wir damals wohl alle als interessant. Denn zuweilen erschien ein eigens dafür abgestellter Patenoffizier der Volksarmee, um in die Funktionsweise eines Gewehrs einzuführen. Höhepunkt war dann das Schießen auf dem Schulhof. Unter dem stets wachsamen Auge der Nationalen Volksarmee versuchten wir Jungs, mit einem Kleinkalibergewehr auf einer menschlichen Silhouette Herz oder Kopf zu treffen. Auf den Sieger wartete, quasi als erfolgreichem Landesverteidiger, eine Tafel Schokolade. Auch die beliebten Geländespiele sahen wir in keinem Zusammenhang mit Militarisierung und Einüben von Guerillataktik. Hierfür wurde die Pionierschar geteilt. Jeder Teilnehmer der beiden Gruppen erhielt einen dünnen Wollfaden in unterschiedlicher Farbe. Blau etwa hatte ein Objekt, beispielsweise einen Turm im Wald, zu verteidigen, Gelb waren die Angreifer, die es erobern sollten. Wer einem Gegner den Farbfaden vom Arm abriss, beförderte diesen damit ins virtuelle Jenseits. Zur Erhöhung von Spannung und zum besseren Erreichen des Kampfziels lernten wir, uns unter dichtem Laub des Waldes unsichtbar zu machen. An den felsigen Steilhängen zur Zschopau hinunter waren diese Spiele wegen der Absturzgefahr besonders riskant. Natürlich gab es auch friedlichere Auftritte der Pioniergruppe, zum Beispiel wenn wir vor Betriebsgruppen und im Seniorenheim Lieder sangen oder Sketche aufführten. Da Pioniere grundsätzlich und zumindest verbal für den Sozialismus eintraten, „durfte“ man dieses Bekenntnis öffentlich auf Kundgebungen und Umzügen demonstrativ zur Schau stellen. Einige Male oblag auch mir die Aufgabe, mit der Pionierfahne vor der Gruppe zu marschieren. Mit der Länge des Demonstrationsweges – zumeist vom Technikumplatz zum Marktplatz – wurde mir einmal die Bürde des Sozialismus immer schwerer. Zur Erleichterung hätte ich die Fahne an einen anderen Pionier weitergeben oder sie schräg über die Schulter legen können, anstatt sie senkrecht vor dem Körper zu tragen. Ich bevorzugte die Schulter-Schräglagenlösung mit nahezu sofortigem Echo. Die Fahnenstange war durch die neue Haltung unsanft auf den Kopf eines hinter mir marschierenden hochgewachsenen Pioniers aufgeschlagen. Dieser beantwortete die unerwartete Attacke mit einem kräftigen Tritt in meinen proletarischen Hintern, was mich vor Schmerz vor der Gruppe hüpfen ließ. Nirgends steht, dass Revolutionen schmerzfrei verlaufen.
Unter dem Begriff „Urlaub" verstand man damals etwas ganz anderes als heute. Reisen in andere Länder, an Strände, ins Gebirge waren noch nicht einmal ansatzweise in der persönlichen Wunschwelt angekommen. Die älteren Staatsbürger statteten Verwandten längst geplante Besuche ab, wanderten eventuell in der Umgebung. Hauptsächlich aber legten sie Hand an Arbeiten, die wegen der mindestens 48 Pflichtwochenstunden und weiterer Verpflichtungen unerledigt liegengeblieben waren. Für Kinder war die schulfreie Zeit natürlich hoch ersehnt. Da bevölkerte man bei passendem Wetter die Flussschwimmbäder der nahen Zschopau, traf sich zum Herumstromern in der Felsenwelt der Umgebung, zum Räubern in fremden Gärten. Seitens der Schulen und Betriebe wurden für das Jungvolk Ferienspiele und Klassenfahrten angeboten, die ebenfalls enorm beliebt waren.
Die Erinnerung an eine Klassenfahrt ist so fest mit dem Ortsnamen „Gera Ernsee“ verbunden, dass ich bis heute bei der Erwähnung der thüringischen Stadt Gera sofort daran denken muss: Es war der Jahresausflug unserer 6. Klasse, der uns in einen Jugendhof eben dorthin führte. Der Stadtteil Ernsee (oder war es ein Dorf nahe der Stadt?) befand sich ein paar Kilometer außerhalb Geras. Neben unserer Klasse bezogen auch ältere Schülerinnen unserer Schule lärmend den früheren Bauernhof mit seinen vier Wirtschaftsgebäuden. Zu Beginn gab es eine deutliche Ansprache des Heimleiters, in der er die Notwendigkeit strenger Disziplin heraushob. So seien die Jungs unserer Klasse im ersten Stock eines der vier Häuser untergebracht, ein Stockwerk darunter die Mädchen der höheren Klasse. Falls einen von uns nächtens ein dringendes Bedürfnis plagte, sollte er einen Stock tiefer im Mädchenflur die Jungentoilette aufsuchen, aber - und das wurde besonders betont - der Klogang dürfte nur allein und nicht gruppenweise vollzogen werden. Nach Bettenbeziehen, Abendessen und Waschen sollte ein langer Anreisetag sein beruhigendes Ende finden - dachten zumindest unsere Lehrer*innen.
In unserem Schlafraum, alle Jungen hatten in Stockbetten Platz gefunden, macht sich bereits Müdigkeit breit, geistern lediglich vereinzelt Gespräche durchs Dunkel. Doch jäh und brutal wird unsere Dämmerphase unterbrochen: Die Zimmertür knallt auf. Mädchen vom unteren Flur stürmen herein und unter lautem Kichern gleich wieder hinaus auf nackten Fußsohlen die Treppe nach unten. Trotz berechtigter Empörung über das unangemessen freche Verhalten des schwachen Geschlechts gleiten wir nach kurzer Aufregungsphase wieder in den Dämmermodus. Als sich das Spiel allerdings wiederholt, fühlen wir uns tief in der Ehre getroffen und zu einer wirksamen Reaktion herausgefordert. Weil mein Bett das obere neben der Tür ist und zwischen Bett und Tür noch ein Schrank steht, postiere ich mich, mit einem Kleiderbügel bewaffnet, auf eben diesem. Tatsächlich öffnet sich die Tür erneut, ich hebe bereits Arm und Bügel zum finalen Schlag, als unsere Klassenlehrerin in der Tür mich mit der Frage erblickt, was ich da oben zu suchen hätte. Meine Antwort ist mir entfallen. Jedoch weiß ich, dass wir die Mädchen nicht verpetzen und die Lehrerin uns zur Ruhe mahnt mit dem Hinweis, dass sie nun zur Leiterbesprechung ins Nebengebäude ginge. Nach dieser Beinahekatastrophe, ausgelöst durch die Provokationen der Mädchen, schwören wir blutrünstig Rache und hören mit innerem Vergnügen, dass wir nun ohne Lehreraufsicht mit den Mädchen allein im Hause wären. Wie Indianer schleichen wir unhörbar die Treppe hinab, öffnen die Tür zum Mädchenzimmer, stehen in Raumes Mitte und wissen vor lauter Verlegenheit nicht, wie unsere Rache aussehen soll. Die Mädchen selbst liegen in ihren Betten. Mit bis zu den Ohren hochgezogenen Decken blicken uns mit sicherlich vor Schrecken geweiteten Augen an. Wir Jungs sind uns ohne weitere Abstimmung einig, dass hier nichts zu holen ist, und wollen gerade den geordneten Rückzug antreten, als wir die dem Mädchenzimmer gegenüberliegende Haustür quietschen und Schritte sich nähern hören. Katastrophe! Blitzschnell muss eine Lösung her, bevor wir entdeckt würden! Ohne weiteren Verzug sucht sich jeder Junge ein passendes Versteck im Zimmer. Die meisten verschwinden unter den Mädchenbetten auf staubigem Holzfußboden, ich presse mich in einen Winkel hinter dem großen Kachelofen. Lediglich Frank V., der den Ausflug mit einem Gipsarm bestreitet, sucht sich sein Versteck unter der Bettdecke einer Schülerin. Das bekommen wir natürlich alle mit und bewundern unseren Draufgänger, denn über die körperlichen Eigenentwicklungen von Mädchen sind wir schon informiert. Die Tür öffnet sich und unser Fräulein T. betritt den Raum. In der Annahme, dass die Mädchen bereits schliefen, beendet sie mit einem gehauchten „Schlaft schön weiter!“ zufrieden ihren in Dunkelheit absolvierten Inspektionsgang. Wir sind den Mädchen äußerst dankbar, dass sie uns nicht verraten haben, wissen aber, dass wir nun so schnell wie möglich in unserem Zimmer zu verschwinden hätten. Das Öffnen der Mädchentür mit der hinausquellenden Jungenschar geschieht jedoch gleichzeitig mit dem erneuten Öffnen der Haustür, durch die nun alle mitgereisten Lehrer samt Heimleiter verblüfft unseren fluchtartigen Rückzug zur Kenntnis nehmen. Bis die Herrschaften sich von diesem Anblick erholt und unser Zimmer erreicht haben, liegen wir alle bereits in unseren Betten und sind in den tiefen sozialistischen Schlaf der Gerechten gefallen – was den Heimleiter allerdings wenig beeindruckt. Mit Donnerstimme befiehlt er uns aufzustehen, die Betten abzuziehen, unsere Sachen in die mitgebrachten Koffer und Rucksäcke zu packen und zum Abmarsch anzutreten. Wir sollen unter seiner Leitung noch in gleicher Nacht zu Fuß bis zum Geraer Bahnhof marschieren, um mit dem ersten Frühzug in Richtung Mittweida abzudampfen. Und das schon am ersten Tag! Jeder von uns denkt bereits ängstlich an das zu erwartende heimische Donnerwetter. Nur einer darf im Schlafraum zurückbleiben: ausgerechnet Frank V. mit seinem Gipsarm, der als einziger zu einem Mädchen ins Bett gekrochen war! Durch stockfinstere Nacht schlurfen wir schwer beladen hinter dem Leiter her auf der Straße nach Gera – bis er plötzlich von der Straße direkt in dunklen Tann abbiegt. Da ist uns klar, dass er uns nicht heimschicken, sondern eine Strafaktion durchführen will. Was uns sehr Recht ist, bleiben doch damit unsere Hinterteile vor häuslichen Misshandlungen bewahrt! Da in der Nähe Panzerketten rasseln und -motoren heulen, hat er uns vermutlich auf einen Truppenübungsplatz geführt. Da gibt es viel Schlamm, böses Gestrüpp, tiefe Krater, in die wir samt Gepäck hinunterfallen und mühsam wieder hinauskriechen. So geht es bis zum Morgengrauen. Völlig verdreckt, übermüdet und kaputt erreichen wir unsere Unterkunft, froh nicht heimgeschickt worden zu sein. Auch den nächsten Befehl des Leiters befolgen wir: Waschen von Kleidung und Körpern, Säubern der Gepäckstücke, Neubeziehen der Betten und Antreten zum allmorgendlichen Frühsport, der aus einem langen Lauf zur Donar-Eiche und zurück führt. Ans Frühstück schließt sich eine Ganztagswanderung an…
Eine gewisse Versöhnung mit den Mädchen, deren Aktionen den ganzen Schlamassel hervorgerufen hatten, gibt es am Abschlussabend. Es wird getanzt, und wir als einzige männliche Anwesende werden von den Mädchen erstmals in sonderbare Beinverrenkungen eingeführt, die sie Foxtrott nennen. Auf Initiative und mit Hilfe von Fräulein T. sorgt unser jux primae noctis sogar für einen weiteren kulturellen Höhepunkt. Wir tragen die ganze Begebenheit auf die Melodie „Auf der schwäb'schen Eisenbahn“ vor.
Ein besonderer Konflikt sollte sich in der 6. Klasse ergeben: Meine Großeltern und die meisten Verwandten mütterlicherseits waren nach dem Krieg aus dem Sudetenland vertrieben worden und hatten ihre neue Heimat in den westlichen Zonen gefunden. Die Großeltern waren in einem hessischen Bauernhof zwangseinquartiert worden, was in ihrem Fall wegen ihrer Tüchtigkeit und der Aufnahmebereitschaft der Bauernfamilie problemlos verlief. Obwohl ihr Leben nach dem psychisch hochgradig belastenden Totalverlust von Freunden, Heimat, Haus, Grund, Beruf, Wertgegenständen und dem kompletten Neuanfang in fremder Umgebung alles andere als rosig war, sie sich erst Anerkennung erarbeiten mussten, schickten sie uns besonders vor Weihnachten regelmäßig heiß ersehnte Pakete mit Kleidung, Backzutaten und anderen leckeren Inhalten. Unsere Mutter bekam alle zwei Jahre die Genehmigung, mit uns Kindern ihre Eltern in Hessen zu besuchen, während unser Vater stets als Pfand für unsere Rückkehr in der DDR verbleiben musste. Im kleinen hessischen Altenmittlau fand ich vom ersten Tag an gleichaltrige Freunde in der Nachbarschaft, Bauernsöhne, mit denen ich auf die Äcker ging, Scheunen erkundete, Futter von den Feldern holte, Fußball spielte. Aus den während der jeweils drei Wochen dauernden Ferien im Westen gewann ich Erfahrungen, mit denen meine Ostkarriere frühzeitig ins Stolpern geriet.
1956 Besuch in Altenmittlau
Ein Unterrichtsfach politischen Inhalts (wie später das Fach Staatsbürgerkunde) gab es noch nicht, weshalb unser Chemielehrer mit dem bezeichnenden Namen Feind jede dritte Fachstunde zur Politikstunde umzufunktionieren pflegte. Statt um Magnesium und stinkende Buttersäure ging es dabei um die nicht weniger anrüchigen, kriegslüsternen, dunklen Mächte des Westens, die waffenstarrend nur auf eine Gelegenheit zur Beseitigung des DDR-Sozialismus lauerten - und natürlich um das sich als Retter anbietende liebenswerte sowjetische Brudervolk. Mit offenen Mündern auf unseren Klappsitzen herumrutschend, lauschten wir seinen Worten und konnten so viel hasserfüllte Bosheit des Westens kaum glauben.
Einmal allerdings, kurz nach einem unserer Westbesuche, wagte ich in kindlicher Naivität den Widerspruch: Herr Feind hatte seine drastischen Ausführungen über die im Westen angeblich grassierende Armut und Arbeitslosigkeit, über das Leiden von Arbeitern und Bauern unter der kapitalistischen Knute beendet und das rettende Eingreifen der Volksarmee in Aussicht gestellt, als ich mich meldete und vom letzten Westaufenthalt berichtete. Von Bauern mit eigenen Traktoren und Mähdreschern, von deren Mercedes, von Geschäften voll Obst, Gemüse, Süßigkeiten und fröhlichen Kirchweih- und Volksfesten. Ich flog auf der Stelle aus der Klasse! Von unserem Vater um eine Erklärung ersucht, zeigte der damalige Schulleiter R. durchaus Verständnis für den väterlichen Ärger, bat aber auch um Nachsicht. Denn der Chemielehrer wäre zu dieser Darstellung des Westens verpflichtet. Noch eine weitere Information erhielt unser Vater, die nicht wenig zu der späteren Entscheidung zum Verlassen der DDR beitragen sollte; doch dazu später. Ich durfte nach diesem Gespräch jedenfalls in meine Klasse zurückkehren.
Trotz dieses ernüchternden Ereignisses überwiegt im Rückblick der Eindruck einer schönen und erfüllten Kindheit und Schulzeit, wozu in besonderer Weise das Fach Deutsch beitrug. Natürlich diente auch dieses der Herausbildung eines sozialistischen Klassenbewusstseins, indem klassische Literatur nur fragmentarisch mit Szenen rezipiert wurden, die gut ins System passten bzw. in diesem Sinne zurechtgebogen wurden (vorzugsweise Heine, Hauptmann, Schiller). Objektiv nützlicher war der gründliche Sprachunterricht, wobei die Regeln von Interpunktion, Tempus, Modus, Orthographie und generell Grammatik bis zum Überdruss geübt wurden. Auch wenn ich nie etwas vom Auswendiglernen von Gedichten hielt und deshalb dabei rege schummelte, ging mir nichts über Lesen und Schreiben. Weil im Wohnzimmer die mütterliche Schreibmaschine schon immer lockte, tippte ich Unterrichtsverläufe und Hausaufgaben zuweilen auf diesem Teufelsding, was meine Rechtschreibkenntnisse nahezu perfekt werden ließ. Jedenfalls brachte ich alle Diktate mit der Bestnote nach Hause. (Sehr viel später nahm ich als Lehrer mit meiner Klasse in Luxemburg an dem von Heinrich Böll verfassten Deutschland-Diktat teil – und gehörte zu den Wenigen, die die erheblichen Hürden fehlerlos gemeistert hatten.)
Unangefochten an erster Stelle rangierte das Lesen von Kinder- und Jugendbüchern, deren die DDR viel zu bieten hatte. Sogar in finsterer Nacht brachte eine Taschenlampe unter der Bettdecke Licht in den Wilden Westen und das abenteuerliche Universum von Karl May - schließlich schliefen Bruder und Eltern im gleichen Zimmer und durften davon nichts mitbekommen. An Karl Mays dickleibige Bücher kam ich allerdings nur auf krummem Wege heran. Aus öffentlichen Bibliotheken verbannt und offiziell totgeschwiegen, drückten sich die meisten May-Bände fast verschämt im untersten Regal der Kirchenbücherei, in bejammernswertem Zustand, teils zerfleddert und mit fehlenden Seiten. Von den mehr als 30 der in unserer Laurentiuskirche gebunkerten Bänden habe ich alle förmlich gefressen.
Gesundheit = Reichtum
Auch der offiziell geförderten Literatur stellte ich nach, egal ob es sich um die Hefte von „Fröhlich sein und Singen“, „Mosaik“, „Onkel Toms Hütte“ oder Indianergeschichten, wie „Lederstrumpf“ und „Tatanka Yotanka“, ging. Sehr gut sind mir übrigens die Umstände des letztgenannten Buches über den Häuptling der Dakotah in Erinnerung:
Am Gründonnerstag 1957 verspürte ich während des Schmökerns auf heimischer Couch nach anfänglichem Ziehen im rechten Unterbauch zunehmend Schmerzen, zu denen sich bald auch Fieber gesellte. Die vom Kinderarzt Dr. R. zu Hause diagnostizierte Blinddarmentzündung mit sofortiger Einweisung ins Mittweidaer Krankenhaus freilich beeindruckte die Fahrbereitschaft des Roten Kreuzes wenig. Die reizvolle Vorstellung, mit Tatü-Tata durch die Stadt kutschiert zu werden, verblasste mit zunehmender Wartezeit, in der ich mich vor Schmerzen auf dem Sofa wand. Gegen Abend ging's dann plötzlich ganz schnell. Auf der Liege durchs Treppenhaus, ins Auto, zum Krankenhaus, wo ich gleich unters Messer kam. Ausgesprochen blöd, denn nun musste ich wohl oder übel Ostern dort verbringen, ohne Eiersuche und Geschenke! Doch oh Wunder: Am Ostersonntag stand plötzlich eine Gruppe Krankenschwestern im Zimmer und sang für uns Kinder Frühlingslieder, und meine Eltern brachten das bereits erwähnte Indianerbuch. Ostern war halbwegs gerettet.
Weil ich mich generell stabiler Gesundheit erfreuen durfte, sind mir die wenigen sonstigen Unpässlichkeitsmomente noch immer präsent:
Da litt ich ausgerechnet in der heiß ersehnten Karnevalszeit der frühen 50er an Ziegenpeter (Mumps) und drückte neidisch am Wohnzimmerfenster die Nase platt beim Anblick der verschneiten Straße, auf der hauptsächlich Indianer, Trapper und Mädchen in farbenfrohen Phantasiekleidern hinunterschlitterten - ohne mich, der ich bestens vorbereitet war mit den vom Vater an die dunkle Hose angenähten dreieckigen Fransen und mit breitkrempigem Cowboyhut aus Papier.
Ein anderes Übel fiel mir anfangs gar nicht so sehr auf. Es wurde besonders nach dem Badengehen mit der Jungengruppe in der Mittweidaer Aue deutlich. Unser Weg führte dort, wo heute das Neubaugebiet der Lauenhainer Straße Erinnerungen zu ersticken droht, an Feldern reifen Getreides entlang, dessen Blütenstaub wir gern mit den Händen zu Pollenwolken aufwirbelten. Wenige Minuten später stellte sich bei mir heftiges Augenjucken ein, das ich mit Reiben zu lindern versuchte, aber lediglich das fast völlige Zuquellen provozierte. Der Heuschnupfen sollte mir bis weit ins Erwachsenenalter treu bleiben. Erstaunlich war, dass er nur bei der ersten Gräserblüte loslegte und mich bei der zweiten farbenfrohen Naturexplosion des Jahres komplett verschonte. Dann war ungebremstes Herumtollen auf den Wiesen, besonders auf den Hängen des Huckel angesagt, was nur schmerzhaft wurde, wenn man in der Badehose durch dichten Brennesselbestand rollte. Die weniger schmerzhaften Taubnesseln sammelten wir übrigens in Schachteln und Körben, was bei der Abgabe in der Hirsch-Apotheke ein paar Pfennige einbrachte. Das änderte sich auch mit der Vergesellschaftung des landwirtschaftlichen Besitzes nicht. Das nunmehr sozialistische Getreide und die ebenso in klassenkämpferischem Geist heranwachsenden
Brennnesseln verhielten sich keinen Deut anders als zuvor.
Ein Drittes soll den Abschluss zum Thema Gesundheit im Kindesalter bilden: Es war 1959 oder 1960, als ich in der Küche daran ging, ein stumpf gewordenes Küchenmesser zu schleifen, indem ich es durch zwei Schleifrädchen hindurch zog, die ich mit der rechten Hand an einem Griff festhielt. Das Messer hatte eine kleine Scharte, sprang genau dort aus der Führung und verletzte den rechten Zeigefinger und Mittelfinger. Meine neben mir stehende Mutter wollte gerade ein Heftpflaster für die Wunde holen, als sie einen Teil des Zeigefingers in der Schöpfkelle unter dem Tatort entdeckte. Mit Notverband und hoch erhobenem Arm eilten wir zuerst zum Kinderarzt in der Rochlitzer Straße, von dort weiter ins Krankenhaus zum Röntgen. Der diensthabende Medizinmann lobte den sauberen Schnitt, den man mit einem Skalpell nicht besser hätte hinbekommen können, legte einen Blut stillenden Verband an und gipste die Unfallstelle bis zum Ellenbogen ein. Wiedervorstellung in einer Woche. Ausgerechnet rechts! Welch Jammer, denn jetzt konnte ich keine Hausaufgaben machen, konnte nicht mehr die Schreibmaschine nutzen! Bei der erneuten Vorstellung unterlief dem Arzt ein folgenschwerer Irrtum, der mir einige Jahre später zugutekommen sollte. Er sah den gerade eingegipsten Finger und fürchtete, dass ich mit gerader Fingerkuppe nie mehr würde schreiben können. Also bog er die Kuppe um ca. 80 Grad und gipste das Ganze erneut ein. Und so ist der rechte Zeigefinger bis heute geblieben. Die anatomische Fehleinschätzung des Arztes bestand darin, dass er nur die durchschnittene Streckersehne sah, die Bedeutung der intakten Beugersehne, die den Finger aus der geraden Position jederzeit hätte beugen können, aber völlig vernachlässigte. Zeitsprung: Als ich im Sommer 1968 im Kreiswehrersatzamt Hanau zur Bundeswehr gemustert wurde, bemerkte der Militärarzt die herunterhängende und damit die Truppe, wenn nicht gar die gesamte Bundeswehr und NATO demoralisierende Wirkung meiner Fingerkuppe sofort: „Sie können damit noch nicht mal militärisch richtig grüßen. Da fangen ja alle an zu lachen!“ Und so fand sich auch dafür ein letztlich versöhnlicher höherer Sinn, der mir freilich am Tag des Fingerschnitts verborgen bleiben musste.
Im ereignisreichen Sommer 1961 empfand ich es als Katastrophe, dass mir der Mittweidaer Augenarzt zwecks Behebung häufiger Kopfschmerzen eine Brille verordnete – die ich auch noch ständig tragen sollte! Wie sollte das gehen beim Toben in den herbstlichen Strohbergen am Monarchenhügel neben dem Flugplatz, beim wilden Räuber-und-Gendarm-Spielen an Steilufer und Felsen der Zschopau? Waren Schwimmen, Tauchen und der gerade begonnene Kanusport in der Zschopau noch möglich? Der brillengeschärfte Blick sollte allerdings nur wenige Tage auf den DDR-Sozialismus fallen. Doch dazu später. Denn ein Rückblick auf Kinder- und Schulzeit bliebe unvollständig ohne einen würdigenden Blick auf Grünlichtenberg und Topfseifersdorf.
Topfseifersdorf – Ort der Geborgenheit
Topfseifersdorf, bereits als Sonntagsausflugsziel erwähnt, war der vertraute Geburtsort meines Vaters, Wohnort der Großeltern und weiterer Vorfahren, von denen ich für recht kurze Zeit nur den Großvater Karl, der in den Urkunden zuweilen auch mit C geschrieben wurde, inmitten seiner Elektrikerwerkstatt mit einem großen Osram- Emailleschild an der Wand vor mir sehe. Um die Großmutter Flora kennenzulernen, war ich noch zu klein; und als ich soweit war, war sie bereits gestorben. Wie uns Kindern mitgeteilt wurde, hatte sich bei ihr während eines Krankenhausaufenthaltes in Mittweida durch Lachen ein Blutgerinnsel gelöst und dadurch das Ende herbeigeführt. So verstand ich endlich auch, was es mit dem Sich-Totlachen auf sich hatte.
Der Dreiseitenhof mit offener Seite zur Hauptstraße bestand aus einem kleinen, zentral gelegenen Bauernhaus mit noch kleinerem Nebengebäude, in dem Frau Schirm regierte und ihre Hühner hütete. Diesem gegenüber eine große hölzerne Scheune. Alles zusammen war das Reich von Hubert Klein, dem ältesten Bruder meines Vaters, seiner Frau Lene und von Lotte, der von allen Klein-Jungs hoch geachteten älteren Schwester. Ein Zauber ging von diesem Anwesen aus, der schwer zu erklären ist. Vielleicht waren es die zahlreichen Familienausflüge zu Fuß oder per Bus dorthin und die von der Bushaltestelle Winterschänke kilometerlange Wanderung auf löchriger und staubiger Landstraße bis ins Dorf. Im Sommer war die Luft vom Tirilieren der Lerchen gefüllt, der Weg, zu beiden Seiten der Straße mit Margeriten, Klatschmohn und Kornblumen gesäumt, lud zum Blumenpflücken ein.
Topfseifersdorf mit Lotte Lene, Hubert, Vati und Günter
Onkel Hubert war während der Woche seltener zu Hause anzutreffen. Und wenn er mal mit dem Bus spät von der Arbeit in der Oehmeschen Küchenmöbelfabrik aus Mittweida heimkam, so war er auch oft schon wieder weg: in der Scheune, wo er als Tischler seine private Werkstatt hatte, im Bienenhaus oder im weitläufigen Garten mit der Sense beim Grasmähen. Tante Lenes Stimme höre ich bis heute laut durchs Grundstück hallen. Energisch hielt sie den Haushalt zusammen, kümmerte sich um Gemüsegarten, Hühner und ein paar Ziegen. Auch der allabendliche Gang auf den nahen Friedhof um die evangelische Dorfkirche mit dem nadelspitzen Turm oberhalb des Hauses gehörte dazu, wo die auf dem Großelterngrab stehenden Stiefmütterchen vor dem Verdursten bewahrt werden mussten. Unter dem Grabstein mit der Aufschrift „Familie Klein" waren nicht nur Großmutter Flora und Großvater Karl Klein beerdigt, sondern es wurde auch an Otmar erinnert, den im Krieg gefallenen einzigen Sohn von Hubert und Lene, und an Adolf, den jüngsten der Klein-Brüder, der lange Zeit als verschollen galt und erst spät auf einer belgischen Kriegsgräberstätte entdeckt wurde. Gießwasser für den Friedhof holte man mit schweren Zinkeimern und Gießkannen aus dem Dorfbach am Fuße des Hügels. Dort herrschte meist gute Strömung, was für mich immer wieder Anziehungspunkt war, um selbstgeschnitzte Boote zu Wasser zu lassen. In dieser Kirche oberhalb des Baches hatte ich meine erste Begegnung mit dem Tod. Auch die wenigen Katholiken traten ihre letzte Reise von dort in den rund um die Kirche liegenden Friedhof an. Unser dafür zuständiger Mittweidaer Pfarrer fuhr eines heißen Tages mit der Haushälterin auf dem Beifahrersitz und mir als Ministrant auf der Rückbank des alten Opel P 4 über die Dörfer nach Topfseifersdorf. Heute fast ein Katzensprung, war es damals für das betagte Auto eine kaum bewältigbare Strapaze. Als der unbefestigte Fahrweg einen Hügel hinaufging, blieb der Opel auf halber Höhe keuchend und bebend stehen. Der Pfarrer hieß seine beiden Mitfahrer aussteigen, rollte hundert Meter zurück und schaffte es beim zweiten Versuch mit Vollgas und Gottes Anschub bis zum Gipfel. In der Kirche lag der Tote im offenen Sarg vor dem Altar, was wegen seiner ungesund fleckigen Haut und des unangenehmen Geruchs für meine Augen und Nase keine angenehme Erfahrung war. Der Rückweg übrigens stellte Nase und Augen erneut auf die Probe. Zuerst kam der Geruch, dann der Rauch: Unter meiner Rückbank brannte es. Der Pfarrer bremste abrupt, löschte beherzt mit einer Decke - und setzte die Fahrt im nun nur noch stinkenden Auto ungerührt fort.
Eng verbunden war ich Tante Lotte, einer hübschen, in den ersten Jahren dunkelhaarigen und temperamentvollen ledigen Frau, die in der Leipziger Straße von Mittweida arbeitete und auf dem Weg zum Busbahnhof häufig in der Melanchthonstraßes vorbeischaute. Sie hatte ihre Arbeit in einer hochinteressanten Lebensmittelverteilstelle gefunden: Hinter der Eisenbahnunterführung befand sich damals ein Flachbau mit Lagerhalle, von dem die staatlichen Konsumläden der Region mit Lebensmitteln versorgt wurden. Wenn Tante Lotte in ihrer warmen Herzlichkeit an unserer Wohnungstür klingelte, schlugen Kinderherzen höher, hatte sie doch immer etwas Besonderes dabei, Schokolade oder prachtvoll große, süße Äpfel aus einem fernen Land namens China. Tante Lotte war meine Patentante und bewohnte auf derselben Ebene mit Hubert und Lene im oberen Stockwerk ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Gekocht wurde für alle in Lenes Küche auf dem Kohleherd. Wasser musste man in den ersten Jahren per Zinkeimer aus dem Untergeschoss, wo eine Handschwengelpumpe das kostbare Nass aus dem hauseigenen Brunnen förderte, über die steile Holztreppe hochschleppen. Später sorgte ein von Onkel Hubert eingebautes elektrisch betriebenes Hauswasserwerk für geringeren Arbeitsaufwand, weil nun über Leitungen das kostbare Nass direkt in Lenes Küche verfügbar war – welch Luxus!
Es gehörte zum Ritual, das Pfingstfest in „Topsdorf“ zu verbringen. Dann kam der Großteil der Kleinsippe zusammen. Die drei dort wohnenden Kleins hatten bei zumeist sonnigem Wetter auf der Wiese im Schatten der Obstbäume eine Tafel bereitet. Die selbst gebackenen Apfel- und Pflaumenkuchen und das im nahen Gasthaus gekaufte Bier für die Großen, grüne, gelbe oder rote Brause für die Kleinen, die heimliche Stippvisite in Tante Lenes Beerenparadies – ein Traum! Aus dem nahen Burgstädt reisten Vatis Zwillingsbruder Karl mit seiner Frau Doris und den beiden Kindern Renate und Wolfgang an, und mit Fritz und Frieda Oehme aus Mittweida saßen mindestens 13 Personen an der Kaffeetafel. War das Wetter weniger gut, wurde es in der Kleinschen Wohnstube eng. Beherrschendes Gesprächsthema der drei Brüder war der vor noch nicht einmal 10 Jahren zu Ende gegangene Zweite Weltkrieg. Eine makabre Faszination schien von diesem schrecklichen Ereignis auszugehen, erklärbar nur durch das „Kennenlernen" weit entfernter fremder Länder, Menschen und Kulturen, eigener Grenzerfahrungen und von Unausgesprochenem, das gewiss im Innern wühlte. Ist die heutige Begeisterung von Massentouristen damit vergleichbar? Von Kritik am Nazisystem, der barbarischen Behandlung fremder Menschen, von Verstümmelung und Tod ist dabei in meiner Erinnerung nie die Rede gewesen. Selbst der Verlust von Sohn Otmar und Bruder Adolf schien in dieser Runde verdrängt gewesen zu sein.
Grünlichtenberg – Abenteuerspielplatz
Schon der Name des Dorfes zauberte ein Strahlen in Kinderaugen. Dort residierten Liesel und Herbert Voigtländer auf ihrem weitläufigen Vierkanthof mit dem Quellbrunnen in der Mitte, mit vielen Tieren und horizontweiten Feldern. Tante Liesel war als Schwester meiner Topfseifersdorfer Großmutter und von Frieda Oehme die unumstrittene Regentin des Anwesens. In überwältigender Herzlichkeit empfing sie uns, wenn wir es mit dem Bus von Mittweida hinaus nach Grünlichtenberg geschafft und das massive Hofportal durchschritten hatten. Und immer gab es überaus köstlichen, selbst gebackenen Kuchen auf einem Service aus echtem Meißner Porzellan. Onkel Herbert sahen wir seltener, weil er unermüdlich mit den Pferden oder dem Traktor auf den mehr als 100 ha umfassenden Feldern des Gutes unterwegs war, sich um die Tiere auf dem Hof kümmerte. Aber wenn er kam, verbreitete er mit seinem wettergegerbten roten Gesicht immer Fröhlichkeit. Zum Hof gehörten weiterhin die beiden Kinder, meine Großcousine Carola und Großcousin Gerold. Außerdem waren da noch die Magd Lotte und ein Knecht. Während der alte Knecht irgendwann nicht mehr da war und mir auch sein Name entfallen ist, gehörte die geistig behinderte Lotte bis in die 60er Jahre hinein als in das Familienleben integriertes Mitglied zum festen Inventar des Hofes. Eine wortkarge und in Stall und Hof enorm fleißige Frau mit gelegentlichen furchteinflößenden Verbaleruptionen, hinter deren Geheimnis wir nie gekommen sind – allerdings hatten wir dies auch nie ernsthaft versucht. War sie schon immer gestört? Was war der Auslöser? Später vernahm ich von Zeitzeugen, dass es in der Region 1945 zu vielen Vergewaltigungen durch zuerst amerikanische, dann russische Soldaten gekommen war. Lag hier der Grund? Von einem verlorenen Baby war jedenfalls damals schon die Rede, für uns Kinder allerdings hatte das keine Bedeutung.
Die Atmosphäre des Hofes war einfach märchenhaft und ist heute kaum noch erlebbar: Nach Durchqueren des mächtigen Torbogens begann eine andere Welt: links erstreckte sich das dreistöckige Wohnhaus. Im weitläufigen Dachgeschoss standen allerlei Dinge, die kindliche Abenteuerlust reizten, Kisten mit Büchern von der 36er Olympiade, Gerätschaften, Porzellan, hölzerne Schränke und Truhen. In der zweiten Etage befanden sich die Schlafräume von Tante Liesel und Onkel Herbert sowie auf beiden Seiten eines langen Flures Gesindekammern. Das Erdgeschoss hatte einen großzügigen Flur, von dem eine Tür direkt in den Kuhstall führte. Eine zweite Tür öffnete sich zur Küche hin, von der drei Türen abgingen. Eine Tür verband die Küche mit dem Wohnzimmer, in dem schon recht früh ein Schwarz-Weiß-Fernsehgerät zu bewundern war, ein nur sehr selten genutzter absoluter Luxusgegenstand. Eine zweite Tür führte direkt hinaus in den Gemüse- und Blumengarten, die dritte öffnete das unerschöpfliche Reich der Vorratskammer. Im Gegensatz zu Schweinen stinken Kühe nicht, - nein, ihr wohlig-warmer Geruch erfüllte das Haus auf angenehme Weise. Mehr als die Kühe hatten es uns Kindern die Pferde angetan. Etwa vier Stück standen im Stallgebäude gegenüber dem Wohnhaus, kräftige Kaltblüter und mindestens ein Warmblut. Onkel Herbert, als früherer Springreiter noch immer gern hoch zu Ross, ließ uns Kinder ohne Sattel und Aufsicht allabendlich über seine Feldwege in die Gemarkung reiten. An das unterkellerte Pferdestallgebäude grenzte eine offene Halle, in der Pferdewagen, Pflüge, Saatmaschinen, Eggen, der Traktor aus Vorkriegsproduktion, eine mit Dampf betriebene Dreschmaschine und mehr standen, aber auch zwei aus einer anderen Welt stammende prachtvolle Pferdeschlitten. Die anderen beiden Hofseiten waren einerseits von dem mächtigen Scheunengebäude begrenzt, an das sich der Schweinestall anschloss, und auf der anderen Seite von einem Stallgebäude, in dem Hühner, Gänse, Tauben, Ziegen wohnten. Auch einige meiner Mitschüler konnten sich für diesen Hof begeistern.
Gesellschaft, Partei und Schule erwarteten von uns Kindern Ernteeinsätze, wobei es für jede geleistete Stunde eine Marke gab, die man sorgfältig in ein Heftchen klebte. Hatte man eine bestimmte Anzahl derartiger „Aufbaustunden“ abgeleistet und konnte das mit den Märkchen dokumentieren, winkte als Belohnung für die selbstlose sozialistische Aufbauarbeit ein glänzendes Abzeichen aus Pappmaché, das auf dem Schulhof feierlich beim wöchentlichen Fahnenappell vor versammelter Schülerschaft verliehen wurde. Mit etwa 12 Jahren radelten also drei oder vier meiner Klassenkameraden mit mir die etwa 15 km nach Grünlichtenberg, begannen in der Morgendämmerung nach dem Waschen am eiskalten Hofbrunnen mit der Feldarbeit. Bis etwa zwei Stunden später Tante Liesel zum Frühstück rief oder dies in einem Korb zum Feld brachte. Nur von der Mittagspause unterbrochen, setzte sich die teils recht harte Arbeit bis zum späten Nachmittag fort. Danach galt es, die Kühe von der Weide zu holen. Zuvor hatten Knecht und Magd die Ställe ausgemistet. Nun begann für die Erwachsenen die Melkzeit, während wir Kinder bis zum Abendessen und Schlafengehen unserem Erkundungs- und Abenteuerdrang freien Lauf lassen und manchen Unsinn anstellen konnten. Eine höchst anrüchige Begebenheit auf diesem Traumbauernhof wird mir ewig im Gedächtnis bleiben:
das Grünlichtenberger Hofgut
Eines schönen Sonntags fährt die ganze Familie mit dem Bus nach Grünlichtenberg. Wie üblich sind wir Jungs gut gekleidet, wofür schon unser Vater sorgt, der als Schneider immer todschicke Sachen näht, was wir Kinder oft nicht zu schätzen wissen. Jeans gibt es damals noch nicht und mit den väterlichen Knickerbockern und Anzügen verbietet sich hemmungsloses Herumtoben oder das Kriechen auf dem Heuboden von selbst. Am Nachmittag nun stehen mein Bruder Günter und ich auf dem Hof, besuchen die liebe Tierwelt, sorgfältig jeden Kontakt mit Schmutz und anderem Unrat vermeidend, inspizieren zum wiederholten Male den Abenteuerspielplatz Scheune – und entdecken einen großen Bauernwagen auf dem Hof, auf dem ein langes Metallfass lagert. Um dem jüngeren Bruder die Funktionsweise des Ungetüms zu demonstrieren (schließlich bin ich drei Jahre erfahrener als er), ziehe ich an einem Hebel – und stehe buchstäblich in der Scheiße. In dickem Schwall ergießt sich die Jauche über mich. Zwar gelingt mir noch mit dem Schließen des Schiebers das Bannen der Flut, aber wie sehe ich aus? Und wie stinke ich! Verschweigen oder Vertuschen ist unmöglich, also überrasche ich damit die genüsslich an der Kaffeetafel schwafelnde Sonntagsgesellschaft. Tante Liesel rettet mich: Kleider vom Leib - Komplettwäsche im kalten Brunnenwasser – Einkleidung mit Gerolds viel größeren Anziehsachen. Die Rückfahrt im Bus verläuft ungewohnt wortkarg.
Wandeln durch Handeln
Dass die Familie die DDR verließ, war im Vorfeld mit uns Kindern weder abgestimmt noch war uns dieser Schicksal prägende Schritt bekannt. Unsere Eltern standen mit 44 und 47 Jahren fest im Arbeitsleben, hatten einen verlässlichen und stabilen Verwandten- und Freundeskreis, wir Kinder fühlten uns wohl – und dennoch entschlossen sich die Eltern für diese Maßnahme, die unser aller Leben radikal verändern sollte. Es mussten, wie man sich denken kann, gewichtige Gründe sein, die den Bruch mit dem System und vor allem den Abschied vom festen Freundes- und Verwandtenkreis, von der reizvollen sächsischen Vorgebirgslandschaft herbeiführten.
Meiner Mutter, dem Bruder und mir waren die Wohlstandsunterschiede zwischen Ost und West durch unsere Besuchsfahrten deutlich geworden, anders als den meisten Menschen unserer Umgebung und Schule, die mangels Reisemöglichkeit glaubten, was der Staat durch seine Medien über den bösen Westen kommunizierte. Aber es ging den Eltern nicht um den materiellen Wohlstand. Zuhause vermieden sie Kritik an der DDR weitgehend, wussten sie doch, dass wir Kinder in der Schule als Agenten des Systems missbraucht werden und unsere Eltern verraten könnten. Wenn zum Beispiel Lehrer wissen wollten, worüber man sich am häuslichen Tisch unterhalten, welchen Inhalt die Sandmännchen-Sendung vom Vorabend gehabt habe (es gab in beiden deutschen Staaten ein allabendliches, aber unterschiedliches Sandmännchen). Zumindest unser Vater fand in der Schuhmacherwerkstatt L. einen Raum des offenen Wortes, zu dem sich neben ihm und Herrn L. auch ein Volkspolizist als Privatmensch regelmäßig trafen. Unzufriedenheit war generell überall zu spüren, besonders wegen der miserablen Versorgungslage, die nur in den großen Städten befriedigend zu sein schien, aber in unserer Provinzstadt die Menschen immer wieder mit schmerzhaften Entbehrungen geißelte. Da gab es mal kein Fleisch, weder Milch noch Käse oder Honig, Butter war Luxus, selbst für Margarine fand sich ein chemisches Ersatzprodukt, Obst war selten, Gemüse häufig in angegammeltem Zustand, Braunkohlelieferungen bestanden zu großen Teilen aus Kohlenstaub und zerbrochenen Briketts, die in hohen Haufen direkt vom LKW auf den Bürgersteig gekippt und von dort in den Keller verbracht werden mussten. Schuhe und andere Textilien waren zeitweilig nicht oder nur unter den Ladentischen im „Bück-mich-Verkauf“ zu erhalten, Klopapier zumeist Mangelware. Bei den Ferienspielen erhielten wir Schüler*innen drei Blatt mit aufs Örtchen, das musste reichen! Viele Konsumwünsche konnten nur durch gute Beziehungen, durch illegale Bezahlung mit Westgeld oder mit Gegenleistungen erfüllt werden. Die allen gemeinsame Entbehrungssituation und das ähnlich bemessene Einkommen schufen Nähe und Zusammenhalt. Bei vielen Tag für Tag in den Fabriken hart und fleißig arbeitenden Menschen kamen Zweifel an der Sinnhaftigkeit des propagierten Sozialismus auf, der seine besten Produkte in den Westen verkaufte, dort Kaufhaus- und Versandketten zu sagenhaften Umsätzen verhalf, während die eigene Bevölkerung sich mit minderwertiger Ware begnügen musste. Besonders die gut ausgebildete Facharbeiterschaft kehrte in jener Zeit um das Jahr 1960 der DDR den Rücken, um im Westen mit einer eher leistungsgerechten Entlohnung ein besseres Leben zu beginnen, der Bespitzelung zu entgehen, frei zu reden und frei die Welt zu bereisen. Gewiss hatten unsere Eltern wegen der verwandtschaftlichen Bindungen zum Westen ähnliche Gedanken, doch sollten ganz konkrete Ereignisse den Entschluss festigen.
Sommer 1960
Der oben berichtete Zwischenfall mit dem Chemielehrer Feind, der mich wegen meiner die sozialistische Moral zersetzenden Eindrücke vom letzten Westbesuch aus der Klasse geworfen hatte, brachte eine wichtige Erkenntnis: Mein Vater erfuhr im sich anschließenden Gespräch mit dem Schulleiter, dass ich trotz des guten Notendurchschnitts von 1,7 nicht für die Oberschule zugelassen würde.
Als Begründung gab er an, dass pro Klasse nur zwei Kinder aus Arbeiter- und zwei aus Intellektuellenfamilien die Oberschule besuchen dürften und mir als Arbeiterkind andere mit besserem Notendurchschnitt vorgezogen würden. Selbst der in den Parallelklassen deutlich schwächere Notendurchschnitt der besten Schüler könnte an dieser Regel nichts ändern. Nach dieser nachvollziehbaren Entscheidung brachte der Schulleiter allerdings einen Grund vor, der möglicherweise wichtiger war: Er bedauerte, dass ich die sozialistische Jugendweihe zugunsten der katholischen Firmung verschmäht hätte. Und da gäbe es ja noch den Bruder meines Vaters…
Dieser Bruder war um 1950 herum aus einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager in die DDR entlassen worden. Er war noch sehr jung, weil er erst in der letzten Kriegsphase direkt nach einem Notabitur an die Ostfront geschickt und dort bald gefangen genommen worden war. Seine einschneidenden Erlebnisse hat er später in dem autobiografischen Roman „Der Tod geht durch die Taiga“3 und dem Büchlein „Stacheldraht– Hunger – Heimweh“4 festgehalten. Zurück in der noch jungen DDR hatte er an der Universität Leipzig das Studium der Fächer Germanistik, Philosophie, Geographie und Geschichte aufgenommen. Da er in lebensbedrohlichen Situationen während der Gefangenschaft den Wert des Glaubens erkannt hatte, engagierte er sich bei der Gründung der Ost-CDU. Dem Beschluss der Staatsorgane, alle politischen Parteien in der „Nationalen Front“ zusammenzuschließen und auf einheitliche (SED-)Linie zu bringen, widersetzte sich die OstCDU heftig, was der junge Kurt Klein auf öffentlichen Kundgebungen verteidigte und sich gegen die Gleichschaltung aller politischen Parteien aussprach. Der Tipp eines CDU-Parteifreundes versetzte ihn nach einem solchen Kundgebungsauftritt in Panik, denn demnach sollten alle CDU-Redner in derselben Nacht verhaftet werden. Auf der Stelle packte er seine Aktentasche und verließ seine hochschwangere Frau, um über die damals noch nicht stark befestigte Grenze nach Westen zu fliehen. Dort traf er schnell mit Konrad Adenauer zusammen, der künftighin in Ostfragen auch seine Ratschläge einholte. Bevor er in der West-CDU aktiv wurde, holte er mit falschen Papieren seine in Leipzig zurückgelassene Frau samt Baby in den Westen nach. In der Bundesrepublik setzte er das Studium bis zur Promotion in Bonn fort, wurde Studienrat am Bonner Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium und bewarb sich erfolgreich um ein Bundestagsmandat. Dort war er als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses mitverantwortlich für die Gründung der Bundeswehr - und damit publizistische Zielscheibe der DDR-Medien. In Abwesenheit wurde ihm im Osten der Prozess gemacht, der mit der Verhängung der Todesstrafe endete. In der Tageszeitung „Volksstimme“ war nicht nur sein Name erwähnt, sondern auch, dass er Verwandte in der DDR habe. Dies war ein weiterer Grund für die staatliche Verweigerung des Oberschulbesuchs, ein Hauptmotiv der Eltern für das Verlassen des Landes. Als Beweis sozialistischer Rundumfürsorge hatte der Schulleiter einen Katalog bereit, aus dem er meinem Vater vorlas, dass ich 1964, also drei Jahre später, eine Lehrstelle im städtischen Spinnereikombinat aufzunehmen hätte.
Auch eine Verbesserung der prekären Wohnraumsituation schien bei dieser Art Sippenhaftung unmöglich. Unsere kleine Wohnung mit Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer musste den Eltern, das wurde einem als Kind natürlich nicht klar, ein Graus gewesen sein, weshalb sie sich seit mehr als zehn Jahren bei der staatlichen Wohnungsvergabestelle um eine neue Wohnung hatten registrieren lassen. Zu ihrer Enttäuschung waren sie jedoch bei jeder Fertigstellung neuer Wohnviertel leer ausgegangen.
Seitenwechsel
Eine legale Ausreise aus der DDR war damals undenkbar. Illegale Grenzübertrittsversuche wurden streng geahndet, zumeist mit Zuchthaus, Kinder ihren Eltern weggenommen. Die Wirtschaft hatte bereits zu viele Facharbeiter verloren und der Staat musste, wenn die 5- und 7- Jahrespläne erfüllt werden sollten, etwas unternehmen, um die mit ihrem Leben Unzufriedenen zu halten. Millionen von DDR-Bürgern freilich misstrauten dem angeblich bevorstehenden kommunistischen Paradies und bevorzugten die materiell sichereren und freieren Lebensbedingungen des Westens. Auch wenn die Zeit der Lebensmittelkarten gegen Ende der 50er Jahre beendet war, befand sich die Versorgung der DDR-Bevölkerung in beklagenswertem Zustand. Zusätzlich zu den bereits dargestellten Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln, teils verdorbenem Obst und Gemüse war meist auch kein Reparaturmaterial zu erhalten, wenn in den oft maroden Wohnungen ein Schaden auftrat. So brach im Topfseifersdorfer Idyll ein ganzer Mauerabschnitt unterhalb der Erdgeschossfenster heraus. Abhilfe fand, wer zum Staatsapparat gehörte, über gute Beziehungen oder Westgeld verfügte. „Bückware“, Ware, die man für besondere Kunden unter dem Ladentisch vorhielt, war üblich. Die beiden Tanten, unser Onkel Hubert war bereits verstorben, konnten die notwendige Maurerarbeit und das benötigte Material nur gegen Westgeld erhalten. Es war auch die Zeit, in der immer wieder Nachrichten von Gasvergiftungen an unsere Kinderohren drangen und sich mir das Bild eines im Fensterkreuz seines Hauses in der Leisniger Straße erhängten Selbstmörders einprägte. Die Stimmung war schlecht.
Die Eltern mussten unsere Grenzüberschreitung schon 1960 oder früher geplant haben, hatten, um die Durchführung des Plans nicht zu gefährden, uns Kinder natürlich nicht eingeweiht. So wurde uns der Sinn mancher Maßnahme erst im Nachhinein verständlich. Dazu gehörte beispielsweise, dass im Jahre 1960 wir Kinder von unseren Eltern angehalten wurden, möglichst häufig Stunden im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks (NAW) abzuleisten. Mit den für jede Arbeitsstunde ausgegebenen NAW-Marken konnten wir zahlreiche Ernteeinsätze und die Mithilfe beim Schwimmbadbau in Mittweida dokumentieren. Besonders bei letzterem waren wir mit unserem Vater recht oft an Samstagen tätig. (Nachdem von der Bevölkerung mit Hacken, Spaten, Schaufeln und Schubkarren das Becken ausgehoben war, wurde übrigens alles mit Planierraupen wieder zugeschüttet.)
Ich wurde nicht misstrauisch, als mein Bruder und ich zu Schuljahresbeginn 1960/61 unsere Aufbaumarken nicht mehr fanden. In der Schule hätte ich für meinen Einsatz gewiss eine Medaille mit öffentlichem Lob erhalten. Das erhielt stattdessen unser Vater. Denn im Spätherbst erschien ein Artikel mit seinem Bild in der Volksstimme. Er wurde öffentlich für seine beispielhaften und selbstlosen NAW-Einsätze geehrt. Kein Staatsbürger hatte im Bezirk Karl- Marx-Stadt so viele Marken wie unser Vater vorzuweisen. Dadurch hatte er sich für die Staatsorgane als ein so vorbildlicher Sozialist qualifiziert, dass man seinem Wunsch, Frau und Kinder beim nächsten Westbesuch erstmals begleiten zu dürfen, nicht widersprechen mochte. Damit war die wichtigste von zahlreichen Hürden geschafft.
Auch in der Abschiedsphase vom real existierenden Arbeiter- und Bauernstaat erhielt die oben schon beleuchtete „Küchenmöbelfabrik Friedrich Oehme" finale Bedeutung, die ich im letzten Kapitel meiner Erinnerungen für den jetzigen Eigentümern festhielt5:
Wechsel
Zu erahnen war’s nicht, - jedenfalls nicht von mir mit meinen 13½ Jahren. Die Eltern hatten seit 1 Jahr mit monatlich einem Paket zu den mütterlichen Großeltern im Westen und dem Verschenken wertvolleren Wohnungsinventars an die Topfseifersdorfer Verwandtschaft die unerlaubte Übersiedlung nach Westdeutschland vorbereitet. Ich wunderte mich allerdings sehr, dass unser tolles Wohnzimmerradio aus Stassfurter RFT-Produktion, auf das die Eltern mehr als 1 Jahr gespart hatten und an dessen Lautsprecher meine Ohren klebten, um Radio Luxemburg zu hören, urplötzlich verschwunden war, ersetzt durch das alte plärrende, krankenhausbeige Plastegerät aus den 40ern. Zwei Wochen vor der entscheidenden Aktion kam Unruhe in die Familie: Die engsten Freunde und Verwandten wurden in ungewohnt dichtem Rhythmus besucht. Sehr seltsame Abschiede, denn es wurde geherzt und gedrückt und fast immer flossen Tränen. Das waren nicht die bei normalen Besuchen üblichen Abschiede.
Meinen um 3 Jahre jüngeren Bruder hatten die Eltern zuvor bei Freunden in Klöden bei Jessen untergebracht, er sollte nichts von den Vorbereitungen mitbekommen und deshalb auch nichts ausplaudern können. Ich musste versprechen, alles für mich zu behalten, und hielt mich auch streng daran, doch mit gemischtem Gefühl. Einerseits Vorfreude auf das Leben bei und mit den Großeltern, die nach dem Krieg als Flüchtlinge aus dem Sudetenland in Hessen gestrandet waren und eine winzige Wohnung bewohnten, auf die Jungs im kleinen Dorf, mit denen ich bei den seltenen Besuchsfahrten Fußball gespielt, den Spessart durchstreift, Freundschaft geschlossen hatte. Andererseits Wehmut, weil kein richtiger Abschied von meinen bisherigen Freunden möglich war. Ja sogar Ärger empfand ich, weil bei all der tränendurchsetzten Drückerei mir auch eine Menge Geld in die Hand gedrückt wurde. Wäre das früher geschehen, hätte ich mich sehr darüber gefreut, weil mein Traum vom grünen Diamantrad mit Gangschaltung hätte erfüllt werden können. Jetzt war der Geldsegen völlig unnütz, wurde von den Eltern eingesammelt und verschenkt.
Am frühen Nachmittag des 3. August 1961 war es dann soweit: Ein Pfiff, unser Zug setzt sich schnaufend vom Bahnhof Mittweida nach Leipzig in Gang. Die Eltern öffnen die Fenster auf der rechten Seite. Warme Sommerluft und Kohlenrauch. Nach wenigen Hundert Metern sehen wir die Fabrik kommen. Ich schaue etwas wehmütig in „meinen“ Garten, - doch dann: Über die gesamte Breite des letzten großen Fensters des Maschinensaals ist ein weißes Laken gespannt: „Auf ein gesundes Wiedersehen!“. Daneben Onkel Hubert winkend, wir winken innerhalb des Abteils zurück, Tränen. Zum Wiedersehen mit ihm kommt es nicht mehr. Mit jedem Kilometer mehr entschwinden Freunde, Verwandte, Heimat, Kindheit unwiderruflich, stattdessen wächst – mit zeitlichem Abstand – Patina der Nostalgie. Fotos im Kopf.
Der eigenartige und einmalige Verlauf des Abreisetages hat sich fest in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Vater Josef Klein, meine Mutter Anni Klein, geborene Dittrich, und ich, der dreizehneinhalbjährige Sohn Dieter, hatten mit Rucksack und Koffern den letzten gemeinsamen Gang zum Bahnhof Mittweida angetreten, als plötzlich eine engste Vertraute der Familie, die Hebamme Frau F., an unserer Seite war. Sie weinte und schluchzte lauthals - sehr gefährlich, weil ein so starker emotionaler Abschied anlässlich eines „normalen" Westbesuchs uns verdächtig gemacht und das ganze Unternehmen in Frage gestellt hätte. Nachdem die Eltern sie mehrfach vergeblich zum Heimgehen gedrängt hatten, schlug sie vor: Sie würde nach Hause gehen, wenn wir nicht erst in Klöden, wo wir meinen Bruder abholen wollten, übernachten, sondern unverzüglich am gleichen Abend mit dem Bruder weiterfahren würden. Notgedrungen versprachen dies die Eltern und Frau F. verschwand weinend in Richtung ihrer Wohnung. Später sollte sich das Geheimnis um ihr sonderbares Verhalten lüften.
Gemäß dem gegebenen Versprechen setzten die Eltern in Klöden, anstatt bei den lieben Freunden zu übernachten, mit meinem Bruder Günter und mir die Reise fort.
Irgendwann in der Nacht erreichen wir die Grenze Wartha/Herleshausen. Die Situation gespenstisch: totale Finsternis, durchbrochen von grellem Scheinwerferlicht, das auf Bahnsteig und Zug gerichtet ist, Kohlenrauch und Wasserdampf, durch Nachtkühle gellende Lautsprecherdurchsagen, Soldaten mit Schäferhunden an den Waggons, drinnen überall beklommen-ängstliches Schweigen. Zuerst kommen die Zollbeamten und verlangen Einblick in einzelne Gepäckstücke, danach die Grenzpolizisten mit deutlich barscherem Auftritt. Einzelne Reisende müssen aussteigen und den Uniformierten die Gepäckinhalte auf Rampen präsentieren. Ob sie alle wieder einstiegen, ist unbekannt. Nach unendlicher Wartezeit endlich der erlösende Pfiff - die Dampflokomotive nimmt fast widerstrebend langsam ihren Weg in Richtung Westen wieder auf.
In der Morgendämmerung des 4. August verlassen wir den Zug am Bahnhof von Gelnhausen. Weil so früh noch keine Busse in Richtung Altenmittlau fahren, ist unser erstes Ziel Onkel Heinrich Meier, der Bruder meiner Großmutter mütterlicherseits, der mit seiner Frau einen kleinen Milchladen am Gelnhäuser Untermarkt leitet. Von den Besuchen der vorigen Jahre wissen wir Kinder, dass es dort nicht nur Milch gibt, sondern immer auch eine Tafel guter Schokolade.
Am späten Vormittag erreichen wir per Bus unser Ziel Altenmittlau. Die Freude ist allseits groß. In ihrer kleinen Dachgeschosswohnung in der Hauptstraße (eine Wohnküche, ein Schlafzimmer und eine Frisierstube, in der mein Opa seinem Handwerk nachgeht) hatten Oma Anna und Opa Hermann Dittrich nach ihrer Vertreibung aus dem Sudetenland ihre neue Unterkunft gefunden. Plumpsklo im Erdgeschoss. Bei prallem Augustsonnenschein und heruntergelassenen Rollläden werden zumindest wir übermüdeten Kinder ins großelterliche Ehebett gelegt. Als wir gegen Abend erwachen, erfahren wir aus dem Radio, dass unser Interzonenzug der letzte Zug aus der DDR gewesen sei. Knapp zehn Tage danach wird der Bau der Berliner Mauer begonnen. Ungläubiges Staunen und die Frage, welcher Macht wir den ungeplanten, aber gerade noch rechtzeitigen Zustieg in den letzten Zug zu verdanken haben. Die Antwort sollten wir erhalten, wenn auch nicht sofort, sondern erst einige Jahre danach.
Bahnhof Mittweida
Ein kleiner Schritt in den Waggon
ein Sprung ins neue Leben
3 Johannes Curth, Der Tod geht durch die Taiga, Verlag Bernhard & Graefe, Berlin 1953
4 Kurt Klein, Stacheldraht, Hunger, Heimweh, Richard Bärenfeld Verlag, Düsseldorf 1955
5 IMM, Labor omnia vincit, Mini Hörbuch, prounic GmbH Mittweida, 2016