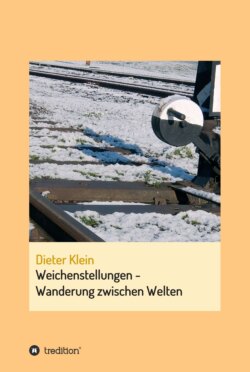Читать книгу Weichenstellung - Wanderung zwischen Welten - Dieter Klein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3. Kapitel 1961 – 1968 Neue Heimat
Für uns Kinder hatte weder der Abbruch der Verkehrsverbindungen noch der Beginn des Mauerbaus ein paar Tage später direkte Folgen. Schließlich hatten wir Sommerferien und genossen diese – wie zuvor schon mehrfach – bei den Großeltern in Altenmittlau. Anders als sonst allerdings war die Art der Unterkunft. Hatten wir zuvor stets für die Dauer des Urlaubs ein oder zwei Zimmer bei Landwirten des Ortes gehabt, so zogen wir diesmal in die ganze erste Etage eines normalen Wohnhauses in der Hauptstraße 98 ein. Da gab es außer einer mit fließendem Wasser ausgestatteten Küche und einem Wohnzimmer zwei getrennte Schlafzimmer für Eltern und Kinder und damit schon mehr Platz als in der alten Mittweidaer Wohnung. Im Erdgeschoss wohnte die Hausbesitzerin Ida K., eine aus Schlesien stammende, nach Altenmittlau verheiratet gewesene ältere Witwe, die uns sehr freundlich aufnahm. Sie stellte uns ihr Badezimmer zur Verfügung. Warmes Wasser für die Badewanne gab es da zwar nur nach Anfeuern eines Boilers, doch waren wir über so viel ungewohnten Luxus hell erfreut und genossen ihn. Nur die Toilette empfanden wir als nicht zeitgemäß: Sie befand sich, wie bei vielen Anwesen in Altenmittlau, am Ende eines langen Ganges zwischen Garten und Holzschuppen als unbeheiztes Herzhäuschen im Freien. Was, wie schon in Mittweida, den Nachttopf unter dem Bett notwendig machte und Durchhaltevermögen in frostigem Winter. Vom sehr großen Garten, in dem Ida K. Kartoffeln, Gurken, Salat und vieles mehr anbaute, durften wir einen Teil selbst nutzen. Seitens der Eltern folgte reges Anlegen von Beeten. Doch hatten sie noch mehr zu tun. Schließlich mussten wir als neue Bürger registriert, in die Maschinerie bundesdeutscher Bürokratie eingespeist werden. Normalerweise hätten wir dafür alle zusammen zunächst ins Aufnahmelager Friedland fahren und dort wohnen müssen. Doch dank der von den Großeltern arrangierten Wohnmöglichkeit in Altenmittlau blieb uns dieser Weg erspart. Es war nicht nur ein neuer Wohnsitz im westlichen Teil Deutschlands, ein Wechsel von einem System ins andere, sondern auch ein beruflicher Neustart für die Eltern. Unser Vater war im Osten Schneidergeselle und hätte diesen Beruf auch gern weiter ausgeübt. Doch überzeugte ihn der in Altenmittlau ansässige Schneidermeister Josef Z., dass angesichts wachsender industrieller Kleiderproduktion der individuell werkelnde Schneider zu einer aussterbenden Spezies gehörte. Die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt (Degussa) in Wolfgang bei Hanau dagegen suchte dringend Arbeitskräfte. Und so erhielt unser Vater dort recht schnell eine Stelle als ungelernter Chemiearbeiter. Auch unsere Mutter fand den Weg zur Degussa. Weil sie als (sehr gute) Absolventin einer höheren Handelsschule im Sudetenland und nach jahrelanger Praxis als Büroleiterin und Prokuristin in der Mittweidaer Küchenmöbelfabrik Oehme, danach in den Mittweidaer Elektrobetrieben Kriens und Haubold Leitungsfunktionen innehatte, erhielt sie eine relativ gut dotierte Stelle in der Verkaufsabteilung, in späteren Jahren sogar Prokura.
erstes Zuhause im Westen
Mit großelterlichen Zuschüssen, staatlicher Ausstattungshilfe und dem ersten selbstverdienten Westgeld kauften die Eltern unsere erste Kücheneinrichtung. Sie hatte glänzende Resopalfronten, Besteckfächer und als Krönung einen Elektroherd mit eingebautem Backofen. Ein Neonkranz an der Küchendecke setzte alles unübersehbar in grelles Licht. Wir Kinder freilich bekamen zwar die elterlichen Aktivitäten mit, „durften“ auch kräftig im Garten helfen, doch hatten wir ja noch immer Ferien. Der Ernst des Lebens näherte sich uns erst mit der Fortsetzung der Schule. Was für uns Neubeginn war, war für die einheimischen Schüler*innen Fortsetzung, denn das Westschuljahr hatte bereits nach Ostern begonnen. Das heißt, ich wurde während des Schuljahres in eine bereits bestehende Klasse gesteckt. Eigentlich eine unerfreuliche Konstellation - dunkle, alte Klamotten, fremder, schwer verständlicher Dialekt, neue Mitschülerinnen und Mitschüler, unbekannte Lehrer, andere Unterrichtsinhalte, Dominanz der Kirche. Besonders letzteres verwunderte mich stark. Hatten wir Christen im sozialistischen Schulwesen unser Christsein möglichst verschwiegen, so war hier das genaue Gegenteil gefordert: Sonntags pflegten meine Mitschüler mindestens zweimal in die Kirche zu laufen, was während der Woche an einem Schultag mit gemeinsamem Kirchgang aller Schüler ergänzt wurde. In Mittweida ein großväterlich-gutmütiger Seelsorger, der mit seiner Kirche Geborgenheit vermittelte, in Hessen dagegen ein resoluter und athletischer Pfarrer, der im Religionsunterricht schon mal ungehobeltes Benehmen mit spontaner Prügel belohnte. Der laut heulend nach Hause rennende Schulkamerad kam kurz darauf unter noch stärkerem Wehklagen zurück. Die Eltern hatten ihm kurzerhand ein zweites Mal die hierarchischen Regeln eingebläut. Kirche als vom DDR-Staat verspottetes Refugium, Fundort verpönter Literatur, Gefühlszuhause verlor für mich hier rasch an Bedeutung, weil ihr Besuch jetzt nicht mehr Überwindung und Selbstverleugnung bedeutete, sondern unreflektierte Pflicht und Gewohnheit.
Besser fand ich mich in den Unterrichtsfächern zurecht und wurde von den Lehrer*innen sehr oft drangenommen. Nachmittags waren die Hausaufgaben immer schnell abgehakt, anschließend ging es zum Bolzen auf den Wingertsberg, wo sich in entrückter Höhe Altenmittlaus Fußballplatz befand. Eigentlich ein denkbar blöder Platz, denn wenn man den Ball zu stark in die falsche Richtung schoss, rollte er den ganzen Berg bis fast ins Dorf hinunter. Da das auch den Spielbetrieb des Fußballvereins ärgerlich beeinträchtigte, außerdem alle Zuschauer mühsam auf Trampelpfaden den Berg hinauf kraxeln mussten, war bereits ein neuer Platz angedacht und in Planung. Dort sollte ich bald als Vereinsmitglied noch stärker ins Dorfgeschehen integriert werden. Integration, Sport, einfache Schulanforderungen und das in seiner Bedeutung geschmälerte Kirchenleben - es schien also alles seinen - nun nicht mehr sozialistischen - Gang zu gehen!
Doch gab es irdische Strippenzieher, die das ganz anders sahen.
Aus Bonn reiste zur Klärung meines weiteren Ausbildungsweges Vatis Bruder, mein Onkel Kurt, an, der als Studienrat und Bundestagsabgeordneter hohes Ansehen genoss. In meiner Erinnerung wollten meine Mutter und Opa Hermann, dass ich in Gelnhausen die Handelsschule besuchen sollte, wogegen sich mein Onkel dafür stark machte, mich an verschiedenen weiterführenden Schulen vorzustellen. Und so besuchten wir gemeinsam die Leiter der in Frage kommenden Schulen der Umgebung. Das Bischöfliche Progymnasium in Somborn lag zwar am nächsten und wäre von mir bequem zu erreichen gewesen, doch endete die Schullaufbahn dort mit der 10. Klasse. Danach wechselten alle Abiturwilligen an die Fortsetzungsschule in Fulda, wo wegen der großen Entfernung keine tägliche Heimfahrt möglich und deshalb ein Internatsplatz zu bezahlen wäre. Außerdem hatten die Lateinschüler, wie der Name schon verrät, bereits einige Jahre Lateinunterricht hinter sich, wogegen ich erst damit beginnen müsste. Die nächste Vorstellung fand in Gelnhausen statt, wo sich mein Onkel und der damalige Direktor R. prächtig verstanden. Er leitete das neusprachliche Grimmelshausen-Gymnasium, in dem ich zusätzlich zum halbjährigen Rückstand in Latein auch zweieinhalb Jahre Englischunterricht aufholen müsste. Den hatten wir zwar formal auch in der DDR gehabt, doch war der das Fach Englisch unterrichtende Schulleiter so selten anwesend gewesen, dass es gerade mal zum englischsprachigen Buchstabieren des Alphabets reichte - ungleich wichtiger war damals Russisch gewesen. Am Ulrich-von-Hutten-Gymnasium von Schlüchtern ergab sich nach einem langen Gespräch, dass die Bedingungen denen von Gelnhausen glichen, der Weg zwischen Wohn- und Schulort aber ungleich länger war. Damit fiel die Wahl auf Gelnhausen. Während ich nach diesen Vorstellungstagen abends müde ins Bett fiel, betätigte sich mein lieber Onkel abends auf einem ganz anderen Feld - was mir in seiner Konsequenz für mein Schülerdasein erst sieben Jahre später, nach der Abiturprüfung im Jahre 1968, bekannt werden sollte.
In die letzten Tage vor den alltäglichen Schulpflichten fiel die Ankunft eines denkwürdigen Briefes. Onkel Hubert hatte ihn an die Eltern geschrieben. Mir erschloss sich der Sinn nicht, dafür umso deutlicher den Eltern. Hubert Klein schrieb in einem zuvor vereinbarten Sprachcode, dass unsere Mittweidaer Wohnung bereits zwei Wochen nach Ablauf unseres Besuchsvisums für den Westen aufgelöst worden sei und eine andere Familie darin wohne. Das war der Auslöser für die Eltern, sich beim Altenmittlauer Arzt eine Bescheinigung darüber zu besorgen, dass sie die kranke Mutter hätten pflegen müssen. Mit dieser Bescheinigung wiederum fragten die Eltern bei der zuständigen staatlichen Behörde des Kreises Hainichen an, ob man nach der gesundheitlich erzwungenen Überschreitung der Visumszeit nun wieder zurückkehren könne. Die Antwort erfolgte prompt: Natürlich würden wir ein erneutes Visum für die Rückreise ausgestellt bekommen und man habe nach mehr als zehnjähriger Wartezeit für uns endlich eine neue Wohnung gefunden, in die wir nach Rückkehr sofort einziehen könnten. Die schriftliche Anfrage der Eltern, wo denn die so plötzlich gewährte neue und seit Anfang der 50er Jahre vergeblich geforderte Wohnung liege, offenbarte eine Überraschung. Zu viert sollten wir in eine kleinere Dachwohnung in einem der hohen Bürgerhäuser direkt am Marktplatz einziehen, über der damals dort befindlichen zentralen Bushaltestelle, wo Tag und Nacht die Motoren der Ikarus- Busse dröhnend für schlechte Luft sorgten. Nachdem die Eltern antworteten, dass dies eine Verschlechterung unserer Wohnsituation bedeute, wir deshalb lieber wieder in unsere alte Wohnung einziehen würden, wo wir wenigstens unser Mobiliar behalten könnten, was in der angebotenen Wohnung wegen schräger Wände nicht möglich sei, kam keine Antwort mehr, auch nicht das in Aussicht gestellte Visum für die Rückreise. Ein sehr klug eingefädelter Plan, der es meinem von Heimweh geplagten Vater erlaubte, bereits nach zwei Jahren der sächsischen Heimat einen Besuch abzustatten, ohne wegen Republikflucht eingesperrt zu werden.
Das kleine Dorf am Spessartrand
Mit dem Wechsel von der Volksschule Altenmittlau zum Grimmelshausen-Gymnasium zerfiel mein Alltag grob in zwei Teile. Vormittags Busfahrt nach Gelnhausen, bis gegen 13.00 Uhr Unterricht, im Anschluss daran Nachhilfeunterricht in Englisch und Latein und Heimfahrt mit dem Bus. Nachmittags bis abends Hausaufgaben, Arbeit im Garten und weiterhin Treffen mit den Schulfreunden aus Altenmittlau zum Fußballspielen, zum Mithelfen bei der Feldarbeit oder Herumstromern in der neuen Umgebung, die jetzt meine Heimat werden sollte. Die Hauptstraße ein ungepflastertes Band aus Staub, Dreck und ganz vielen Löchern, die bei Regenwetter wegen sich bildender Seenlandschaft die Sprungkraft der Passanten trainierte. An jedem Haus eine Zinkrinne, aus der das Spülwasser aus den Küchen, freitags auch das Badewasser direkt auf die Straße rauschte und bald für schmutzige, stinkende Ränder sorgte. Ein paar Jahre danach erst begann man mit der Verlegung eines unterirdischen Kanals. Beeindruckend die Klugheit der Kühe, die allabendlich mit prallen Eutern allein durch die Hauptstraße zielgerecht in den heimischen Stall schlenderten. Manches dieser sanftäugigen Wesen begleitete die Freundin bis in deren Stall, bevor es den Weg an die eigene Futterkrippe fortsetzte.
Mit zunehmender Zeit allerdings kam Sehnsucht auf - nach der Zschopau und dem unbeschwerten Herumtollen an deren Ufern und Hängen. Hier war weit und breit kein Fluss in Sicht. Lediglich Gelnhausen durchquerte mit der Kinzig ein Flüsschen, das für mich erst einen wahren Wert erhielt, als es in einem Frühjahr so stark über die Ufer trat, dass die Unterstadt überschwemmt und die Schule nicht mehr erreichbar war. Auch meine früheren Freunde vermisste ich zunehmend. Konnten wir uns in Mittweida nach der Schule, spätestens nach den Hausaufgaben, zum unbeschwerten Spiel treffen, so lag die Sache jetzt anders. Nach dem Absolvieren der damals 8-klassigen Volksschule begannen meine neuen Altenmittlauer Freunde allesamt ihre Lehrzeiten und waren deshalb nachmittags nicht erreichbar.
Und weil ich für einige Jahre der einzige Jugendliche des Dorfes war, der das Gymnasium in Gelnhausen besuchte, wohnte mit Reinhard H. der mir am nächsten wohnende Schulkamerad im etwa 5 km entfernten Niedermittlau. Er war Mathematikexperte, sehr sportlich und spielte besonders gut Fußball. Wenn wir nach der Schule unseren Bus nach Hause verpasst hatten, gingen wir nicht selten zu Fuß die etwa 8 km von Gelnhausen nach Niedermittlau bis zu seinem Zuhause, wo ich von seinen herzensguten Eltern - der Vater auch ein Vertriebener aus dem Sudetenland - zum Mittagessen eingeladen wurde, wir danach gemeinsam die Hausaufgaben erledigten, bevor ich den weiteren Fußmarsch nach Hause aufnahm. Später bewältigte ich die gesamte Strecke nach Gelnhausen und zurück im Sommer sehr oft mit dem Fahrrad. Mir war diese Freundschaft sehr wichtig, weil mein Rückstand auch in Mathematik damit ein wenig kleiner wurde. Doch waren spontane Verabredungen, wie sie heute per Handy ein Klacks sind, damals nicht möglich, weil es keine Handys gab. Und selbst Telefon besaßen die Wenigsten. Unsere Familie sollte erst 1972 eins erhalten. Da ich das Fahrrad erwähne: Am ersten Weihnachtsfest im Westen, am 24. 12. 1961, stand es unter dem Weihnachtsbaum. Ein glänzend blaues Sportrad der Marke Ikarus mit einer Drei-Gang- Kettenschaltung – mein ganzer Stolz! Ein bald darauf montierter Kilometerzähler bewies nach wenigen Jahren, dass ich damit einige Tausend Kilometer bewältigt hatte.
Die Altenmittlauer Kurzzeit-Schulkameraden waren fast nur noch an den Wochenenden erreichbar. Das stellte mich vor moralische Verlockungen: Sie verdienten bereits ihr erstes Geld, was ganz andere Wochenendgestaltungen ermöglichte als bei mir, der dank schmal bemessenen Taschengeldes kaum mithalten konnte. Manches Mal dachte ich damals, es wäre vielleicht besser, auch eine Lehre zu beginnen, als sich täglich in der Schule mit viel Frust in Englisch, Latein und Mathematik abzumühen. Dann hätte ich Wochenendtrips nach Paris mitmachen oder in den Kneipen mich ganz anders zeigen, vielleicht mir ein Moped leisten können. Dazu kam, dass im Alter von etwa 16 oder 17 Jahren das Interesse an der zuvor hinter einer Nebelwand verborgenen Mädchenwelt erwachte. Meine Freunde fanden dank besser gefüllter Geldbörsen auch hier recht frühen Zugang. Dennoch bleiben die ersten Tanzerfahrungen, die ich in dem einzigen Tanzlokal im Dorf machte, in unauslöschlicher Erinnerung. Ebenso die heute kaum noch nachvollziehbar langen Wanderungen zu anderen Lokalen in naher und weiter Entfernung, wobei wir uns in jedem stärken mussten – meist mit Bier, was abends nicht selten zu gewissen Bewusstseinseintrübungen führte. Hier klappte die Integration jedenfalls absolut und störungsfrei.
Zwei Aktivitäten ragen in der Altenmittlauer Anfangsphase besonders heraus: Ich schloss mich dem Fußballverein an, war bald regelmäßiges Mitglied der Jugendmannschaft und etwas später der Reservemannschaft, die immerhin in der A-Klasse spielte. Zur zweiten Aktivität überredete mich ein anderer Jugendlicher während der täglichen Busfahrt nach Gelnhausen. Ich sollte doch einmal mit zur Kolpingfamilie kommen, die eine gute Jugendabteilung hätte. Das tat ich dann auch und war erstaunt. Obwohl es sich um eine katholische Gemeinschaft handelte, fanden hier Rollenspiele und Diskussionsrunden zu aktuellen politischen Themen statt, rechtfertigten Parteienvertreter aus der Gemeinde ihre Positionen, spielten wir gemeinsam Fußball und zelteten im Sommer bei Besuchen befreundeter Kolpingfamilien. Das war vielfältiger als nur Fußball zu spielen oder ein Musikinstrument zu erlernen, was ich auch eine Zeitlang erwogen hatte. Ich trat in diesen im 19. Jahrhundert in Köln für arme und von Verwahrlosung bedrohte Wandergesellen gegründeten Verein mit klarem Bildungsauftrag ein und bin heute seit mehr als 50 Jahren treues Mitglied. Durch einen unserer Nachbarn in der Kettelerstraße erhielt ich die einzigartige Gelegenheit, mir selbst etwas zum knappen Taschengeld hinzuzuverdienen. An vier der sechs Wochen dauernden Sommerferien stieg ich all- morgendlich vor 6 Uhr in einen Arbeiterbus nach Frankfurt, wo ich mich um 7.00 Uhr in der Versandabteilung der Firma Neckermann einfand. Mit mir waren dort zahlreiche Studentinnen und Studenten damit beschäftigt, die Bestellscheine der Kunden abzuarbeiten. In den langen und hohen Lagerreihen war der Artikel zunächst zu suchen und dann auf ein Fließband zu legen. Weil es niemand so richtig ernst nahm und zumeist eine fröhliche Stimmung unter uns jungen Leuten herrschte, besonders wenn jemand eine Gitarre im Produktelager entdeckt hatte und diese auch spielen konnte, klirrte es recht häufig bei der Landung von z.B. Porzellangeschirr auf dem Band. Dass es das Neckermann-Versandhaus heute nicht mehr gibt, erstaunt mich nicht.
sonntägliche Wanderung nach Waldrode
Für die Ferienjobs in den folgenden Jahren schloss ich mich meinen Altenmittlauer Schulkameraden Peter L. und Hubert T. an und fuhr mit ihnen nach Offenbach, Mühlheim am Main, noch später nach Frankfurt, um als Postbote Briefe auszutragen. Es war ein Ferienjob, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Nach der frühmorgendlichen Sortierarbeit war man mit dem Rad an frischer Luft in den Städten unterwegs. Am Schluss der Tour war die alltägliche sorgfältige Abrechnung zu erledigen. Weil damals Renten und andere Geldbeträge noch vom Briefträger ausgezahlt wurden, gab es an den Zahl- tagen zumeist reichlich Trinkgeld, was die ohnehin als großzügig empfundene Bezahlung erfreulich aufbesserte. Zusätzlich reizvoll war der Job wegen der frühen Rückkehr nach Hause, die es an fast allen Tagen erlaubte, den ganzen Nachmittag im Schwimmbad zu verbringen. Und dann konnte man sich mit dem verdienten Geld Dinge leisten, an die man sonst nicht herangekommen wäre: die erste Errungenschaft war ein tragbares Spulen-Tonbandgerät der Marke Grundig, später sollten eine Folgeversion davon mit integriertem Radio und eine Stereoanlage folgen.
Unmerklich wuchs ich auf diese Weise in die Dorfgemeinschaft hinein. Hatte in Mittweida das alljährliche Schwanenteich-Anlagenfest, gelegentlich ein auf dem Festplatz gastierender Zirkus (im Wechsel „Barlay“, "Busch" oder „Probst“), der vorweihnachtliche Markt auf dem Tzschirnerplatz und der damals nur noch kurz bestehende Karnevalsumzug das Kinderherz beflügelt, weniger die regelmäßigen angeordneten Kundgebungen und Umzüge von Arbeiter-Kampfgruppen, Pionieren und FDJ, so war das Dorfleben bunter: Mit den damals üblichen und im Vergleich zu heute bescheidenen Attraktionen (Schiffschaukel, Riesenrad, Berg-und-Tal-Bahn, Schießbude, Karussel), mit Zelt, Musik, Tanz und viel Bier feierte man im Sommer ständig irgendwas. Da war das alljährliche Kirchweihfest, die Kerb, die eine Woche später einen vollends ruinierende Nachkerb, und immer irgendwelche Jubiläen von Musik-, Sport- oder Gesangsverein, deren Wettstreitveranstaltungen, Karnevalssitzungen usw. Also ein Rundum-Bespaßungsprogramm, das von der Bevölkerung gestaltet wurde. Zusammenhalt war so direkt erlebbar. Freilich gab es dabei auch gelegentlich Irritierendes, was aber irgendwie dazu gehörte, wie z.B. die zu später Stunde fast regelmäßig wegen Nichtigkeiten sich entzündenden Raufereien zwischen einzelnen Kampfhähnen. Polizei wurde dabei nie herbeigerufen.
Trotz immer noch bestehenden Heimwehs - nach den Menschen? der Umgebung? den Häusern von Mittweida? - fühlte ich mich immer wohler und war vom Eingeborenen bald nur noch durch den Dialekt zu unterscheiden. Dazu trug auch bei, dass sich eine kleine Gruppe von Freunden mit gleichen Interessen bildete. Im Zentrum der Gruppe stand Peter S.. Als technikbegabter Sohn der Eigentümerin einer NSU-Werkstatt hatte er ein eigenes, natürlich frisiertes Moped. An so manchem Samstagabend ging es damit helmlos in rasender Fahrt in Hanauer Kinos, wo Western zu unseren bevorzugten Filmen gehörten. Bald waren wir mit Peter L. und Jürgen K. eine Viererbande, die viel gemeinsam unternahm. Als Peter S. mit 18 Jahren sein erstes Auto bekam, einen NSU Prinz 3, erweiterte sich unser Aktionsradius beträchtlich. Karneval konnte nun schon mal die ganze Nacht hindurch in Seligenstadt gefeiert werden, andere Feste nahe der damaligen Zonengrenze im verlockenden und lohnenden Friedewald, wo es wenige Männer, dafür umso mehr Mädchen gab, und auch eine Fahrt ins ferne Bühlerzell bei Schwäbisch Hall fehlten nicht, wo wir in der Scheune des aus dem Sudetenland stammenden Bruders meiner Oma schliefen. Und es ergaben sich weitere regelmäßige Aktivitäten, die im beschaulichen Altenmittlau nicht möglich waren, wie das allwöchentliche Training im Judoclub von Hanau oder Campingwochenenden am Kahler See. Auf weitere, meist abendliche Aktivitäten, wird später einzugehen sein.
Rhönrocker 1967 in Friedewald
Zwischen Grimmelshausen und Himmelsgrausen
Dass es kein Zuckerlecken werden würde, war mir schnell klar. Da saß ich nun mit meinen 13 ½ Jahren in einer Schulbank neben einem Jungen, der mir ebenso unbekannt war wie alle anderen Schülerinnen und Schüler, die mich Exoten mehr oder minder interessiert musterten. Er hatte ein „von“ im Namen, war also ein Adliger, was mir gehörigen Respekt, um nicht zu sagen Schrecken einjagte. Denn im Geschichtsunterricht der DDR hatte ich gelernt, dass der Adel die schlimmste Ausgeburt der deutschen Geschichte gewesen sei, massenhaft Menschen niedergemetzelt hatte, blutrünstig und grausam. Ich blieb also, jederzeit seinen Angriff erwartend, in enger Schulbank gehörig auf Distanz. Was aber mögen die anderen Schüler gedacht haben? Ich war aus der Kleiderkammer des Roten Kreuzes mit guten, aber keineswegs aktuellen Klamotten ausstaffiert, Grau und Schwarz dominierten. Die Kleidung der Anderen dagegen farbenfroh und modisch. An den ersten Tagen fragte mich niemand nach Namen oder anderem. Und ich selbst hatte Hemmungen, einen der neuen Klassenkameraden anzusprechen. Über den Unterricht hätte ich jetzt ein Zeichen setzen sollen. Das aber verlief ganz anders als erhofft: In einer der ersten Stunden hatten wir das Fach Geschichte bei Herrn Dr. H. Weil mich Geschichte schon immer sehr interessierte und ich in der DDR darin auch gute Noten erhalten hatte, sah ich dem Unterricht mit besonderer Vorfreude entgegen. Es ging um das antike Griechenland, für mich genauso fremd wie Latein, in dem uns derselbe Lehrer unterrichtete. Er, der in der Schülerschaft besser unter dem Namen „Harry“ bekannt war, baute sich in der ersten Stunde vor mir auf und sagte mit strengem Blick, dass er Menschen, die in der Not ihr Vaterland verließen, zutiefst verachte. Erst später wurde mir klar, dass dies gar nicht auf die Griechen, sondern auf mich bezogen war. Die Mitschüler hatten das schneller bemerkt und fragten mich, ob ich mit Harry Ärger gehabt hätte. Diesen konnte ich freilich gar nicht gehabt haben, doch sollte er noch kommen. Meine Einstellung zu jenem „Pädagogen" ist sehr negativ. Er hatte klar definierte Lieblinge, besonders waren das die hübschen Mädchen, auf der anderen Seite die unter ihm leidende Gemeinschaft aller Anderen. Als aus Ostpreußen stammender Soldat, der sich viel darauf einbildete, nie in alliierte Gefangenschaft geraten zu sein, erzählte er uns stolz von den „Kriegshelden" des Dritten Reiches. Direkt nach Kriegsende in Hessen gelandet, hatte er mit einer verwitweten Jungbäuerin eine neue Familie begründet. Geradezu enthusiastisch pflegte er uns seine Kriegserinnerungen mitzuteilen. Mit offenen Mündern und Gruseln hörten wir von „Kommunistenweibern“, die er bei einer ihrer Demonstrationen bekämpft hatte, bis deren Hirn in den Rinnstein gespritzt sei. Sein Lateinunterricht verlief nach immer gleichem Schema: Vokabelabfrage, Hausaufgabenvergleich, neuer Text bzw. Grammatik, neue Hausaufgabe. Die einleitende Vokabelabfrage war allgemein gefürchtet, weil die ungeliebten Schüler stets so lange befragt wurden, bis sie 10 Vokabeln nicht konnten, was die mangelhafte Note 5 bedeutete. Bei den Lieblingen endete die Befragung früher, so dass es da fast ausschließlich gute Noten gab. Die von ihm bevorzugten Mädchen wussten seine Schwäche zu nutzen, indem sie bei Klassenarbeiten ihre Spickzettel in den Oberschenkelsaum ihrer durchsichtigen Strümpfe schoben und ihre Röcke nach Bedarf hochzogen. Harry schätzte das offensichtlich, während er bei uns anderen, die nicht mit derartigen Reizen wuchern konnten, erbarmungslos strafte (Klassenarbeit beendet und Note 6). Sein Verhalten, zu dem auch schreckliche Verwünschungen gehörten, empörte mich zunehmend und trug nicht wenig zu meinem Entschluss bei, den Lehrerberuf anzustreben. Zuhause legte ich ein noch heute vorhandenes Tagebuch an, in dem ich auf einer Seite sein Verhalten exakt festhielt, auf der Gegenseite aufschrieb, wie ein Lehrer sich idealerweise verhalten sollte. Durch diese regelmäßige Dokumentation fand ich heraus, dass er bei den Vokabelabfragen ein bestimmtes Prüfungsschema befolgte - ein Glücksfall. Denn seitdem konnte man mit großer Sicherheit feststellen, wann man selbst drankommen würde, und sich entsprechend gut vorbereiten. Gewiss war er darüber enttäuscht, mir in den ersten beiden Jahren in Latein keine Noten geben zu dürfen. Seine Versuche in den Folgejahren scheiterten, weil ich bei den Vokabelabfragen gut vorbereitet war und auch sonst keine zu schlechten Leistungen zeigte.
Kurios war ein anderes Lehrererlebnis der ersten Tage. Der junge Deutschassessor Fritz P. erschien und ließ die Klasse gleich in meiner ersten Deutschstunde ein Diktat schreiben. So wie ich ihn für einen seit längerem die Klasse unterrichtenden Lehrer hielt, so hielt er mich für einen seit langem in der Klasse befindlichen Schüler. Beide hatten wir die erste Deutschstunde gemeinsam, ohne dies zu ahnen - und dann gleich das Diktat, mit dem er die Leistungsfähigkeit der Klasse testen wollte. Mir kam das sehr entgegen, denn in den ostdeutschen Diktaten hatte ich immer sehr gut abgeschnitten. Das Wort „Stewardess“ in der Überschrift und weitere Worte im Text waren mir indes völlig unbekannt, weshalb ich sie nicht zu schreiben wusste. Und so ließ ich Lücken, um diese beim erwarteten zweiten langsamen Vorlesen zu füllen. Das zweite Vorlesen aber geschah zu meinem Schrecken in normalem Sprechtempo, was bei mir einen Lückentext zur Folge hatte.
Ich erhielt als meine erste Deutschnote eine 6 (ungenügend). So sehr ich mich in diesem ersten Schuljahr und in den folgenden bei Fritz P. bemühte, bei Nacherzählungen, Erlebniserzählungen, Schilderungen, Inhaltsangaben, bis an die Grenze der Besinnungslosigkeit Besinnungsaufsätzen - nie waren meine schriftlichen Noten besser als 4 (ausreichend). In der 10. Klasse (Untersekunda) hatte ich das keineswegs als Vergnügen empfundene Schicksal der Wiederholung des Schuljahres zu ertragen. Zu meinen neuen Lehrern gehörte der auf relativ hohem geistigen Niveau fordernde Studienrat Lothar Sch.. Bei ihm erntete ich fast nur sehr gute (1) und gute (2) Deutschnoten. Fritz P. war mir zu dieser Zeit als Sportlehrer erhalten geblieben, und es war mir ein dringendes Bedürfnis, ihm von meinen neuerlichen Notenerfolgen in Deutsch zu erzählen. Den Wunsch, eine meiner Arbeiten sehen zu dürfen, erfüllte ich deshalb sehr gern. Als er sie mir zurückgab, entschuldigte er sich bei mir, er habe mich wohl zuvor nicht richtig eingeschätzt, wozu das erste Diktat beigetragen habe. Gewiss war es eine Kompensationshandlung, dass er mir in Sport nun fast nur noch sehr gute Noten verlieh.
Obwohl es am Grimmelshausen-Gymnasium weitere unangenehme Zeitgenossen gegeben hat, soll nur noch einer näher betrachtet werden, bevor einige angenehmere Pädagogen die Schulehre retten sollen. Unser junger Klassen- und Chemielehrer Hubert D. aus Bad Orb setzte meine Eltern am Elternsprechtag davon in Kenntnis, dass er mich wegen fortgesetzter Aufwiegelung der Klasse von der Schule weisen lassen würde. Erst nach zusammen mit den entsetzten Eltern erfolgten Nachfragen bei Klassenkameraden konnte das Geheimnis der angeblichen Rädelsführerschaft gegen den Klassenlehrer gelüftet werden. Damals sprach ich ein ausgeprägtes Sächsisch, was Teile der Klasse stets zu Gelächter animierte, mich aber wenig störte. Deren Hessisch hatte ich schließlich auch zu ertragen. Mehr störte es unseren zart besaiteten Lehrer, der sehr wohl bemerkt hatte, dass jedes Mal, wenn ich dran war, Lächerlichkeit den Raum durchzog. Er glaubte, das Gelächter gelte ihm, empfand sich direkt angegriffen und mich als Urheber der Unruhe.
Gerade in der ersten Zeit, in der ich als Nobody mit riesigem Nachholbedarf das Gymnasium als Last empfand, war ich für jedes freundliche Wort, jede Erkundigung nach dem Wohlbefinden sehr dankbar. Da war die Englischlehrerin, die mir während der ersten beiden Jahre zwar keine Noten geben konnte, aber sich dennoch um mich kümmerte. Außerhalb des Unterrichts fragte sie mich nach meinen Schulerlebnissen in der DDR, nach dem Leben dort, vermittelte Oberstufenschüler, die mir fortan zu günstigen Stundensätzen in Englisch Nachhilfe erteilten.
Der von den meisten Schülern als streng, aber fair respektierte Oberstudienrat Helmut Z. erkundigte sich sehr oft nach meiner Vergangenheit und unserem Familienneustart in Altenmittlau, wo er Verwandte hatte. Von ihm waren nicht nur seine Einsätze im Zweiten Weltkrieg zu erfahren, Geschichten, die - im Gegensatz zu Dr. H.'s Gruseleien - alles andere als verherrlichend ausfielen, und er brachte uns die Spielregeln der Demokratie ebenso gründlich bei wie die der Marktwirtschaft.
Ein weiterer besonderer Lehrer war unser Biologielehrer Helmut P., der sich im Streit um meine (Nicht-)Versetzung von der Untersekunda in die Obersekunda (von Klasse 10 zu 11) persönlich für mich einsetzte und ebenfalls wohltuendes Interesse an meinem menschlichen und schulischen Fortschritt zeigte.
Herr Dr. B. ist ebenfalls herauszuheben, weil er nicht nur Interesse an meiner sozialistischen Vergangenheit bekundete, sondern in österreichischem Akzent enorm sympathisch-mitreißend in Gemeinschaftskunde mit Hilfe wissenschaftlicher Werke Hintergründe historischer Entwicklungen aufdeckte. Sein Unterricht ging weit über das vorgeschriebene Lehrbuchwissen hinaus, seine philosophischen Betrachtungen begründeten Werthaltungen bei uns Schülern. Da ich seit DDR-Zeiten gut mit der Schreibmaschine umzugehen wusste, durfte ich bei ihm zu Hause auf seiner Maschine öfters Matritzen für den Unterricht tippen, wobei ich auch seine warmherzige Frau kennenlernte.
Als Lichtgestalten der Lehrerschaft Gelnhausens soll als letzter mein späterer Klassenlehrer S. erwähnt werden, der uns Schüler*innen um- und nachsichtig zum Abitur führte.
Die Erinnerungen an die Lehrerschaft fallen wegen der oben für Deutsch und Latein dargestellten schul- und fachfremd begründeten Beurteilungen, zu denen eine weitere in Mathematik kommen sollte, recht gemischt aus. Erst im Wiederholungsjahr 1964, als ich wegen des sehr schwachen Notenbildes mit Fünfen in Englisch und Mathematik, Vieren in Latein und Deutsch das Klassenziel nicht erreicht hatte und die Klasse wiederholen musste, stellte sich nach meiner DDR-Zeit ein inneres Gleichgewicht wieder her: Mit neuen Lehrern erreichte ich in Latein auf Anhieb die Note „Gut“, in Mathematik „Befriedigend“ und „Gut“, in Deutsch „Gut“ und „Sehr Gut“. Dadurch wandelte sich mein zuvor arg zerfleddertes Selbstvertrauen zum festen Willen, mich niemals mehr - von wem auch immer - in solch deprimierende Situationen bringen zu lassen. Glück hatte ich, dass das Wiederholungsjahr in die Zeit der beiden Kurzschuljahre fiel, die das Land Hessen bei der Umstellung des Schulanfangs von Ostern auf September einführte; so hatte ich nur ein halbes Jahr verloren. (In Bayern und Württemberg wäre der zeitliche Verlust mit deren Langschuljahren deutlich größer ausgefallen.)
Mit den Mitschülern hatte ich keine Probleme und sie keine mit mir. Wie auch, wenn ich als meist schweigsamer Zeitgenosse direkt nach dem Unterricht zum Bahnhof enteilte, um den Bus nach Altenmittlau zu erreichen. Lediglich zu Reinhard H. in Niedermittlau, Reinhard F. und Michael Sp. aus Gelnhausen, später zu Helmut S. aus Wirtheim sollten sich Freundschaften einstellen. Bei allen vier Jungs war ich öfters zum Mittagessen eingeladen, zur gemeinsamen Erledigung der Hausaufgaben mit sich anschließender Freizeitgestaltung. Das war im Falle von Michael Sp. und Reinhard F. zumeist Eislaufen und Eishockeyspielen auf dem winterlichen Teich des städtischen Klinikums. Der schulische Kontakt zu den Beiden und zu Reinhard H., über den ich oben schon berichtet habe, fiel wegen meines Wiederholungsjahres seit dem Schuljahr 1964/65 weg, dafür entstand der zu Helmut S. neu. Da zwischen Altenmittlau und seinem Wohnort Wirtheim keine Busverbindung bestand, war die Strecke von ca. 20 km nur mit dem Fahrrad zu überwinden.
Die Zeit nach dem Sitzenbleiben wurde für mich die wahre Schulzeit. Denn weil ich nun in allen Fächern stets bemüht war, auf der Höhe des Unterrichts zu sein und damit gute Ergebnisse einfuhr, wuchsen Selbstsicherheit und die Anerkennung durch die neuen Mitschüler. Freilich mussten dafür Prioritäten verschoben werden. Fußball und andere Freizeitbeschäftigungen rangierten nun nachgeordnet hinter schulischen Aufgaben, die ich direkt nach dem Mittagessen zu erledigen begann. In meiner neuen Zeiteinteilung spielten Umfang und Schwierigkeiten der Aufgaben keine Rolle, denn erst, wenn alles zu meiner Zufriedenheit erledigt war, winkte freie Zeit. Notfalls fiel sie eben aus. Damit alles nicht gar so dröge über die Bühne ging, baute ich mir ein altes Wohnzimmerradio so um, dass ich bei der Pflicht über mehrere Lautsprecher meinen Lieblingssender AFN hören konnte - außerdem hoffte ich, damit meine Englischkenntnisse erweitern zu können. Ganz wesentlich für das Gelingen der neuen Schulphase waren Bau und Bezug des eigenen Hauses. Seit 1963 war die ganze Familie in sehr viel Eigenleistung damit beschäftigt, auf einem mit Hilfe der Großeltern erstandenen Grundstück ein Zweifamilienhaus zu errichten. Auch wir Kinder arbeiteten fleißig, aber nicht immer enthusiastisch mit - gewiss auch ein Grund für die gelegentliche Vernachlässigung schulischer Pflichten. Die schulische Leistungsstabilisierung bedurfte gelegentlicher Unterstützung. So z.B. bei Lateinübersetzungen, bei denen ich von dem in Altenmittlau wohnenden neuen Klassenkameraden Otto B. profitierte, oder in Mathematik, wo ich noch immer zuweilen zu Reinhard H. nach Niedermittlau radelte. Kurzum: Das Schulleben ging seinen gewünschten Gang.
ab 1964 stolze Hausbesitzer
In der Oberprima (13. Klasse) kam das Abitur in Reichweite. Mit der Fokussierung darauf geriet das mit Peter S. und weiteren Freunden betriebene regelmäßige Judotraining in Hanau immer mehr ins Hintertreffen. Die Abiturprüfungen fanden an einem heißen Junitag statt. Nach den schriftlichen Prüfungen hatte ich nur eine einzige mündliche Prüfung zu bestehen - ausgerechnet in Mathematik, wo ich zwar von anderen Mathelehrern gute Noten erhalten, von dem mich seit einem Jahr wieder unterrichtenden Heinz P. jedoch fast nur Fünfen geerntet hatte. Dass ich bei der mir gestellten Kettenaufgabe mit zehn Ergebnissen siebenmal richtig lag, zweimal knapp falsch und einmal nicht fertig geworden war, nährte die Zuversicht, alles sei noch akzeptabel verlaufen. In die üblicherweise nach den Prüfungen sich einstellende überschwängliche Freude mit durchfeierten Nächten mischte sich der fragende Kommentar eines Lehrers, der mich nie unterrichtet hatte, aber nun das Gespräch mit mir suchte. Ob ich mit meinem Mathelehrer Probleme gehabt hätte, wollte er wissen. Als ich verneinte, fragte er weiter, ob ich nicht einen Onkel habe, der 1961 bei meiner gymnasialen Einschulung abends auf einer Wahlveranstaltung in der Jahnhalle von Gelnhausen feierlich begrüßt worden sei und dort meinen Mathelehrer, der als bildungspolitischer Sprecher der Konkurrenzpartei sich um ein Mandat beworben hatte, auch argumentativ die Schau gestohlen hätte. Da ging mir ein ganzer Kronleuchter auf! Auch in der mündlichen Matheprüfung hatte er sich im Alleingang gegen den Schulleiter und weitere Kollegen durchgesetzt und mir eine Fünf verpasst. Meinen Schrecken wusste Herr J., der mich - wie gesagt - nie unterrichtet hatte, zu mindern, indem er mir versicherte, ich hätte die Abiturprüfung geschafft, trotz jener negativen Note wegen des ansonsten passablen Notenbildes. Den feierlichen Abschluss des Schullebens bildete ein Abiturball im Hotel Seipel in Bad Orb. Mit Partnerin. Aber da sind wir schon bei einem neuen Kapitel.
Schmetterlinge
Mit dem bereits 1964 bezogenen eigenen Haus war ein Traum Wirklichkeit geworden. Das von allen Familienangehörigen in ungezählten Stunden Eigenleistung und natürlich mit Handwerkern des Ortes errichtete eigene Haus war bezugsfertig. Stolz übersiedelten wir von der Hauptstraße in die Kettelerstraße (heute Luisenstraße). Im Erdgeschoss bot sich der Großmutter Anna und ihrer Schulfreundin Anna Grohmann die erste geräumige Wohnung seit ihrer Vertreibung 1945. Der Opa war noch vor dem Umzug leider verstorben und konnte seinen Traum vom eigenen Haus nicht mehr erleben. Im ersten Stock standen mit Schlaf-, Wohn-, Ess- und Kinderzimmer, Bad, Küche und Balkon den Eltern und meinem Bruder Günter ausreichend Platz zur Verfügung; ich erhielt ein weiteres Zimmer unter der Dachschräge, wo ich ungestört arbeiten und schlafen konnte.
Diese Mittsechziger waren die „Golden Sixties“, was nicht nur an der aufkommenden Beatmusik lag. Die Schule bot keine unüberwindlich scheinenden Schwierigkeiten mehr, die Wochenenden sahen mich im Kreise der Altenmittlauer Freunde bei legendären Kneipenwanderungen nach Geiselbach, Albstadt, Horbach oder Somborn. Fotos aus dieser Zeit regen zum Schmunzeln an: Sorgfältig frisiert, zumeist in guten Lederschuhen, im Anzug, oft auch mit Krawatte zogen wir auf staubiger Landstraße und holprigen Waldwegen von einem Ziel zum nächsten, nicht selten mit einer Flasche Bier in der Hand, und fast immer unter lautem Absingen mehr oder weniger zotiger Lieder. Gemeinsamer Ausgangspunkt war immer die im Volksmund „Tobian“ genannte und heute nicht mehr existierende Gastwirtschaft im Oberdorf von Altenmittlau, wo das „Vorglühen“ begann, flankiert von den neuesten Schlagern und Hits aus der Musikbox. Welche Leistungen wir damals vollbrachten, verdeutlicht allein der Blick auf unser Dorf Altenmittlau: Vom Oberdorf bis zum Unterdorf waren in aller Regel sechs Gastwirtschaften abzuarbeiten. Die Hauptstraße war nicht geteert oder gepflastert, sondern bestand aus einer Abfolge von Schlaglöchern im Staub-Sand-Kies-Gemisch, kurz: sie bestand aus Dreck. Einen unterirdischen Abwasserkanal gab es erst später, Klospülungen versammelten sich in Sickergruben, die restliche Brühe wurde samt Küchenabfällen durch Regenrinnen auf die Straße geleitet, was üblicherweise am freitäglichen Badetag zu flächendeckenden Straßenüberflutungen führte und zu vor sich hin stinkenden Abwasserrinnen am Straßenrand, beliebter Treffpunkt der örtlichen Fliegenpopulation.
Es war die Zeit, in der die hormonelle Entwicklung signalisierte, sich ab sofort stärker für Mädchen zu interessieren. Bei meinen Altenmittlauer Freunden hatte diese Phase bereits früher eingesetzt, was man bemerkte, wenn der eine oder andere plötzlich nicht mehr in unserer Gemeinschaft auftauchte, sondern dem Rendezvous mit einem Mädchen den Vorrang einräumte. Freilich beneidete ich sie, die sich mit ihren Monatslöhnen ganz anders als ich in Szene setzen konnten. Unter den Mädchen meiner Gelnhäuser Schulklasse gab es wohl einige, die mein Interesse weckten, doch hatte ich mit meinem weit entfernten Wohnort und dem dadurch eingeschränkten Aktionsradius keine Chance gegen die Gelnhäuser Platzhirsche.
Berühmt-berüchtigt war ein Altenmittlauer Tanzlokal, das als „Schubiak“ in die Dorfannalen eingehen sollte. Seit etwa 1965 war unsere Jungenschar an nahezu allen Samstagabenden und Sonntagnachmittagen dort Stammgast. Und wenn mal wegen Betriebsferien geschlossen war, dann bot sich ein Tanzlokal im benachbarten Dorf Horbach an, ebenso eins in Albstadt und eins in Neuenhasslau.
Im Schubiak spielten die Bands der Region immer für einen Monat live auf, sie hießen Blue Water Boys, Five Lappins, Les Troubadours usw.. Zu Rhythmen und neuesten Songs der aufkommenden Musikrevolution der Beatles, Troggs, Rolling Stones, Animals, Mersey Beats usw. versuchten wir, uns auf staksigen Beinen auf glattem Fliesenboden unfallfrei zu bewegen. Zwar befand auch ich mich häufig auf der Tanzfläche, doch eine richtige Zündung wollte zu keiner der jungen Damen aufkommen. Dabei bestand durchaus Auswahl, weil junge Leute sogar aus der Frankfurter Region zu jenem Lokal anreisten. Meine Auserwählte sollte ich erst etwas später und unter ganz anderen Umständen kennen lernen.
Im alljährlichen Frühling noch immer unter lästigem Heuschnupfen leidend, hatte ich mich zu dessen Bekämpfung in die Hände meines Hausarztes Dr. Otto Bartels begeben. Dieser verpasste mir regelmäßig eine Volon-Spritze in den Allerwertesten, was für einige Wochen Ruhe versprach. Nötig war die medizinische Gabe nicht nur wegen der zumeist sonntags stattfindenden Fußballspiele, sondern auch wegen der dann besseren Konzentration auf die schulischen Erfordernisse und aufs Tennisspiel. Einer unserer Nachbarn aus der Hauptstraße hatte mich von diesem schönen Sport überzeugt, mir einen seiner älteren Dunlop-Schläger überlassen und mich in den Somborner Tennisclub eingeführt.
Als eines Tages im Behandlungsraum von Dr. Bartels mein entblößter Hintern ängstlich der Spritze entgegen zitterte, öffnete sich plötzlich die Tür und seine junge Arzthelferin betrat den Raum. Ich bin mir sicher, einen knallroten Kopf bekommen zu haben, denn derartige Aussichten hatte ich bislang niemandem, schon gar nicht einem weiblichen Wesen außer meiner Mutter gewährt. Es bleibt im Dunkel, ob jene junge Dame gleich empfand, für mich aber stand fest, dass diese Zeugin intimster Geheimnisse dingfest gemacht werden musste. In den Schlagern und Hits war ja fast immer von Liebe die Rede, wobei jenes Gefühl nie näher beschrieben wurde. War jener weibliche Blick auf meinen männlichen Allerwertesten jetzt etwa Auslöser für die berühmte Liebe auf den ersten Blick? Wie konnte mehr Sicherheit ins emotionale Durcheinander gebracht werden? Heuschnupfen, Schmerzen in Schulter, Hüfte, Kopf, Herz, Gelenken traten nun natürlich häufiger auf und erhielten wegen der notwendigen Gänge zum Arzt einen ganz anderen Wert als früher. Konnte ich doch auf diese Weise das bezaubernde Wesen näherer Beobachtung unterziehen. Sie selbst schien völlig ahnungslos und unbeeindruckt, was mich ermutigte, einen nächsten Schritt zu wagen. Auf dem Weg vom und zum Somborner Tennisplatz hatte ich bald bemerkt, dass sie nach der Praxisarbeit mit ihrem roten Fahrrad auf dem vorbeiführenden Feldweg nach Hause fuhr. Also traf ich sie rein zufällig, um sie nach kurzer Unterhaltung in den Jazzkeller des Grimmelshausen-Gymnasiums nach Gelnhausen einzuladen. Nicht mehr rekonstruierbar ist, ob sie mir gleich oder erst ein paar Tage danach absagte, das Ergebnis blieb dasselbe. Auch als ich ihr einige Zeit danach eine zweite Einladung zum gleichen Ziel andiente, blieb die Antwort negativ. Was im Nachhinein betrachtet gar nicht so schlimm war, hätte ich doch gar nicht gewusst, wie wir zu abendlicher Stunde hätten dorthin gelangen können, geschweige denn anschließend nach Hause. Denn Busse fuhren um diese Tages- bzw. Nachtzeit keine mehr. Taxi - zu teuer. Es gab allerdings den Gelnhäuser Klassenkameraden Dietmar H., der älter und erfahrener als der Rest der Klasse war und ein bemerkenswertes Auto sein Eigen nannte. Von seinem Wohnort Meerholz fuhr er täglich in einem silberfarbenen Porsche-Oldtimer in der Schule vor und nahm mich öfters nach der letzten Stunde mit zu sich nach Hause, von wo nach gemeinsamem Mittagessen und der Erledigung der Hausaufgaben er mich nach Altenmittlau fuhr. Im Jazzkeller am Gelnhäuser Untermarkt war er regelmäßiger Gast, ich dagegen nur selten und nur dann, wenn er sich anbot, mich nachts von dort nach Hause zu chauffieren. Weil ich zu dieser Zeit selbst Fahrstunden nahm, fiel mir der Unterschied zwischen seinem Sportwagen und vorschriftsmäßig ausgestatteten Autos besonders auf. Porschetypisches heiseres Aufbrüllen drängte beim Gasgeben ohrenbetäubend aus dem bescheidenen VW-Käfermotor im Sportwagengewand. Reserveräder führte er sogar zwei mit sich. Notwendig, weil beide Vordersitze nicht arretierbar waren und die Räder zwischen Lehnenrückseite und Rückbank für gerade Haltung sorgten. Zur akustischen Vervollkommnung trug die Hupe bei, die sich bei Rechtskurven automatisch meldete. Bei Linkskurven dagegen öffnete sich die Beifahrertür, was fatale Folgen hätte haben können, wenn sie nicht mittels eines Schlipses am Haltegriff vor dem Beifahrer festgezurrt gewesen wäre.
Ich weiß nicht, wie ich zu der Maxime gelangt war, nach einem dritten Versuch keinen vierten mehr zu unternehmen. Weil ich diese gelegentlich bedrückende Erfahrung bei erhaltenen Körben auf Tanzveranstaltungen gemacht hatte und auch jetzt konsequent zu befolgen gedachte, verlangte der letzte Versuch sorgfältige Planung. Noch vor ihrem Dienstschluss chauffierte mich Dietmar H. im beeindruckenden Sportwagen, dem lahmen Schaf im Wolfspelz, zu ihrem Wohnhaus am Ortsrand von Somborn. Ich klingelte und kam so zu meiner ersten Begegnung mit ihren Eltern. Mein Begehr, das Töchterlein für einen Abend mit definierter Zeitbegrenzung in den Gelnhäuser Keller auszuführen, stieß zumindest auf keinen Widerstand. An große Freude, Dankbarkeitsbekundungen oder gar Begeisterungsstürme kann ich mich aber auch nicht erinnern. Das änderte sich erst, als ich den sächsischen Dialekt der Mutter bemerkte und sie darauf ansprach. Da kam Freude auf, denn wir stellten fest, im Sachsenland gar nicht weit voneinander gelebt zu haben. Jetzt war natürlich über meine Eltern zu berichten, über unsere Übersiedlung und dass wir nur durch den Berg zwischen Somborn und Altenmittlau voneinander getrennt wären. Als einige Zeit später das Objekt meiner Begierde den Schlüssel im Wohnungsschloss drehte, war der Käs' schon gegessen. Die Mühe, weitere Zurückweisungsgründe zu suchen, hatten die Eltern ihr abgenommen. Und so konnten wir mehr oder weniger befreit nach ein paar Tagen dauerhupend, klappernd, mit von mir krampfhaft fest gehaltener Tür und Reina neben den Reifen auf dem Rücksitz die Reise nach Gelnhausen antreten. Vielleicht beeindruckte mein gesittet zurückhaltendes Benehmen (andere würden es als Schüchternheit bezeichnen) so sehr, dass sie meinem jetzt notwendigen Wunsch nach weiteren Treffen nichts entgegensetzte. Also besuchten wir mit elterlichem Segen auch das Altenmittlauer Tanzlokal „Schubiak“, wo mich nicht wenig störte, dass einige der anwesenden jungen Männer sie auf einen Freund ansprachen, mit dem sie wohl schon einmal dort gewesen war. Auf dem staubigen Nachhauseweg gestand sie mir denn auch jene Freundschaft, ließ aber erkennen, dass das keine Bindung auf Lebenszeit wäre. Meine Sympathiebekundungen schienen aber noch zu schwach, um von ihr ernsthaft wahrgenommen zu werden. Aber das Eis war gebrochen. Die Eltern trafen sich. Besonders mein Vater, der unter enormem Heimweh nach der sächsischen Heimat litt, fand in den Eltern Lenz herzliche Gesprächspartner und eine Art Ersatzheimat, die er nach sonntäglichen Gottesdiensten in der evangelischen Kirche von Somborn gern aufsuchte.
1967 bis 1968 – Erntezeit
Mittlerweile war ich mir recht sicher, dass das neue Gefühl die berühmte Liebe sein müsste. Doch war diese innere Irritation belastbar, auf Dauerhaftigkeit ausgelegt? Mehrfach zwang ich mich deshalb zu geradezu sadomasochistischen Experimenten, die darin bestanden, möglichst nicht mehr an meine Freundin zu denken und sie auch nicht zu treffen. Diese an Selbstverstümmelung grenzende Tortur hielt ich nie länger als einige Tage durch, was mir zunehmend Sicherheit brachte, dass es wohl doch Amors Pfeil sein musste, der mich so durcheinanderbrachte. Das Sehnen nach Gemeinsamkeit wurde zur Sucht. Zur Vertiefung unserer Beziehungen trug nicht wenig mein engerer Freundeskreis bei, speziell zu Peter S., mit dem wir damals auf selbst gebauten Tandem-Fahrrädern Radtouren im Spessart unternahmen. Auch gehörten Fahrten zum abendlichnächtlichen Schwimmen in einem Baggersee nahe Aschaffenburg zu den sehr guten Erinnerungen an jene emotional aufgewühlte Zeit. Obwohl ich auf Wolke Sieben schwebte, war die Gefahr, aus selbiger hart auf den Boden zu fallen, recht ausgeprägt. Ich hegte Zweifel, ob das bei meiner Partnerin auch so war. Denn sie schwärmte vom kommenden Sylvester, wo ein mit ihrer Familie befreundeter Bergführer aus Immenstaad sie zu einer Hüttenparty eingeladen hatte, auf der er einen seiner jungen Bergführer mit ihr näher bekannt zu machen gedachte. Da drohte Gefahr! Mir in die Hände spielten die Bedenken ihrer Eltern, zu Winterszeiten mit ihrem VW-Käfer den langen und möglicherweise schneeglatten Weg an den Bodensee anzutreten. Als sie daraufhin eine Zugfahrt dorthin in Erwägung zog, musste ich zum Gegenangriff übergehen: Für Sylvester 1967 lud ich meinen Schwarm zur häuslichen Kellerparty mit der Altenmittlauer Clique ein, - was auch ihre Eltern für besser hielten als eine ungewisse Fahrt in ungewisse Zukunft. Die Zusage machte mich überglücklich. Nun mussten nur noch die ahnungslosen Freunde aus Altenmittlau eingeladen werden.
Mit der im Sommer 1967 bestandenen Führerscheinprüfung war ich in der Lage, ihr etwas mehr als den Bereich innerhalb des heimischen Horizonts zu bieten - aber mangels eigenen fahrbaren Untersatzes war das bloße Theorie. An eine praktische Umsetzung des Wunsches war trotz Ferienarbeit aus finanziellen Gründen gar nicht zu denken. So erfreute mich nicht wenig, dass Papa Lenz uns seinen Käfer zur abendlichen Fahrt in den Gelnhäuser Jazzkeller überließ - mit mir am Steuer. Was gleich am Anfang schief ging, weil ich bei der Rückkehr mit dem ausladenden hinteren Kotflügel die Toreinfahrt mitnahm. Die späte Stunde verhinderte eine sofortige Beichte des Missgeschicks. Tags darauf nahmen die Eltern den Schaden ungewöhnlich gelassen hin und ließen sich nichts anmerken. Weniger Glück hatte ich trotz glimpflichen Ausgangs bei den letzten Sylvestervorbereitungen.
Die Feier zum Jahreswechsel, als spontaner Einfall mit keinem Verantwortlichen (meinen Eltern) abgesprochen, stellte hohe logistische Anforderungen. Da mussten der Keller ausgeräumt, die Regale voll Obstkonserven, Gemüse und Kartoffeln mit Stoff- und Kunststoffbahnen verhängt werden; Stühle und Tische galt es zu organisieren und die grelle Deckenlampe musste durch farbige Verhüllung partytauglich gemacht werden. Raumschmuck, Getränke und Essbares waren zu besorgen. Reina half trotz täglich langer Arbeitszeiten bei den Vorbereitungen, die am 30. Dezember enden sollten. Ich stand unter Hochspannung, denn Reina hatte Praxisdienst bis in den späten Abend hinein, ihre dringend nötige Mithilfe verzögerte sich ins Ungewisse. Als ich das Signal erhielt, dass sie schon im elterlichen Zuhause in Somborn war, nahm ich den von Peter S. mir für Besorgungsfahrten zur Verfügung gestellten NSU Prinz 3, um sie abzuholen. In einer etwas unübersichtlichen Kurve am Ortseingang von Somborn geriet ich auf vereistem Straßenrand ins Schleudern. Quer über die Straße ging es, durch einen Drahtzaun bis zu einem Apfelbaum und einen Strommasten, an dessen Befestigungsseil das Auto - mit dem Vorderteil in der Luft - über einem Abhang hängen blieb. Glücklicherweise konnte ich unbeschadet auf der Beifahrerseite aussteigen. Zuerst schien es, als habe niemand den Unfall bemerkt, denn weit und breit waren weder Fahrzeuge noch Fußgänger zu sehen. Also begab ich mich zu Fuß zurück nach Altenmittlau, um Freund Peter das Unheil zu beichten und mir meinen Führerschein einzustecken. Als wir zusammen an den Unfallort zurückkamen, um das Auto aus seiner misslichen Lage zu befreien, war die Polizei auch schon da. Ein Anwohner hatte sie gerufen, weil bei ihm wie im halben Dorf wegen der Erschütterung des Strommastens das Licht ausgefallen war. Zwar wunderten sich die Polizisten darüber, gerufen worden zu sein, weil wegen des Fehlens von Personenschäden der entstandene Sachschaden mit der Versicherung hätte geregelt werden können. Jetzt aber waren sie schon mal da und mussten das Ganze amtlich verfolgen.
Während der kommenden Nacht zum 31. 12. fand ich wegen dieses Ärgers kaum Ruhe. Wie erleichtert aber war ich, als am Sylvestervormittag Peter S. und Jürgen K. mit eben jenem Unfallauto vorgefahren kamen. Als Automechaniker hatten sie die halbe Nacht durchgearbeitet und die beschädigten Karosserieteile durch intakte Teile eines anderen Unfallwagens in gleicher Farbe und gleichen Typs ersetzt. Damit stand einer zünftigen und feuchtfröhlichen Sylvesterparty in das bedeutungsvolle Jahr 1968 nichts mehr im Wege.
Freilich begann es wegen der mir auf Grund unangepassten Fahrverhaltens vom Amtsgericht zugedachten Strafe wenig erfreulich. Ein mir nicht mehr bekannter Betrag oder ersatzweise vier Tage Haft sollten die Tat sühnen. Letzteres kam mir gerade Recht, denn es galt, sich auf die nahenden Abiturprüfungen vorzubereiten. Und wo könnte man das besser als in ungestörter Gefängnisruhe? Mit der Leitung der Gelnhäuser Haftanstalt war ich bereits handelseinig geworden, dürfte Lehrbücher in die Zelle mitbringen. Als ich erfuhr, dass mein Vater den Geldbetrag gezahlt hatte, war ich darüber überhaupt nicht glücklich, im Nachhinein aber schon, weil mein weiterer Lebensweg mit dem amtlichen Aktenhinweis auf einen Gefängnisaufenthalt gewiss anders verlaufen wäre.
Die Abiturprüfungen schaffte ich letztlich auch ohne Vorbereitungshaft, wobei der Mathematiklehrer mir in der mündlichen Prüfung die schon erwähnte übliche Fünf spendierte. Im Unterschied zu heute erfuhren die Abiturienten damals ihre Noten erst bei der offiziellen Zeugnisübergabe, das heißt mehr als eine Woche nach den letzten Prüfungen. Während dieser Woche suchten alle Klassenkameraden die Fachlehrer in ihren Wohnungen zu freundschaftlichen Abschiedsrunden auf. Lediglich beim Mathelehrer Heinz P. erschienen nur zwei Schüler, nämlich mit Dietmar H. und mir ausgerechnet die einzigen mit mangelhafter Mathematiknote. Dass diese negativ war, erfuhr ich erst am Tag nach der Prüfung im denkwürdigen Gespräch mit dem mich nie unterrichtenden Englischlehrer.
Unbeschwerte und bis in die Morgenstunden dauernde ausgelassene Abifeiern prägten die Tage bis zur feierlichen Zeugnisausgabe und zum abschließenden feierlichen Abiturientenball im Hotel Seipel von Bad Orb. Dies war übrigens - bis auf eine Ausnahme im Folgejahr - für 50 Jahre das letzte Treffen der Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Erst 2018 sollten wir uns alle wiedersehen, leider mit Lücken, die mittlerweile der Tod in unsere Reihen gerissen hatte.
Doch noch sind wir in jenem Schicksalsjahr 1968: Wieder waren Weichen zu stellen. Die Tauglichkeitsprüfung zur Bundeswehr hatte ich zwei Jahre zuvor bedenken- und widerspruchslos wie’s Wetter über mich ergehen lassen. Da aber hatte ich Reina noch nicht kennen gelernt - jetzt hatte sich die Situation grundlegend verändert und verlangte nach angepassten Lösungen. 1966 war ich nicht willens gewesen, so lange vor der Abiturprüfung angesichts gut gefüllter Schultage ohne die dafür nötigen Muße über die Folgen zu sinnieren. Erst als ich nach Abschluss der Schulzeit den Einberufungsbefehl zum Grundwehrdienst in Schwarzenborn/Nordhessen erhielt, befasste ich mich näher mit dieser Art Zukunft. Mein politisches Bewusstsein war besonders in den letzten Schuljahren deutlich gereift, und so erhob ich Einspruch gegen die Einberufung aus gesundheitlichen Gründen. Warum ich die Gesundheit als Hinderungsgrund angab, ist heute nicht mehr nachvollziehbar, denn andere Gründe wogen schwerer. Bei der erneuten Prüfung im Kreiswehrersatzamt von Hanau saß ich denn zunächst auch einem Arzt gegenüber, dem ich von meinem regelmäßigen Heuschnupfen, von gelegentlichen Herz- und Kopfschmerzen berichtete. Beeindruckt war der Mediziner aber erst, nachdem er die herunterhängende Fingerkuppe des rechten Zeigefingers entdeckte. Damit könnte ich als Soldat gar nicht richtig grüßen, würde in der Truppe Gelächter hervorrufen und damit vermutlich die Wehrkraft schwächen. Im anschließenden Gespräch mit einem Offizier gab ich die mich tatsächlich mehr bewegenden Gründe an. Als Soldat, so wendete ich ein, würde ich für den Konfliktfall ausgebildet, der nach Lage der Dinge den bewaffneten Einsatz gegen die Volksarmee der DDR zum Ziel hätte. Dort stünden mir meine ehemaligen Klassenkameraden gegenüber, auf die ich nie schießen könnte. Dem Einwand, dass diese möglicherweise weniger Skrupel hätten, auf gegnerische Soldaten zu feuern, entgegnete ich, dass mich das nicht kümmere, für mich sei nur meine persönliche Überzeugung wichtig. Der Uniformierte schien mit der Antwort zufrieden und fragte zuletzt, warum ich diesen gewichtigen Grund nicht schon bei der Musterung genannt hätte. Gute Frage! Einige Tage später erhielt ich die Nachricht, dass ich nach erneuter ärztlicher Kontrolle - übrigens durch einen mir völlig unbekannten Arzt - der Ersatzreserve II zugeteilt worden sei und deshalb nicht zum Dienst in der Bundeswehr eingezogen würde. Bin mir sicher, mit dieser Regelung die Kampfkraft des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses zumindest erhalten zu haben.
Glücksgefühle allerorten. Mit der gewonnenen Zeit konnte ich den durch die Übersiedlung und das schulische Wiederholungsjahr entstandenen Altersvorsprung vor meinen Freunden kompensieren. Die weitere Lebensplanung konnte unbeschwert beginnen. Der Studienbeginn im Wintersemester 1968/69 war alternativlos.
Reina war über die neue Entwicklung mindestens so erfreut wie ich. Gemeinsam konnten wir als verliebtes Paar unbekümmert nun viel mehr als zuvor unternehmen. Nahezu allwöchentliche Wochenenden sahen uns bei Freunden in Waldrode, bei Tanzveranstaltungen, besonders der Band „Bluewater Boys“, deren Mitglieder wir bald alle persönlich kannten, und bei einer ersten mehrtägigen Radtour, die uns entlang des Mains und der Romantischen Straße nach Rothenburg ob der Tauber führte. Eher spannungsgeladen-romantisch unsere Reiseverpflegung: Reina hatte, im Gegensatz zu mir, keine Skrupel, aus den am Wege liegenden Gärten Gurken, Möhren und anderes Essbares zu besorgen. Wir genossen diese erste gemeinsame Tour auf den Flügeln der Liebe. Besonders Rothenburg präsentierte sich als Stimmungsverstärker, denn dort fanden - von uns nicht erwartet – gerade Reichsstadttage statt, ein mittelalterliches Fest, bei dem die gesamte Stadt sich im Ornat des 17. Jahrhunderts präsentierte, Autos draußen bleiben mussten, Pferde, Kutschen, Landsknechte, Bürger und Aristokraten das Bild beherrschten.
Reinas Vater ebnete für die Zeit bis zum Studienbeginn den Weg zu einem Ferienjob in der Postabteilung der Versandfirma Schwab in Hanau, in der auch er mit seiner Frau beschäftigt war. Die täglich mit Papa Lenz bestrittenen Fahrten zum Arbeitsort und zurück verwoben mich noch enger mit Reinas Familienleben. Nach bestandenem Abitur war auch in meiner Familie Reina voll anerkanntes Mitglied geworden. Bei meinem Vater ohnehin, aber bei meiner Mutter hatte es einige Vorbehalte gegeben. Sie galten nicht der Person, sondern entsprangen der Befürchtung, ich könnte durch Reina auf dem Weg zum Abitur energetisch und zeitlich beeinträchtigt werden. Zeit spielte übrigens für meine liebe Mutter eine sehr große Rolle. So wurden alle Mahlzeiten zu genau fest gelegten Zeiten eingenommen. Pünktlichkeit war oberstes Gebot, Verspätungen wurden deutlich wahrnehmbar missbilligt. Für Reina und mich, die wir hauptsächlich sonntags unsere Runden in waldreicher Umgebung drehten, bedeutete dies, mittags um 12 Uhr und abends um 18 Uhr pünktlich bei Tische zu sitzen. Es sei denn, dass ich bei Lenzens aß, dazu aber musste das Fehlen am Kleinschen Tisch zuvor bekannt gegeben sein. Insgesamt wurden die Beziehungen zwischen unseren Familien immer enger, Heinrich Lenz half tatkräftig beim Garagenbau an unserem Haus, ich etwas später beim Umzug der Lenzfamilie innerhalb Somborns.
Man kann nicht drei Monate lang Tennis spielen, mit der Freundin spazieren und tanzen gehen und einen Ferienjob ausüben, ohne an die weitere Zukunftsgestaltung zu denken. Hierzu betätigte sich - wie schon bei der Frage nach der Schulwahl 1961 - mein aus Bonn angereister Onkel Kurt erneut als Weichensteller. Weil begrenzt verfügbare finanzielle Möglichkeiten der Eltern und erhöhte Ausgaben für Studium, Fahrten zur Universität, eventuell sogar für ein Studentenzimmer in Frankfurt, sich unversöhnlich gegenüberstanden, neigten die Eltern und ich eher zu einem möglichst kurzen Studium, was nach Lage der Dinge ein Lehrerstudium für Grund- und Hauptschulen bedeutet hätte. Kurt konnte uns jedoch davon überzeugen, am anderen Ende der Möglichkeiten zu beginnen und das Studium für das höhere Lehramt aufzunehmen, also für Gymnasien, auch wenn dieses zwei Pflichtsemester mehr erforderte. Nach Lage der Dinge kamen mit Deutsch, Geschichte und Politik drei Studienfächer in Frage. Die Bewerbung an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität zu Frankfurt war erfolgreich, und so wurde im heißen Herbst 1968 ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Mit den Rädern in Rothenburg o.d.Tauber