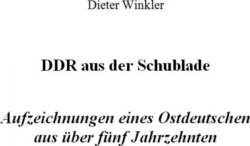Читать книгу DDR aus der Schublade - Dieter Winkler - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Vorwort
ОглавлениеWeil eine radikale Kritik an der Gesellschaft der DDR in der DDR selbst öffentlich kaum äußerbar war, schrieb man sie nicht selten auf. In der DDR entstand in den 40 Jahren ihrer Existenz eine Vielzahl höchst unterschiedlicher sogenannter Schubladentexte, die seit 1990 Band für Band an eine auf sie nicht gerade neugierige Öffentlichkeit drängen. Als eine Quelle für das wirkliche Denken und Handeln zumindest eines Teils der ostdeutschen Bevölkerung machen diese Texte jedoch deutlich, dass unter einer autoritär verkrusteten Oberfläche immer mehr an geistiger Bewegung stattfand, als für Blicke von außen erkennbar war.
Zu den Autoren solcher Schubladentexte hatte ich gehört. Darauf weisen bereits die gemeinsam mit Torsten Hilse herausgegebenen vier Bände „Schubladentexte aus der DDR“. Wenig hatte mich dabei das Verfassen umfangreicher Traktate gereizt – bei mir hatten Erlebnisse, Ereignisse und Lektüre immer wieder und vor allem zu bitteren oder boshaften, lapidaren oder vergleichenden Kurzkommentaren geführt, die ich später „Randbemerkungen“ nannte. An denen habe ich vom ersten Einfall bis zur letzten Fassung zumeist mehrere Tage formuliert, gelegentlich sogar noch länger: unterwegs auf der Straße, in langweiligen Zuhörveranstaltungen, abends am Schreibtisch. Dort, wo mir aus dem Einfall keine mich einigermaßen oder mehr befriedigende Textfassung geriet, warf ich die Sache wieder weg. Darum sind – von Ausnahmen abgesehen – nur meine Aufzeichnungen aus den Sechzigern ein echtes Tagebuch.
Wichtiger als die Form meiner Notizen ist etwas anderes: Bei meinen „Aufzeichnungen eines Ostdeutschen aus über fünf Jahrzehnten“ handelt es sich um Texte eines vor und nach dem Epochenbruch von 1989/90 Nichtprominenten – eines Menschen also, den die Umstände dazu brachten, den ehemals zweiten deutschen Staat, aber auch dessen „Aufarbeitung“ nach seinem Untergang, von „unten“ zu betrachten. Außerdem gehöre ich zu den Ostdeutschen, die in der DDR erlernte Verhaltensmuster auch nach dem Ende der DDR nicht mehr abgelegt haben. So begann auch nach 1990 meine Reaktion auf nunmehrige Regierungs- u. a. Verlautbarungen in der Regel weiterhin mit der Frage: Was spricht dagegen? War ich doch auch im Westen schon sehr bald auf neue Behauptungen von hoher Ideologiehaltigkeit und geringem Realitätsgehalt gestoßen: Wie etwa der, dass die größere soziale Ungleichheit im Westen der „Preis der Freiheit“ wäre. Als ob im Chile des demokratisch-sozialistischen Präsidenten Allende mehr an sozialer Ungleichheit geherrscht hätte als unter der wirtschaftlich und sozial neoliberal ausgerichteten Diktatur des Generals Pinochet.
Auch stieß ich, wie z.B. meine zweite Anlage beweist, in der neu erworbenen westdeutschen Gesellschaft auf so manche Erscheinungen, die mich ziemlich fatal an unangenehme Realitäten von ehedem erinnerten. Aus einem langjährig kritischen DDR-Bürger konnte so nur ein höchst kritischer Bundesbürger entstehen.
Wer bin ich?
Noch mitten im II. Weltkrieg in Leipzig geboren, gehören zu meinen prägenden Kindheitserfahrungen ein fehlender, weil an der Front gefallener Vater, Ruinen auf Schritt und Tritt, der Hunger in den ersten Friedensjahren – aber auch die Erzählungen meiner Großmutter, bei der ich aufwuchs, und anderer Verwandter und Bekannter über das Elend während Inflation und Weltwirtschaftskrise.
Natürlich sind Teil meiner Kindheitserfahrungen auch Kommunisten. Sie waren nicht alle Machthaber und nicht alle synchron mit ihrer Führung denkend und handelnd. Mein Stiefvater, dem als gelernten Zimmermann die Sprache des Proletariats vertraut war, gab mir z. B. nach dem XX. KPdSU-Parteitag 1956 die Lehre mit auf den Weg: „Politikern darfst du nie allein aufs Maul schauen. Sondern musst du stets auch auf die Pfoten gucken. Das gilt auch für die eigenen Leute.“1) An meinen Schulen stieß ich auf Lehrer, die auf Grund eigener politischer Irrungen in ihrer Jugend ihren Schülern ebenfalls ein gewisses Maß an politischem Irrtum zugestanden: Meine Oberschule mussten während meiner vier Jahre dort2) nur Schüler mit nicht ausreichenden fachlichen Leistungen wieder verlassen. Allerdings hörte ich von anderswo durchaus auch anderes.
Eines einte alle Kommunisten, auf die ich damals stieß: Die Überzeugung, in Ostdeutschland eine „bessere Gesellschaft“ – ohne Krieg und Wirtschaftskrisen und mit Aufstiegschancen auch für Kinder aus der „Arbeiterklasse“ – „errichten“ zu können. Wer im festen Glauben an die „Sieghaftigkeit“ der kommunistischen Sache die Verfolgungen der Nazi-Diktatur überlebt hatte, nahm damals allzu gern an, dass seine „Sache“ auch „noch nicht Überzeugte“ über kurz oder lang zu gleichen historischen Einsichten wie ihn selbst bringen müsse. Mich machte jedoch etwas anderes zum jungen Kommunisten: Im Kinderferienlager 1955 an der Ostsee hatte ein gleichaltriges westdeutsches Mädchen meine Hand ein wenig zu lange in die ihre gelegt. Danach war ich von der Richtigkeit der seinerzeitigen Wiedervereinigungsprogrammatik der SED zutiefst überzeugt. Mein nunmehr staatstreuer Aktivismus hat mir allerdings so manchen Ärger bei Mitschülern eingebracht. Woanders konnte sich solcher „Ärger“ Mitte der fünfziger Jahre sogar noch bis hin zu „Klassenkeile“ ausweiten.
Obwohl ich an meiner Oberschule zu den da ziemlich raren engagierten Anhängern des Staates unter den Schülern gehört hatte, schickte mich die Universität nach dem Abitur in einen Leipziger Großbetrieb, um mir dort noch mehr „Bewusstsein der Arbeiterklasse“ anzueignen. Diesen zwei Jahren in der „materiellen Produktion“, im Gorki’schen Sinne ebenfalls „Universitäten“, entstammt die zweite Generation der mich prägenden politischen Erfahrungen.
Als ich im Sommer 1962 mein Arbeiterleben beendete, wusste ich, dass das uns Ostdeutschen nach dem Sieg der Sowjetunion im II. Weltkrieg übergestülpte sowjetisch-stalinistische Modell von „Sozialismus“ keinesfalls die versprochene glorreiche Zukunft bringen würde.
Zu dieser Erkenntnis hatten mir die ersten verbotenen Bücher verholfen, die ich ab dem Herbst 1960 in die Hände bekam3), ein Besuch in Westdeutschland im März 1961, bei dem ich dort nirgends den in der Schule verkündeten „sterbenden Kapitalismus“ entdeckt hatte, und die Gespräche mit den Arbeitern im Betrieb, von denen einige ältere mein Denken in Richtung einer demokratischen Variante von Sozialismus bzw. eines „Dritten Weges“ zu lenken verstanden.4)
Die sechziger Jahre in der DDR waren ein auffällig widerspruchsvolles Jahrzehnt. Auf der einen Seite war die politische Führung ausgesprochen reformfreudig, stellte sie immer wieder selber Strukturen der eigenen Gesellschaft in Frage5), auf der anderen Seite aber herrschte sie immer noch höchst autoritär, teilweise sogar brutal. Ein neu aufgekommener Technokratismus und ein weiter bestehender Stalinismus hatten zu einem merkwürdigen Amalgam gefunden.
In meiner Studentenzeit 1962 bis 1967, immer noch in Leipzig, gehörte ich zu den Kommilitonen, die hin und wieder als „Abweichler“ auffielen. Neben Freunden oder mir selbst in die DDR mitgebrachter Literatur wie Jaspers „Vom Ursprung und Ziel der Geschichte“, Klaus Mehnerts „Der Sowjetmensch“, Sartres „Marxismus und Existentialismus“, Djilas' „Gespräche mit Stalin“, dem Godesberger Programm der SPD, aber niemals einem Exemplar der in Westdeutschland verlegten Zeitschrift „Der 3. Weg“, las ich in der einzigen Leipziger Bibliothek, in der man in den Sechzigern so etwas ohne „Giftschein“ in die Hände bekam – der Bibliothek des Museums für Geschichte der Leipziger Arbeiterbewegung im Dimitroffmuseum, dem ehemaligen Reichsgericht – marxistische Autoren nichtleninistischer Provenienz wie Bernstein und Kautsky6) sowie Rosa Luxemburgs damals noch verbotene Schrift „Die Russische Revolution. Eine kritische Würdigung“ 7). Bei Marx selber entdeckte ich später die mit der angeblich von Marx' Erkenntnissen geprägten politischen Realität in der DDR so überhaupt nicht korrelierende Aussage, dass die Freiheit das „Gattungswesen des ganzen geistigen Daseins“ sei.8) In der gleichen Schrift ist übrigens der Satz zu finden: „Kein Mensch bekämpft die Freiheit; er bekämpft höchstens die Freiheit der anderen.“ 9) Auf ihn geht wahrscheinlich die berühmte Bemerkung von Rosa Luxemburg zurück, dass Freiheit „immer die Freiheit der Andersdenkenden“ ist.10)
Natürlich suchte man in meinen Kreisen auch nach Widersprüchen bei den ansonsten überaus respektierten Marx und Engels. So glaubte ich, diesen Widerspruch entdeckt zu haben: Nach Marx soll der Mensch im Kommunismus nach seinen Fähigkeiten arbeiten und nach seinen Bedürfnissen erhalten. Gleichzeitig wusste Marx aber, dass jede Bedürfnisse befriedigende Produktion neue Bedürfnisse hervorbringt. Damit musste, so fand ich, die Befriedigung von Bedürfnissen neu ausbrechenden Bedürfnissen stets hinterherlaufen.
Vielleicht verfügte das Leipzig der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts über ein paar Voraussetzungen, den Traum von einem „Dritten Weg“ in besonderem Maße sprießen zu lassen.
Als erstes besaß Leipzig in der damaligen DDR den Ruf, besonders „dogmatisch“ zu sein11), weil an der Spitze des Parteiapparates des Bezirkes ein Mann stand, der nur in sehr groben Rastern zu denken vermochte. Er war nach meiner Erinnerung in den meisten Gruppen der Leipziger Intelligenz höchst unbeliebt und provozierte durch Äußerungen und Maßnahmen immer wieder eine stille, aber unübersehbare Ablehnung des durch ihn repräsentierten Typs von Gesellschaft.
Als zweites hatten an der Leipziger Universität nach dem Ende der NS-Herrschaft einige bedeutende liberal-kommunistische Wissenschaftler wie Ernst Bloch, Hans Mayer oder Werner Krauss Lehrstühle erhalten, so dass in größeren Teilen der damaligen intellektuellen Szene Leipzigs ein Wissen hochgradig existent war, dass Sozialismus auch anders als uns vorgeführt gehen müsse.
Als drittes wirkten in Leipzig geistige Einflüsse von außerhalb des abgemauerten Staates intensiver als in der übrigen DDR. Die hohe Zahl ausländischer Studenten – im Studentenklub stieß ich sogar auf einen Kommilitonen aus dem fernen Neuseeland –, zu denen man den Kontakt suchen konnte und aus deren Erzählungen man gesellschaftliche Realitäten und gesellschaftliche Vorstellungen von anderswo in der Welt zu rezipieren vermochte bzw. von denen man gelegentlich sogar verbotene Literatur mitgebracht bekam12), war ein erstes Element von größerer Weltoffenheit. Das zweite war, last not least, die Leipziger Messe, in deren Buchhaus sich nicht wenige Studenten immer wieder auf nicht legale Art und Weise mit westlicher Literatur versorgten.13)
Da zum Zwecke der Diskussion eines „Dritten Weges“ gegründete Gesprächskreise in den sechziger Jahren von der Staatsmacht umgehend unterdrückt worden wären, Überlegungen in diese Richtung aber ziemlich verbreitet waren, existierten auf der einen Seite nur rein informelle Formen von Gedankenaustausch zum Thema14), und waren auf der anderen Seite die Ergebnisse von Überlegungen und Gedankenaustausch sehr an die intellektuellen Fähigkeiten und Interessen von Individuen gebunden. Kritik richtete sich in meinem Bekanntenkreis nahezu nie gegen das „sozialistische Ideal“, aber mehr oder minder radikal gegen die von uns erfahrene „sozialistische Realität“. Allerdings hatten auch wir Illusionen. Etwa die, dass z. B. ich damals glaubte, der Einzug von Demokratie in die Gesellschaft würde auch – eindimensional – den Einzug von mehr Vernunft in die Gesellschaft nach sich ziehen. Unsere Ablehnung bezog ich aber niemals vorrangig auf Personen – man denke nur an die 1953 populäre Losung „Der Spitzbart muss weg“ –, sie galt stets politischen und sozialen Strukturen.
Hatte auf dem Gebiet der Politik der damalige sowjetische Parteiführer, der „Entstalinisierer“ Chruschtschow, schon selbst auf das Beispiel USA verwiesen, als er die Begrenzung der Verweildauer von seinesgleichen an der Spitze von Partei und Staat auf zwei Legislaturperioden begrenzen wollte15), so gingen Nicht-Parteimitglieder wie ich natürlich über diesen Vorschlag hinaus: Der erste Mann im Staat sollte unserer Meinung nach nicht mehr von einer Parteiführung aus sich heraus bestimmt, sondern vom Volk gewählt werden. Wiederum wie in den USA sollten zwei Kandidaten zur Wahl stehen, die für eine unterschiedliche Handhabung des vorhandenen Gesellschaftssystems – in unserem Falle also eines sozialistischen – stehen sollten.
Dazu wollten meine Gleiches, Ähnliches oder Anderes denkenden Freunde und ich natürlich durchgängig echte Volksvertretungen, die nicht einfach die vom SED-Apparat und seiner Nationalen Front vorgefertigten Gesetze und Beschlüsse diskussionsarm abnickten; wir wollten Volksvertretungen aus geheim gewählten Persönlichkeiten, die von – sich zu Demokratie, Solidarität und Antifaschismus bekennenden – Parteien und Massenorganisationen, auch neu gegründeten, zur Wahl gestellt werden sollten. Auf den prinzipiell öffentlichen Tagungen dieser Volksvertretungen sollten auch Delegierte betroffener Bürger, Vereine und Interessengruppen Anhörungs- bzw. Rederecht erhalten. Spenden von Interessenorganisationen an Parteien und Massenorganisationen sowie ein professionell betriebener Lobbyismus kamen in den Vorstellungen von meinesgleichen von moderner Demokratie nicht vor. Unsere Demokratie sollte zweifellos „bürgerlicher“, aber nicht „kapitalistischer“ werden. Die Idee von Volksabstimmungen wie in der Schweiz fanden wir, ohne Genaueres über deren Handhabung zu wissen, ausgesprochen anziehend.
Obwohl meine Freunde und ich den Großteil unserer politischen Informationen aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern Westdeutschlands bezogen (sowie vom Rias und dem deutschsprachigen Dienst der BBC), bestand bei einem Teil von uns – infolge der in ihr stattgefundenen gesellschaftlichen Restauration, vor allem der Übernahme so vieler ehemaliger Nazis in leitende Stellungen jeglicher Couleur – gegenüber der 1949 in Westdeutschland neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland erst einmal ein unübersehbar reserviertes Verhältnis. Erst mit dem Auftreten der „68er“ sollte sich das ändern.
Parallel zu dem Nachdenken über demokratischere politische Strukturen verlief ein Nachdenken über wirtschaftliche Reformen. Reformen in der Wirtschaft hielten in den Sechzigern bekanntlich auch Parteiführungen für nötig, die an politische Reformen weniger zu denken wagten.16) Im Mittelpunkt der Überlegungen der Wirtschaftsreformer der kommunistischen Parteien – in der DDR vor allem Apel, in der ČSSR Šik und in Ungarn Nyers – standen Änderungen hin zu einem anderen Typ von Reproduktion, Reformen bei den Relationen zwischen Planung und Markt, anders strukturierten Eigentumsverhältnissen bei den Produktionsmitteln bzw. einen effizienteren Umgang mit dem juristisch staatlichen Eigentum an diesen Produktionsmitteln.
Die von den jeweiligen Parteiführungen initiierten Reformdiskussionen schwappten über die offiziellen Medien und die Kommentare in den westlichen Funkmedien auch ins Volk. Da sich meinesgleichen nie einfach auf Konzepte von „oben“ verließ, auch wenn sie noch so überzeugend klangen, versuchten wir auch bei den Wirtschaftsreformen gelegentlich Eigenes zu denken. Dabei hatten wir immer die Absurditäten beider dominanter Gesellschaftssysteme vor Augen: Dass sich die Arbeitslosen in der kapitalistischen Weltwirtschaftskrise nicht einfach durch Arbeit hatten aus ihrem Elend befreien können, und dass bei uns im „Sozialismus“ Arbeiter nicht selten produzieren mussten, was sie als Kunden keinesfalls kaufen wollten.
Wenig „Abweichlerisches“ war zur offiziellen Diskussion zum notwendigen neuen Typ der Reproduktion zu sagen. Die Sowjetunion hatte den II. Weltkrieg auch gewonnen, weil sie in den dreißiger Jahren ihre industrielle Basis extensiv erweitert hatte17), und dort in Osteuropa, wo es vor 1945 nur wenig Industrie gegeben hatte, war mittlerweile Industrie durch die kommunistischen Regierungen geschaffen worden. Aber diese Wirtschaftspolitik war nun an ihre Grenzen gestoßen. Zusätzliche Arbeitskräfte waren in den entwickelteren Regionen Osteuropas kaum mehr zu mobilisieren, und aus den mit hohem Aufwand gewonnenen Rohstoffen entstanden zu wenig hochwertige Endprodukte – also predigten alle führenden Ökonomen von DDR, ČSSR, Ungarn und anderswo in den sechziger Jahren den Übergang zu einem neuen Typ von Reproduktion: der intensiv erweiterten Reproduktion.18)
Die Wirtschaftslenkung sollte nach den offiziellen Reformern nicht mehr so starr wie bisher durch eine Wirtschaftsbürokratie nach ihrem Dogma „Der Plan ist Gesetz“ erfolgen. Eine gesellschaftliche Rahmenplanung vor allem für Ressourcen, sollte durch eine Marktsteuerung vorrangig für Gebrauchsgüter und Dienstleistungen ergänzt werden. Irgendwann hatte einer meiner Freunde auch davon gehört, dass in Frankreich damals eine „Planification“ existierte. Schon den Fakt, dass es offenbar auch andere Varianten von Planung gab als die bei uns im sowjetischen Machtbereich gängigen, fand er mitteilenswert.19)
Auf Grund der guten Erfahrungen mit den damals in der DDR noch existierenden privaten oder halbstaatlichen Kleinbetrieben konnte sich meinesgleichen beim „Eigentum an den Produktionsmitteln“ nur eine Ausgestaltung der vorhandenen „gemischten Wirtschaft“ vorstellen: mit Staats- und kommunalen (Groß-)Betrieben, mit privaten oder genossenschaftlichen Klein- und Mittelbetrieben; und diese vor allem für die Produktion von Waren des täglichen Bedarfs. Freiraum sollte für die Gründung neuer, auf Innovationen aufbauender Privatfirmen und Genossenschaften geschaffen werden. Bei den Staatsbetrieben hatte ich immer den zu Beginn der fünfziger Jahre noch völlig in Staatsbesitz befindlichen Volkswagen-Konzern vor Augen, der mittlerweile aus ideologischen Gründen – „Eigentum für alle“ – von Ludwig Erhard einer Teilprivatisierung unterworfen worden war, der sich aber als staatlicher Betrieb vordem in keinerlei Weise in roten Zahlen befunden hatte.
Bei der Frage, wie die staatlichen Betriebe künftig zu führen waren, hatte ich mir Eigenes ausgedacht. Dass die „Arbeiterselbstverwaltung“ in Jugoslawien nicht so effektiv wie geplant funktionierte, war als Gerücht auch bis in meine Kreise vorgedrungen. Also sollte auch bei mir an der Spitze der Staatsbetriebe ein Verwaltungsrat stehen, der über alle strategischen Fragen des Betriebes zu entscheiden und für das operative Geschäft Direktoren zu berufen hatte. Meine nun völlig eigenständige Überlegung: Dieser Verwaltungsrat sollte zu einem Drittel aus Vertretern des Staates, zu einem Drittel aus Vertretern der Belegschaft und zu einem Drittel aus Abgesandten der Volksvertretungen des Territoriums bestehen, in dem der Betrieb seinen Sitz hatte. Die Vertreter des Staates sollten dabei jedoch keinesfalls aus irgendwelchen Behörden kommen, sondern aus in Wirtschafts- oder Technik-Sparten von Universitäten, Hoch- oder Fachschulen des Territoriums des Betriebes geheim gewählten Wissenschaftlern bestehen.20) Bei den Belegschaftsvertretern sollte sowohl das aktive wie das passive Wahlrecht erst nach mindestens einem Jahr Betriebszugehörigkeit erteilt werden. Aus der Bundesrepublik Konrad Adenauers stammten meine Vorstellungen von einer gut gestaffelten Progression bei der Einkommenssteuer21), aus den USA Roosevelts der Gedanke einer hohen Erbschaftssteuer.22)
Es blieb die Frage: Wer sollte den Umbau der Gesellschaft durchführen, dem „Dritten Weg“ real Gestalt geben?
Da sich Chruschtschow 1956 mit Teilen der sowjetischen Parteiführung von dem damaligen kommunistischen Halbgott Stalin getrennt hatte, weil die Entwicklung in der KPTsch zwischen 1962 und 1968 so überzeugend vorführte, dass im „fortschrittlichen Teil“ von Parteiintelligenz und Nomenklatura in Krisenzeiten ihrer Gesellschaft die Bereitschaft wachsen konnte, zu einem Reformlager zu werden, glaubten Freunde und ich in den Sechzigern noch an die Möglichkeit einer „Revolution von oben“. 23)
Als ich mich in der Folge solcher Überlegungen in der letzten Phase der Herrschaft Ulbrichts mit der Frage abquälte, ob ich nicht in die SED eintreten und wie ein Teil der „68er“ im Westen einen „langen Marsch durch die Institutionen“ antreten sollte, konnte ich mich zu diesem Schritt jedoch nicht durchringen. Im Ungarn János Kádárs hätte ich mich mit Sicherheit anders entschieden.24)
Die Gründer der Alt-Bundesrepublik hatten bei deren Konzipierung 1948/49 auf die uns Deutschen so überaus unvollkommen geratene Republik von Weimar zurückgegriffen, dabei aber auffällige Mängel in deren politischer Architektur korrigiert – meinesgleichen hätte in den Sechzigern ganz gern noch einmal mit der Novemberrevolution von 1918 begonnen und diese radikaler als geschehen weitergeführt: z.B. bis hin zu einer Wirtschaftsdemokratie.
Im „Prager Frühling“ von 1968 hatte die Suche nach einem „Dritten Weg“ in Osteuropa kulminiert. In der DDR verlor der „Dritte Weg“ mit der Biermann-Ausbürgerung 1976 und dem darauf folgenden Exodus vieler nicht parteitreuer linker Kulturschaffender weitgehend seine intellektuelle und soziale Basis. Nur in der evangelischen Kirche der DDR, in der einige Verantwortliche frühzeitig Befürchtungen hinsichtlich des in den siebziger Jahren im Westen aufkommenden Neoliberalismus und seines Menschenbildes hegten, blieb die Hoffnung auf einen „verbesserlichen Sozialismus“ noch bei einigen Verantwortungsträgern auf der politischen Agenda.
Mit den „Gorbi“-, „Gorbi“-Rufen am 7. Oktober 1989, den Forderungen einiger Demonstranten jenes legendären Herbstes und dem Appell „Für unser Land“ erlebten die Sehnsüchte nach einem „Dritten Weg“ in der DDR ein letztes Aufbäumen.
Nach der Öffnung der Mauer setzte sich im Volk der DDR jedoch ganz rasch die Auffassung durch: Warum eine eigenständige Variante von moderner Gesellschaft entwickeln, wenn die schnelle Übernahme des – für jeden sichtbar – so erfolgreichen westdeutschen Gesellschaftsmodells weniger aufwendig ist? In der DDR des Frühjahrs von 1990 reussierte – mit einem kleinen, aber gewichtigen Zusatz – ein alter Wahlkampf-Slogan der West-CDU noch aus Adenauers Zeiten: „Keine Experimente MEHR“.
Das Modrow’sche Konföderationskonzept, also die Übernahme des Grundprinzips des britisch-chinesischen Hongkong-Vertrages von 1984 für die Wiedervereinigung Hongkongs mit China – „Ein Staat, zwei Systeme“ – war für die Mehrheit des DDR-Volkes von 1990 völlig inakzeptabel.
Unter „Kapitalismus“, den sie unbedingt übernehmen wollten25), verstanden die meisten Bewohner der DDR im ersten Halbjahr 1990 allerdings nur den „Rheinischen Kapitalismus“ mit seiner auf die effiziente Produktion hochwertiger Gebrauchs- (und Investitions-)Güter aller Art ausgerichteten Realwirtschaft einschließlich angeschlossenem, alle Gesellschaftsgruppen mehr oder minder berücksichtigendem Sozialstaat. Selbst Menschen wie ich, die auf Helmut Kohls Ankündigung „blühender Landschaften“ skeptisch reagierten, konnten sich damals noch keine kapitalistische Ökonomie vorstellen, wie sie heute vielen Menschen das Leben schwer macht: mit einer künstlich aufgeblähten Finanzindustrie als dominierendem Faktor – mit einer von einer kurzsichtigen Politik über die massive Senkung von Einkommens- und Unternehmenssteuern produzierten überquellenden Liquidität auf der einen Seite und einem durch diese Steuersenkungen auf der anderen Seite geschaffenen neuen Finanzbedarf von Staat und Kommunen.26)
Wie rasant sich nach der Maueröffnung die Stimmung bei den Menschen der DDR veränderte, beweisen für mich die beiden folgenden Erinnerungen: Auf der großen Demonstration am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz hatten einige hellsichtige Teilnehmer noch ein Plakat mit der Aufschrift mit sich geführt: „Nicht neue Herren, sondern keine“. Nur wenige Monate später fuhren – ansonsten höchst sympathische – Mitarbeiterinnen einer Berlin-Hellersdorfer Bildungseinrichtung nach Westberlin, um sich aus der dortigen Bildungsverwaltung einen neuen Chef auszusuchen. Nach einem neuen Leiter unter in der DDR oppositionell Gewesenen zu suchen – auf diese Idee waren sie gar nicht erst gekommen.
Hinsichtlich der politischen Rationalität im westlichen System hatte es aber selbst in meinem Freundeskreis Anfang 1990 noch Illusionen gegeben: Wir hatten eine Herrschaft von Vernunft in der modernen westlichen Demokratie erwartet, wo es für Herrschende einzig schwieriger ist, Unvernünftiges auf Dauer durchzusetzen.27)
1945 sandte die sowjetische Propaganda ein Foto rund um die Welt mit sowjetischen Soldaten darauf, die auf dem Berliner Reichstagsgebäude die sowjetische Flagge aufpflanzten. Heute wissen wir, die auf dem Bild festgehaltene Tat war nicht das Originalgeschehen, sondern eine im Auftrag der sowjetischen Führung später nachgestellte Aktion. Ob die Forschung bei der DDR-„Aufarbeitung“ einmal Ähnliches herausfinden würde? So wissen wir Zeitzeugen durchaus, dass uns von interessierter Seite gelegentlich Anführer in unserem einstigen Streben nach mehr Freiheit präsentiert werden, die bei unseren tatsächlichen Unternehmungen in Richtung von mehr Freiheit noch wenig dabei gewesen waren. Außerdem scheint der DDR-Historiografie von heute die Aktenhinterlassenschaft des MfS nicht selten die gewichtigste schriftliche Quelle zu sein. Hatte die Stasi aber tatsächlich den Einfluss auf unsere Geschichte, der ihr heute so gern zugeschrieben wird? Da wir DDR-Menschen von einst vom Einwirken des MfS auf unser Handeln weniger wussten als die Forscher von heute, handelten wir zumeist, ohne diese Einflüsse ausreichend in unser eigenes Handeln bzw. dessen Kalkül einzubeziehen. Die Erkenntnis dieser Unschärferelation sollte m. E. in jegliche DDR-Geschichtsschreibung gehören, die sich vorrangig auf die MfS-Akten stützt.
Mit meinen „Aufzeichnungen eines Ostdeutschen aus fünf Jahrzehnten“ möchte ich ein wenig zu der Einsicht beitragen, dass wir einstigen DDR-Menschen anders funktionierten
als die Mächtigen der DDR zu ihrer Zeit annahmen, und
auch viele Deutsche von heute es mittlerweile vermuten.
Da die Texte zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind, wurde zwar die Rechtschreibung durchgängig heutigen Kriterien angepasst, die Form der Texte blieb aber weitgehend im Originalzustand.
Dieter Winkler
Oktober 2012/Februar 2013