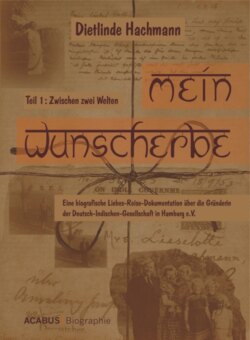Читать книгу Mein Wunscherbe. Teil 1: Zwischen zwei Welten - Dietlinde Hachmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLIESELOTTE
Die Kriegsjahre – 1938 – 1949
Am 29. September 1938 verließ ich recht überstürzt Schottland. Ich war so sehr mit meinem großen Kummer, der Trennung von Deboo, beschäftigt, dass ich nicht über die weitere Zukunft nachdenken mochte.
Zurück zu Hause, in Schönebeck an der Elbe, erzählte mir meine Mutter, was sich in der Zwischenzeit, speziell in meinem Elternhaus, verändert, bzw. ereignet hatte. Die Politik sparte sie allerdings zum größten Teil aus. Sie versuchte hartnäckig zu ignorieren, was sich „draußen“, damit meinte sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schönebeck, zusammenbraute.
Sie litt seit vielen Jahren insgeheim noch immer an dem Verlust ihres ersten Kindes, unserem Geschwisterchen, dass wir nie kennengelernt hatten, und ganz augenscheinlich auch unter dem Tod ihres Mannes. Unser herrlicher Garten war daher für sie ein Paradies, eine Stätte, in der sie aufgehen konnte. In Wirklichkeit aber war es ihr Zufluchtsort, an den sie sich mit viel Arbeit zurückziehen konnte, ohne als „Fahnenflüchtige“ zu gelten. Alles andere wollte sie anscheinend nicht wahrhaben und ließ es nicht wirklich an sich herankommen. Vermutlich war die drohende Kriegsgefahr für meine Mutter ein höchst willkommener Anlass, mich wieder nach Hause zu holen, ihre Schäfchen um sich zu scharen.
Dann musste ich ihr in aller Ausführlichkeit von meinen Aufenthalt bei Tante Olly berichten, wobei ich alles was mit Deboo zu tun hatte, nicht erwähnte. Ich wollte mir nicht von anderen Menschen, und seien sie mir noch so nah, sagen lassen, wie aussichts- und sinnlos meine Liebe war und dass ich wieder „auf den Boden der Tatsachen“ zurückkehren sollte. Das wusste ich selber. Trotzdem war es schmerzhaft und tat weh – jeden Tag aufs Neue. Hinzu kam, dass ich mein abgebrochenes Studium in Edinburgh vermisste und meine Mutter wegen der angespannten Lage nicht wollte, dass ich mich auf einer anderen Universität irgendwo in Deutschland einschrieb. Deshalb wurde beschlossen, dass ich mir so schnell wie möglich Arbeit suchen sollte.
Es erwies sich zunächst als recht schwierig. Trotzdem hatte ich, dank meiner Sprachkenntnisse und einem Stenografiekursus, den ich bereits 1936 absolviert hatte, Glück und fand recht bald eine Anstellung als Sekretärin bei den Junkers Flugzeug- und Motorenwerken Dessau, die in Schönebeck ein Zweigwerk hatten.
Die Junkers-Werke waren, nachdem das Reichskommissariat für Luftfahrt Professor Junkers schon 1933 genötigt hatte, seine vielen Patente unentgeltlich dem Luftfahrtministerium in Berlin zu übertragen, zum größten und modernsten Rüstungsbetrieb der Welt ausgebaut worden. Hermann Göring, der Reichsminister für Luftfahrt, hatte im Rahmen eines „Programms für Arbeitsbeschaffung“ damit begonnen, die JU 52, die berühmte „Tante JU“, aber auch andere Flugzeuge, für militärische Zwecke im Großserienbau herzustellen.
Das Geschäft florierte und ich hatte genug Arbeit, in die ich mich hineinstürzte, so dass mir fast keine Zeit mehr blieb, um traurig zu sein, denn der Tag verflog rasend schnell. Abends half ich zu Hause und danach fiel ich meist todmüde ins Bett. Von Krieg konnte bei uns nicht die Rede sein. Dennoch hatte meine Mutter Recht behalten. Knapp ein Jahr nach meiner Rückkehr, begann mit dem Überfall auf Polen, der Zweite Weltkrieg. Unser Leben ging aber genau so weiter wie bisher. Mein Bruder Hans besuchte die Schule, verabredete sich in der Freizeit mit Freunden und musste, wie auch ich, bei allen Arbeiten die im Garten zu erledigen waren und bei der Ernte mithelfen. Abends und am Wochenende verarbeiteten wir die Früchte und das Gemüse. Wir kochten Marmelade, machten Gelee, Mus und Säfte, weckten Früchte und Gemüse ein. Unser Vorratskeller füllte sich mit jedem Tag. Wir waren sehr dankbar für die gute und reichliche Ernte.
Inzwischen waren mehr als zwei Jahre seit meiner Rückkehr aus Schottland vergangen. Eines Tages bemerkte ich, dass einer der ranghöheren Abteilungsleiter, ein Herr Hachmann, der erst kürzlich nach Schönebeck gekommen war, sehr häufig die Gelegenheit nutzte, um in mein Büro zu kommen. Zunächst fiel das zwar nicht auf, denn ich konnte noch nicht erkennen, in welcher Funktion er nach den ein oder anderen Akten fragte. Das kam erst, wie es häufig geschieht, durch einen Zufall heraus. Mein Vorgesetzter wollte in dem Moment sein Büro verlassen, als Herr Hachmann gerade mal wieder eine Akte mitnehmen wollte. Beide begrüßten sich sehr freundschaftlich, aber mir fielen dennoch die erstaunten Blicke meines Vorgesetzten auf, als er die Akte bei Herrn Hachmann sah. Er schaute auf sie, dann von Herrn Hachmann zu mir und danach erhellte sich sein Gesicht, als wäre ihm nicht nur ein Licht, sondern ein ganzer Kronleuchter aufgegangen. Ich merkte, wie mir das Blut in den Kopf schoss. Es war mir unglaublich peinlich, dass ich nicht selber bemerkt hatte, „Opfer“ eines Anbahnungsversuches geworden zu sein. Empört wollte ich protestieren, aber die beiden verließen, vielsagend grinsend, gemeinsam mein Büro. Mit einem vor mich hin gemurmelten „Na warte“, ging ich wieder an meine Arbeit.
Als ich am nächsten Morgen die Plastikhaube von meiner Schreibmaschine zog, fand ich eine kleine Schachtel Pralinen mit einem Zettel daran.
„Entschuldigung. Ich wollte Sie nicht kompromittieren, aber ich konnte nicht anders. H.H.,“ was Hans Hachmann bedeutete.
Von da an kam er täglich, oft sogar mehrere Male. Wenn er nicht so unglaublich charmant gewesen wäre, immer zu einem Scherz aufgelegt und den Kopf voller Unsinn gehabt hätte, was mich stets sehr erheiterte, zudem er auch noch sehr gut aussah und gebildet war, ich hätte mir seine Aufdringlichkeit längst verbeten. Irgendwie verstand er es, ständig meine Aufmerksamkeit zu erregen. Er war interessant.
Nach ein paar Monaten gab ich es schließlich auf, ihn immer wieder abzuweisen und seine Einladungen auszuschlagen. Er kam auf immer neue Ideen, mich zu begeistern, zu überraschen, Ausflüge zu planen, Originelles zu improvisieren.
Im Juni hatte Hitler Paris eingenommen. Ich bekam von Hans Hachmann zu meinem Geburtstag einen von ihm selbst gemalten Eiffelturm geschenkt, mit dem Versprechen, mich eines Tages nach Paris einzuladen, um mit mir auf den Champs-Elysses zu flanieren. Zu diesem Zeitpunkt ließ sich Hitler von uns Deutschen als den „größten Feldherrn aller Zeiten“ bejubeln.
Obwohl wir auch jetzt noch immer nicht unter dem Krieg zu leiden hatten, wie es später der Fall war, machte ich mir viele Gedanken um die Zukunft. Von Deboo hörte ich nichts mehr. Ich war nicht enttäuscht, denn ich hatte es im tiefsten Herzen gewusst. Ohnehin hatten wir unsere Adressen nicht ausgetauscht. Allerdings fühlte ich mich nicht frei von ihm. Er war mir immer noch sehr nah und ich dachte häufig an ihn.
Eines Tages gab ich dem Drängen von Hans Hachmann nach, wir gingen zusammen aus, Höflichkeit und Etikette wahrend. Danach unternahmen wir öfter etwas zusammen. Als wir uns schließlich näherkamen, erzählte ich ihm von Deboo und meinen Empfindungen ihm gegenüber. Er hörte sehr aufmerksam zu und wurde recht nachdenklich. Nach einer Weile erzählte er mir dann jedoch von seinem bisherigen Leben, von dem ich bis dahin nichts Genaues wusste. Er war bereits verheiratet gewesen und hatte zwei Töchter. Die Ehe war allerdings gescheitert und vor wenigen Monaten geschieden. Deshalb war er der Meinung, dass wir unser beider „Vorleben“ abschließen könnten, da jeder seine Erfahrungen gemacht hatte.
So einfach war es jedoch nicht. Hans zog mich zwar körperlich sehr an, ich mochte ihn wirklich gerne, seine fröhliche, unbekümmerte Art, seine Intelligenz, seinen Erfindungsreichtum, seinen Witz und seine Klasse, aber ich fühlte mich dennoch an Deboo gebunden, ohne erklären zu können, warum. Es war gut, dass wir viel über meine Bedenken und Ansichten sprechen konnten, denn ich kam selber mit diesem Durcheinander nicht zurecht. Schließlich machte Hans mir ein Angebot, weil er spürte, dass ich sonst zu keinerlei Entschluss kommen würde. Er hatte wohl viel über die Situation nachgedacht, denn eines Tages lud er mich zu einem romantischen Beisammensein ein. Bei flackerndem Kerzenschein las er mir einen von ihm verfassten Aufsatz vor, der mir zeigen sollte, dass er mich nie einengen und bedrängen wollte. Sollte ich Deboo je wiedersehen und meine Gefühle wären für ihn stärker als für Hans, dann würde er mich, ohne jegliche Ansprüche, frei geben. Als einzige Gegenleistung verlangte er allerdings, absolute Ehrlichkeit und Offenheit in unserer Beziehung. Ich war über seine Gedanken und diesen Vorschlag höchst erstaunt und konnte es kaum fassen. Doch fühlte ich mich plötzlich auch befreit und das Leben schien endlich nicht mehr hinter sondern vor mir zu liegen. Er hatte mir die Entscheidung mit seinem Phantasieaufsatz leicht gemacht.
Im Frühjahr darauf, als die Elbauen wieder grün wurden und wir auf den großen Wiesen entlang der Elbe spazieren gingen, beschlossen wir, gleich nach meinem 22. Geburtstag zu heiraten.
Meine Mutter war nicht sofort damit einverstanden, denn sie gab zu Bedenken, dass Hans siebzehn Jahre älter war als ich. Aber auch sie hatte einen um zwölf Jahre älteren Mann geheiratet, deshalb galt dieser Einwand für mich nicht und mehr hatte sie dem nicht entgegenzusetzen, denn Hans besaß eine gute Stellung mit entsprechendem Einkommen.
Also heirateten wir am 28. Juni 1941, einen Tag nach meinem Geburtstag, und machten, nicht nur meiner Mutter zu Ehren, unsere Hochzeitsreise in ihre Heimat, die Lüneburger Heide. Ich liebte diese Landschaft mit den großen und herrlichen Heideflächen, die mich stets auch an Schottland erinnerten, ebenso wie meine Mutter sie geliebt hatte, bevor sie in Schönebeck meinen Vater geheiratet hatte. Als Kind hatte ich oft die Ferien bei meiner Tante, die in Luhdorf in der Lüneburger Heide, einen herrlichen Bauernhof besaß, verbringen dürfen.
Es wurde eine fantastische und unvergessliche Hochzeitsreise. Von Undeloh, einem kleinen Heideort, wurden wir mit der Pferdekutsche durch wunderschöne Heideflächen in sanftem Auf und Ab, aber stetig bergauf, nach Wilsede gefahren. Wilsede liegt auf einer Anhöhe unweit des Wilseder Berges. Von dort machten wir Ausflüge durch die Heide. Natürlich auch auf den Wilseder Berg, der größten Anhöhe in der Gegend. Wir bestaunten den weithin bekannten „Totengrund“, wanderten nach Nieder- und Oberhaverbeck, sahen „Hannibals Grab“, eine sehr beeindruckende Findlingsgruppe am Ortsrand von Wilsede. Wir sahen riesige Heidschnuckenherden, die die Heide abfraßen, damit sie im nächsten Jahr wieder umso dichter nachwachsen würde. Dabei versteckten wir uns oftmals hinter den, für diese Landschaft typischen Wacholderbüschen, um uns irgendwann zu finden und uns lachend in die weiche Heide fallen zu lassen. Manchmal fuhren wir auch mit dem Fahrrad die Gegend ab. Dabei sang Hans aus voller Kehle das Heidelied und am liebsten immer wieder seine Lieblingsstrophe:
„Ei du Hübsche, ei du Feine
Ei du Bild wie Milch und Blut
Unsere Herzen woll’n wir tauschen
Denn du glaubst nicht wie das tut!“
In Schönebeck bezogen wir nach unserer Rückkehr im ersten Stock meines Elternhauses eine sehr schöne, geräumige Wohnung. Sie besaß ein großes Kinderzimmer, ein ebenso großes Elternschlafzimmer und ein noch größeres Wohnzimmer, eine Küche und nicht zuletzt eine verglaste Veranda, von der wir einen hervorragenden Blick in unseren herrlichen Garten hatten. Während unserer Abwesenheit war die Wohnung komplett renoviert und eingerichtet worden. All das hatte Hans vor unserer Hochzeitsreise organisiert. Nun war dies unser gemeinsames Zuhause.
Im Erdgeschoss wohnte meine Mutter mit meinem jüngsten Bruder, Hans-Ewald, kurz Hansi genannt, und mit meiner etwas jüngeren Schwester Gisela, die aber bald darauf auch heiratete und mit ihrem Mann, einem Offizier, nach Berlin zog. Wir arbeiteten zunächst beide weiterhin für die Junkers-Werke, fühlten uns wohl und genossen das Leben, obwohl Krieg war.
Am 18. März 1943 kam unser erstes Mädchen auf die Welt. Hans hatte sich zwar sehnsüchtig einen Jungen gewünscht, aber er war glücklich über sein „süßes, goldiges Ding“, dass da auf diese kriegerische Welt gekommen war, von der wir aber noch immer verschont geblieben waren. Wir nannten unser Töchterchen Sigrun, aber schon bald war sie unser kleines „Mümmeli“, weil sie einen gesunden Hunger hatte und infolgedessen so prächtig gedieh, dass wir uns schon Sorgen machten, wie sie wohl aussehen würde, wenn das so weiterginge.
Ganz allmählich rückte der Krieg näher. Immer öfter gab es Fliegeralarm. Das bedeutete für uns jedes Mal, Sigrun aus dem Schlaf zu nehmen und mit dem Kinderwagen und den nötigsten, wichtigsten Dingen in den Keller zu fliehen.
Weihnachten 1943 verlebten wir noch sehr geruhsam. Meine Schwester Gisela war aus Berlin gekommen und feierte mit uns, da auch ihr Mann – als Offizier – eingerückt war. Der schön geschmückte Weihnachtsbaum interessierte unser kleines Mümmeli Sigrun zwar noch ebenso wenig wie der von ihrem Opa, Hans’ Vater, selbst gebaute Puppenwagen und dem riesengroßen Teddybären, der von ihrer Patentante aus der Lüneburger Heide kam, aber meine Mutter und ich hatten aus Wachstuch allerlei Tiere genäht und ausgestopft, mit denen spielte sie gern und kaute auch ebenso gern auf ihnen herum.
Im neuen Jahr wünschten wir uns sehnlich das baldige Ende des Krieges. Täglich erwarteten wir den Angriff auf Magdeburg, der uns sehr in Mitleidenschaft ziehen würde. Beinahe jede Nacht flohen wir aus dem Schlaf in den Keller, was mir recht schwer fiel, da ich wieder schwanger war. Über uns hörten wir die Motoren der feindlichen Luftgeschwader und rings um uns donnerten sofort darauf die Abschüsse der Flak, dazu detonierten Granaten in der Luft.
Am 21. Januar 1944 erhielt unsere kleine Sigrun ihre „Feuertaufe“. Gegen 23:00 Uhr riefen uns die Sirenen aus dem Schlummer. Zuerst zögerten wir, in den Keller zu gehen, doch plötzlich stand die erste Kaskade am Himmel und gleich darauf detonierten die Bomben in allernächster Nähe. Noch nie waren wir so schnell die Treppen hinuntergeeilt. Es war höchste Zeit, denn gleich danach begann das Inferno eines Bombenangriffes, wie wir es bis jetzt nur vom Hörensagen her kannten. Fast drei Stunden lang erzitterte unser Haus und bei jedem Einschlag einer Bombe spürten wir den Luftdruck. Fensterscheiben und Dachziegel klirrten. Die Nacht war taghell durch Leuchtbomben erhellt und der Horizont durch Feuersbrünste gerötet. Unser Stadtteil blieb zwar verschont, aber ringsum brannten die Dörfer und auch in Schönebeck hatte der Feind getroffen: Die Sprengstoff-Fabrik war in die Luft geflogen! Danach kehrte kurzfristig wieder etwas „Normalität“ ein.
Am Sonnabend, den 5. August 1944, kam unser zweites Töchterchen, Heide Ingrid, zur Welt. Durch Sigrun, die seit ihrer Geburt nur dann weinte, wenn sie Hunger hatte oder ihr etwas fehlte und sofort wieder friedlich war, wenn ihr Begehren erhört wurde, waren wir verwöhnt. Heide war anders. Sie weinte nicht, sie schrie. Nichts schien ihr recht zu gefallen und wir wussten bald nicht mehr, womit wir sie zufrieden stellen konnten. Sigrun ließ sich jedes Mal durch Heides Geschrei anstecken, so dass wir sie schnell aus dem Zimmer brachten, sobald Heide anfing zu schreien. Unsere Nerven wurden dadurch ziemlich strapaziert. Vermutlich wollte Heide den Kummer über das kriegbebende Deutschland herausschreien, denn das Leben war beschwerlich geworden, zumal es einen anderen Verlauf nahm, als Hitler uns weismachen wollte.
Zwar war Hans noch immer nicht einberufen worden, weil seine Arbeit in den Junkers-Werken wichtiger war, als an der Front zu kämpfen, worüber natürlich niemand so glücklich war wie ich. Aber die Angst, es könnte jederzeit geschehen, war ständig präsent. Die Auswirkungen des Krieges waren nun heftig spürbar, dauernd gab es Fliegeralarm, der an der Tagesordnung stand. Wir wechselten im Keller sogar oft die Räume, weil wir meinten, im anderen sicherer zu sein. Es war anstrengend, mit den kleinen Kindern nun auch tagsüber ständig zwischen Wohnung und Keller hin- und her zu pendeln.
Hinter vorgehaltener Hand malten wir uns aus, wie der Krieg ausgehen könnte. Deshalb überdachten wir viele Eventualitäten. Schließlich waren wir uns darüber einig: Falls die Russen es schaffen sollten in Richtung Deutschland zu marschieren, würden wir zu meiner Cousine Bertha C., der Patentante von unserer Sigrun, gehen, die einen großen Bauernhof in der Lüneburger Heide bewirtschaftete. Meine Mutter war nicht umzustimmen und wollte unbedingt mit meinem Bruder in ihrem Haus bleiben, gleichgültig, was geschehen würde. Aber noch war davon nicht wirklich die Rede.
Stattdessen musste Hans am 1. April 1945 doch noch zu den Soldaten. Keiner wusste, wie es weitergehen würde. Deshalb begannen wir fieberhaft, alles Brauchbare in den Keller zu räumen und auch unsere Betten dort aufzustellen, Essen herbeizuschaffen, die Kellerfenster zu verbarrikadieren, um möglichst gut für ein Leben im Keller vorbereitet zu sein, denn das Donnergrollen der Front war deutlich zu hören und es hieß, die ersten Panzer seien bereits in Magdeburg, nur wenige Kilometer von Schönebeck entfernt.
Vorsorglich hängten wir sämtliche Fenster im ganzen Haus aus, weil davor gewarnt wurde, die Brücke über der Elbe, die die Stadt Schönebeck mit unserem Stadtteil verbindet, solle gesprengt werden, um entweder die Amerikaner von der westlichen Seite oder die Russen von der östlichen Seite von der Überquerung abzuhalten. Unser Haus lag keine achthundert Meter von der Brücke entfernt, und die Detonation einer Sprengung würde unweigerlich alle Scheiben zerspringen lassen.
Hansi, mein kleiner Bruder, war zu dem Zeitpunkt sechzehn Jahre alt und unsere Mutter machte sich ständig Sorgen um ihn, da er, so oft es möglich war, mit seinem Freund auf der anderen Seite der Elbe in eine alte Chemiefabrik ging. Sie sammelten alles, was ihnen wichtig erschien, um es anschließend irgendwo gegen Lebensmittel oder andere nützliche Dinge zu tauschen. Manchmal experimentierten sie auch mit dem Gefundenen, denn mein Bruder interessierte sich sehr für Chemie.
Gegen sechs Uhr abends war eines Tages der Lärm der Panzergranaten erheblich lauter geworden. Mein Bruder war noch nicht wieder zu Hause. Gleich darauf setzte der direkte Beschuss ein, der die ganze Nacht ununterbrochen andauerte. Morgens war mein Bruder noch immer nicht da. Wir wollten uns gerade auf den Weg machen um ihn zu suchen, als es erderschütternde Detonationen gab. Die Glasscheiben der Nachbarhäuser klirrten und zersprangen, der Boden bebte. Wir hasteten auf die Straße. Nachbarn kamen zusammen, Kinder schrieen vor Schreck und Angst. Und dann hörten wir es:
Sie hatten die Brücke gesprengt!
Wie ein Lauffeuer ging diese Nachricht um. Schon von Weitem sahen wir, dass ganze Arbeit geleistet worden war: Von der Brücke, die bestimmt fünfhundert Meter lang war, blieb nicht viel übrig, sie war unbenutzbar. Die Menschen standen da und fühlten sich plötzlich wie abgeschnitten, denn der schnelle Fluchtweg in Richtung Westen war gesprengt und die Russen saßen uns im Genick!
Für uns war es aber weitaus schlimmer, denn es hieß, es wären zwei Jungen auf der Brücke gewesen, man hätte nichts Genaues erkennen können, aber der eine wäre sicher mein Bruder gewesen. Daraufhin rannte meine Mutter, so schnell sie es in ihrem Alter vermochte, noch weiter in Richtung Elbe. Ich konnte ihr mit meinen beiden Kleinen nur mühsam folgen. An ein Durchkommen zur Brücke aber, die nur noch in Fragmenten aus der Elbe ragte, die zudem eine gewaltige Strömung hatte, war – ohne sich selber in Lebensgefahr zu bringen – nicht zu denken. So stand sie da und starrte auf den Fluss. Sie wollte es nicht glauben, war in verzweifelter Panik und beharrte starrsinnig darauf, dass er nicht auf der Brücke umgekommen war.
Während wir noch fassungslos und entsetzlich traurig am Elbufer standen, ertönten von der anderen Seite über Lautsprecher Warnungen der Amerikaner: Sollte sich unser Stadtteil nicht ergeben, würde er bombardiert werden. Daraufhin wurde allgemein und in aller Eile und Angst beschlossen, den Ort schnellstens zu verlassen.
Die Kinder wurden in Kinderwagen und Kinderkarre verstaut, dazu etwas Wäsche und Lebensmittel, dann ging es – so schnell wir konnten – fort. Hinter Elbenau nahm die Tieffliegertätigkeit dermaßen stark zu, dass wir Schutz in einem Bombentrichter suchen mussten. Die Kinderwagen tarnten wir mit schnell abgerissenem Tannengrün, bevor wir uns eng an die Wand des Trichters pressten. Die Kinder lagen stundenlang mal auf uns, mal – in Decken gehüllt – neben uns. Sobald wir es aber wagten, aufzusehen, hatten wir den Eindruck, als kreisten immer mehr Tiefflieger über uns. Mitunter schien es, als würden sie sich gegenseitig heftig beschießen. In der Dämmerung konnten wir den Krater endlich wieder verlassen, denn es wurde für die Kinder empfindlich kalt. In Elbenau fanden wir schließlich Zuflucht in einer Bäckerei, nachdem wir oft vergeblich um Hilfe gefragt hatten. Der nächste Tag verging bis zum Abend relativ friedlich. Dann aber setzte plötzlich heftiger Artilleriebeschuss ein, der sich über die ganze Nacht hinzog. In dieser Nacht kamen die ersten Amerikaner durch den Ort. Am nächsten Morgen waren aber wieder deutsche Soldaten da, die die Amerikaner im Gegenangriff zurückgedrängt hatten.
Obwohl die Schießerei nicht nachließ, bestand meine Mutter darauf, in den Ort zu gehen, um Milch für die Kleinen zu besorgen. Gottlob kam sie unversehrt zurück. Mittags setzte ein heftiges Artilleriefeuer ein, das fast 24 Stunden dauerte und viele Häuser in Brand schoss. Unsere Unterkunft wurde dabei zum Teil zertrümmert. Nachdem es wieder ruhiger wurde, sahen wir die verheerenden Verwüstungen und die vielen Toten. Aufgrund der Angaben einiger deutscher Soldaten verließen wir Elbenau wieder, um nach Hause zurückzukehren, da es hier wie dort gleich gefährlich sein sollte.
Als wir nach Hause kamen, sah es auch dort ziemlich arg aus. Das Haus hatte unter dem Beschuss gelitten. Eine Bombe war direkt neben den Brunnen gefallen und die Tiefflieger hatten mit ihren Bordwaffen überall Spuren hinterlassen. Teilweise war das Dach heruntergekommen, in die Haustür war geschossen worden, das Holz war zersplittert. Im Garten waren zwei der größten Birnbäume glatt abgeschossen und in alle Winde zerstreut worden.
Jetzt folgten viele Tage, wo hin und wieder geschossen wurde, mal mehr, mal weniger und man konnte sich seines Lebens nie sicher sein, solange man sich außerhalb des Kellers befand. Täglich musste Wasser und Milch für die Kinder geholt werden, aber wir trauten uns nur nachts heraus. Von meinem kleinen Bruder hörten wir nichts mehr, so dass es anscheinend stimmte, dass er auf der Brücke umgekommen war, was uns entsetzlich traurig machte. Aber die Ereignisse folgten derart schnell aufeinander, dass es kaum Gelegenheit gab, um richtig zu trauern. Es war eine furchtbare, eine grauenvolle Zeit.
Ende April tauchte plötzlich mein Mann Hans für wenige Minuten bei uns im Keller auf. Am dritten Mai kam er wieder zurück und konnte bei uns bleiben. Da keine kriegerischen Ereignisse zu erwarten waren, schliefen wir für eine Nacht wieder in unseren alten, lieben Räumen. Es sollte allerdings das allerletzte Mal gewesen sein.
Am Morgen des 5. Mai 1945 sahen wir russische Panzer in die Stadt einrollen. Alle Soldaten wurden gefangen genommen, darunter auch mein Hans. Nun folgte eine Zeit, die schlimmer war als die des Fliegeralarms. Wir waren ständig auf der Flucht vor den Überfällen der Russen. Sie plünderten die Häuser, die Gärten. Bevor sie in unser Haus einfielen, hatte ich mich gerade noch mit den Kindern und meiner Mutter auf dem Dachboden unseres Stalles verstecken können. Anscheinend war er für die Russen nicht interessant genug, denn sie verließen, laut johlend, nach quälend langer Zeit unser Haus. Sie hatten alles Essbare, allerlei Kleidung und verschiedene andere Dinge mitgenommen. Aus den Schränken hatten sie Geschirr genommen und auf den Boden fallen lassen, so dass es nicht mehr viele heile Teller gab. Die meisten Räume sahen ziemlich verwüstet aus. Dabei konnten wir froh sein, nicht noch Schlimmeres erlebt zu haben. Die Angst ging um. Ab sofort schliefen wir nachts im Stroh auf dem Stallboden, der nur durch eine kleine Öffnung mit einer Leiter erreicht werden konnte, die wir anschließend zu uns heraufzogen. Näherten sich Schritte, wurden die Kinder mit Kissen verdeckt, damit uns kein Laut verraten konnte. Diese Zeit brachte uns fast um den Verstand!
Die Sorge um uns, die Frage, wie es wohl meiner Schwester in Berlin erging und nicht zuletzt der Tod meines Bruders zehrten an unseren, vor allem aber an den Nerven meiner Mutter. Anfang Juni wurde sie krank. Ich konnte ihr nicht helfen, so dass sie nach Gommern ins Krankenhaus gebracht werden musste, wobei mich Nachbarn unterstützten. Hin und wieder nahm ich die Kinder mit um meine Mutter zu besuchen, es waren elf Kilometer zu laufen und nicht immer war es ohne Gefahr. Meist konnte ich meine Kinder aber zu Nachbarn geben, während ich sie besuchte. Es gab keine Hoffnung für sie. Sie hatte sich aufgegeben. Am 1. August 1945 schloss sie ihre Augen für immer. Mein Kummer war grenzenlos, aber es blieb keine Zeit, um in Ruhe Abschied zu nehmen. Mit Mühe schaffte ich es, einen Sarg zu bekommen, um meine Mutter würdig beerdigen zu können.
Die Russen richteten derweil immer schlimmere Dinge an. Ich musste meine Kinder und mich schnellstmöglich in Sicherheit bringen. Da die Absicht, Schönebeck zu verlassen, schon länger bestand, nahm der Plan schnell sichtbare Formen an. Die beiden Kinderwagen waren für die zu erwartenden Strapazen nicht genügend geeignet, deshalb erstand ich für einen Teppich einen stabileren Wagen. Den bepackte ich mit den Kindern und den notwendigsten und wichtigsten Dingen und startete morgens vor fünf Uhr. Ich hatte Angst, dass die Kinder Lärm machen könnten, deshalb hatten sie Schlaftabletten bekommen. Unser Weg zog sich aber über so viele Kilometer hin, führte uns auf und ab, durch Sand und Wasser, dass sie erwachten, noch bevor die Grenze hinter uns lag. Also musste ich sehr vorsichtig sein, um nicht entdeckt zu werden.
Es war schon fast dunkel, als ich in der Ferne eine Patrouille bemerkte. Deshalb schlug ich mich, so gut es ging und in aller Eile, in die Büsche und ermahnte Sigrun zur absoluten Ruhe, sie durften uns weder sehen noch hören. Allerdings begann Heide plötzlich zu wimmern, zwar ganz leise, aber sie wimmerte. Aus Angst, die Soldaten könnten es hören, legte ich ihr vorsichtig ein Kissen aufs Gesicht, wie ich es zuvor schon oft gemacht hatte, damit das Wimmern nicht zu hören war. Als die Soldaten ganz dicht bei uns waren, fühlte ich mich vor Angst wie gelähmt. Ich verharrte in dieser Starre und wartete, bis die Soldaten an uns vorüber gezogen waren. Dann nahm ich das Kissen von ihrem kleinen Gesichtchen und erschrak fürchterlich, denn sie war bereits blau angelaufen. Etwas später wurden wir – trotz aller Vorsichtsmaßnahmen – dann doch von einem russischen Posten entdeckt. Wir hatten gewaltiges Glück, denn es gelang mir, uns loszukaufen. Danach ging die Flucht weiter.
Am 22. September 1945 trafen wir spätabends in Hannover am Bahnhof ein. Sigrun hatte das letzte Stück zu Fuß laufen müssen, da der Wagen ständig ein Rad verlor und nur unter größter Mühe vorwärts bewegt werden konnte. Todmüde übernachteten wir im Bahnhofsbunker. Nachdem wir die Nacht vorher im Saal eines Restaurants verbracht hatten – die Kinder waren begreiflicherweise sehr unruhig, so dass Heide dauernd auf dem Arm getragen werden musste – war auch die Nacht im Bunker keine sanfte, erholsame Schlafstätte.
Den nächsten Tag versuchte ich – völlig übernächtigt – zunächst den Kinderwagen notdürftig zu reparieren und etwas Essbares für uns zu organisieren. Danach schien es zwar unmöglich, mit zwei kleinen Kindern, Kinderwagen und Gepäck in einen der überfüllten Züge zu gelangen, aber irgendwie schafften wir es.
Am frühen Abend trafen wir, stark abgemagert, entkräftet und verschmutzt, nach zehn schrecklichen Tagen in Luhdorf bei meiner Tante Line ein. Wir waren in Sicherheit. Die Freude war grenzenlos und unbeschreiblich. Das erste Ziel war erreicht.
„Da ist ja unsere Oma!“, rief Sigrun erfreut aus, als sie Tante Line sah, die ihrer Schwester, meiner verstorbenen Mutter, zum Verwechseln ähnlich sah. Tante Line besaß einen sehr gepflegten, vornehmen Bauernhof, einen der größten des Ortes. Er war mir immer lieb und vertraut, weil wir in glücklichen Kindertagen oft in diesem Paradies zu Besuch waren. Nun aber vermochte ich ihn kaum wiederzuerkennen, denn er platzte aus allen Nähten. Jede Ecke war ausgefüllt mit Flüchtlingen, Ausgebombten oder Evakuierten. Eigentlich gab es für uns keinen Platz mehr, bis auf eine kleine Kammer über dem Schweinestall. Mir war alles recht. Hauptsache war für mich, den Russen entkommen zu sein.
8. Berthas Bauernhof
Bis zum 10. Oktober blieben wir bei ihr, die uns erst wieder etwas „aufpäppeln“ wollte, bevor sie uns weiter zu ihrer Tochter, meiner Cousine Bertha C., der Patentante unserer Sigrun, in den kleinen Ort Putensen in der Lüneburger Heide ziehen ließ. Aber auch hier gab es unzählige Flüchtlinge. Der Hof von Bertha war ebenso überfüllt, wie viele andere in dieser Zeit. Sie stellte uns in ihrem großen Bauernhaus im ersten Stockwerk ein Schlafzimmer zur Verfügung. In dieser Sicherheit und dem Komfort des Daches über dem Kopf, kam ich schließlich wieder zur Besinnung und konnte nun endlich den Tod meiner Mutter und meines Bruders beweinen.
Von meinem Mann hatte ich seit seiner Gefangennahme nichts mehr gehört. Eines Tages kam eine Magd zu uns in die Küche und fragte, ob wir einem armen, kranken Bettler Essen geben würden. Bertha und ich folgten ihr auf den Hof. Dort stand er, zerlumpt, schäbig, schmutzig, elend, krank und mit seinen langen, ungekämmten Haaren und dem verzottelten Vollbart kaum zu erkennen. Aber er war es. Mein Mann Hans war wieder da. Ich konnte mein Glück und die Erleichterung kaum fassen.
Nachdem die Russen ihn und viele andere Männer gefangen genommen hatten, sollten sie nach Russland abtransportiert werden. Zunächst aber brachte man sie von einem Lager ins nächste. Am Tag des Abtransportes konnte sich Hans jedoch, zusammen mit einem anderen Kameraden aus Berlin befreien und floh. Allerdings dauerte es nicht lange und er wurde erneut aufgegriffen, dieses Mal von den Engländern. Wieder kam er in ein Sammellager. Die Engländer waren jedoch nur an „richtigen“ Nazis interessiert und versuchten nun herauszubekommen, wer er war, denn Papiere hatte er überhaupt keine bei sich. Hans stellte sich sehr „dümmlich“, das heißt, er tat so, als könnte er weder englisch sprechen, noch verstehen. In Wirklichkeit bekam er aber jedes Wort von den Engländern mit. Deshalb hatte er gehört, dass sie sich Sorgen wegen Versorgungsengpässen machten und man dringend nach Landwirten suchte, um die Felder wieder bestellen zu können. Als die Reihe schließlich an ihm war, erzählte er den Briten, dass er vor dem Krieg Bauer gewesen war. Sein Name wäre Gustav C., das war der Mann meiner Cousine Bertha, der jedoch im Krieg geblieben war, und er sei auf dem Weg nach Hause. Dort würde man bestimmt schon sehnlichst auf ihn warten, denn die Ernte stünde ja demnächst bevor und man brauchte jede Hand dafür. So einfach wollten die Engländer es ihm aber wohl nicht machen, deshalb ließen sie sich eine Prüfung einfallen und fragten, wie man denn in Deutschland die Kartoffeln aussäen würde, ob das anders als in Großbritannien geschehen würde. Daraufhin fragte Hans, wobei er versuchte, ein wenig Plattdeutsch zu sprechen, was für die Region, aus der er vorgab zu stammen, typisch war: „Ja, wie macht ihr das denn? Bei uns werden die Kartoffeln nicht gesät, sondern gepflanzt.“
Diese Antwort hatte ausgereicht, um ihn als Bauern anzuerkennen. Wahrscheinlich verstanden diese Soldaten nicht viel mehr von Landwirtschaft als Hans. Es wurde ihm ein Begleitschreiben mitgegeben, das ihn ungehindert nach Hause ließ, falls er noch einmal Engländern in die Hände fallen sollte.
Da nun allerdings der kleine Raum für uns alle nicht mehr ausreichte, gab uns Bertha im Erdgeschoss noch eines ihrer Zimmer als Wohnraum. Es dauerte etliche Wochen, bis Hans von der Ruhr genesen war, sich allmählich erholte und an unseren neuen Alltag gewöhnte. Schon bald vermissten wir schmerzlich viele Dinge unseres alten Lebens, an denen unser Herz hing. Auch wollten wir nicht immer wieder Bertha um etwas bitten. Da wir aber nichts mehr besaßen, andererseits aber benötigten, suchten wir nach einer Lösung.
Diese kam, wie so oft, per Zufall und war, ich konnte es kaum glauben, eine der schönsten Überraschungen. Von Flüchtlingen, die ebenfalls aus Schönebeck stammten, erfuhren wir zuverlässig, dass mein Bruder am Leben sei! Während der Sprengung sei er tatsächlich nicht auf der Brücke gewesen, sondern hatte sich auf der gegenüberliegenden Seite in einer Fabrik aufgehalten. Er fand aber weder ein Boot, noch sonst eine Möglichkeit, gefahrlos über den Fluss und auf den Rückweg zu gelangen, bzw. uns zu informieren, so dass es viele, viele Wochen dauerte, bis er sich zu Fuß zurück nach Schönebeck durchschlagen konnte und nun, da niemand mehr zu Hause war, mit seinen sechzehn Jahren völlig auf sich allein gestellt war. Aus diesen Gründen beschloss ich, mich noch einmal auf den Weg nach Schönebeck zu machen.
Unter vielen Gefahren schaffte ich es, musste aber feststellen, dass mein Bruder in diesen Monaten gelernt hatte, allein zurecht zu kommen. Er ließ sich durch nichts dazu bewegen, mit mir zu kommen. Sein Entschluss, im Elternhaus zu bleiben und alleine seinen Weg zu gehen, stand unerschütterlich fest. So packte ich noch einmal meinen Wagen mit notwendig gebrauchten Dingen voll und flüchtete ein zweites Mal. Das Glück war mir hold, denn als ich auch auf dieser Flucht entdeckt wurde, gelang es mir, den Soldaten mit einer Kamera derart zu beeindrucken, dass er mich laufen ließ. Schade war nur, dass die Russen bei der Plünderung unseres Hauses das Fotoalbum mit den ersten Bildern unserer kleinen Heide mitgenommen hatten und sich in dieser Kamera die letzten Aufnahmen von ihr aus fröhlicheren Tagen befanden. Da wir uns erst viel später wieder eine neue Kamera kaufen konnten, gab es nie Babyfotos von Heide, was für sie stets sehr traurig war.
Zurück in Putensen, wurde gerade damit begonnen, die unzähligen Kartoffelsäcke zu flicken, woran sich jeder beteiligte. Hans war inzwischen als Landarbeiter bei Bertha „angestellt“ und half ebenso. Dabei kam der Gedanke auf, den ersten Heiligen Abend nach dem Kriege mit allen Bewohnern des Hofes festlich zu begehen. Schnell nahm diese Idee Form an, denn jeder sehnte sich nach einem friedvollen Miteinander. Auch wollten die meisten Eltern, dass ihre Kinder endlich einmal wieder Freude erlebten, deshalb sollte es für sie eine Überraschung werden.
Jede Familie hatte von Bertha für ihre Arbeit Rüben für Sirup bekommen, der in nächtlicher Kocherei in der Waschküche hergestellt wurde, ebenso wie Mehl und Kartoffelmehl. Viele arbeiteten als Tagelöhner auf dem Hof und erhielten dafür Fleisch aus den Hofschlachtungen. Ein Teil davon wurde für das Weihnachtsmahl aufgehoben. Abends hockten die Frauen beieinander und schrieben alle Rezepte für Weihnachtsgebäcke, die sie erinnerten, nieder. Da diese Familien aus vielen verschiedenen Gegenden stammten, eine davon war mit Großeltern, Eltern, sieben Kindern und ebenso vielen Hühnern auf zwei Panjewagen aus Bessarabien gekommen, gab es eine große Anzahl nie gekannter Backrezepte. Auch die Traurigsten und Griesgrämigsten unter den Flüchtlingen wurden von dieser Vorfreude angesteckt und konnten manchmal wieder lachen.
In der Backnacht durften die drei ältesten Kinder als Handlanger den Backherd anheizen und für den Holznachschub sorgen. Alle anderen Kinder wurden mit dem Versprechen ins Bett gesteckt, am nächsten Morgen einen Kringel zu bekommen. Unsere Möglichkeiten waren zwar bescheiden, aber in der Erinnerung waren es die besten und herrlichsten Gebäcke, die wir je gegessen hatten.
Unter dem Jubel der Kinder wurde wenige Tage vor Weihnachten ein riesiger Baum in die Diele des Hauses gebracht, die vorher bereits aufs Feinste geputzt worden war. Jeder hatte Schmuck gebastelt, der nun den Baum verschönerte und Bertha stellte eine elektrische Lichterkette zur Verfügung, denn Kerzen waren in ihrem strohgedeckten Haus nicht erlaubt.
Nachdem am Heiligen Abend das letzte Tier versorgt war, begann unser Fest mit dem traditionellen Grünkohlessen mit Wurst und kleinen, runden Bratkartöffelchen. So etwas Leckeres hatten viele seit langem nicht gegessen. Es wurde gesungen, der Weihnachtsmann verteilte die Backwaren und sogar die eigentlich unvermeidbare Stromsperre setzte erst ein, als der alte Großvater aus Bessarabien die Weihnachtsgeschichte auswendig erzählt hatte.
Dieses Fest blieb für alle unvergesslich. In der Erinnerung wurde es nur dadurch getrübt, dass Sigrun Ende November an Diphterie erkrankt war und operiert werden musste. Es ging ihr viele Wochen sehr schlecht, aber gerade zu Weihnachten begann es, besser zu werden, so dass wir sie Anfang Januar wieder aus dem Krankenhaus holen konnten.
Abgesehen davon, dass nichts mehr so war wie früher – wir hatten unsere Eigenständigkeit im eigenen Haus mit Selbstversorgung und gutem Auskommen gegen eine winzige beengte Behausung, abhängig vom Wohlwollen meiner Cousine, eingetauscht – ging es uns so gut, wie wahrscheinlich vielen anderen nicht, denn wir litten keinen Hunger.
Heide hatte kurz vor ihrem ersten Geburtstag das Laufen gelernt und im folgenden Winter war sie kaum zu halten. Sie war ein kleiner Irrwisch und hatte ständig nur Unsinn im Kopf. Als Sigrun nach ihrem Krankenhausaufenthalt wieder bei uns war, belastete uns die Enge der Wohnung sehr. Aber erst Ende 1946 ließ Bertha noch eine kleine Wohnküche neben dem Schlafzimmer für uns herrichten und noch später sogar von außen eine Treppe anbauen, damit wir ungestört, und nicht mehr durch ihre eigenen Räume, unsere kleine Wohnung betreten konnten.
9. Unsere Treppe
Deutschland war nach der Kapitulation geteilt. Mein Elternhaus lag nun in der sogenannten Ost-Zone, die von den Russen besetzt war, während wir in der Lüneburger Heide von den Engländern besetzt waren und Berlin, wo meine Schwester lebte, gleich an vier verschiedene Mächte vergeben war: den Russen, Engländern, Franzosen und den Amerikanern. Berlin konnte jedoch nur über die russisch besetzte Zone erreicht werden, was sich als sehr schwierig erwies.
Die vier Siegermächte hatten beschlossen, Deutschland zu entnazifizieren. Damit wurde schon bald nach der Kapitulation begonnen. In sogenannten „Meldebögen“ musste man über sich Auskunft erteilen, um danach in verschiedene Kategorien eingeordnet zu werden, entweder war man Hauptschuldiger, Belasteter, Minderbelasteter, Mitläufer oder Entlasteter. In der ersten Zeit hörte man von drakonischen Strafen, unter denen aber gegebenenfalls nicht nur die Betroffenen, sondern die gesamte Familie zu leiden hatten, denn es ging von Berufsverbot über Ausschluss der Pensionsanwartschaften, Einzug des Privatvermögens zu mehrjähriger Arbeitshaft und auch Arbeitslager.
Es ging die Angst um, dass man sich nicht entlasten konnte, denn dazu brauchte man Zeugen, die vor den sogenannten Spruchkammern die Unschuld bestätigten, bzw. eidesstattliche Erklärungen abgaben. Deshalb begann bald darauf ein reger Briefverkehr. Hans bekam plötzlich Anfragen von ehemaligen Kollegen der Junkerswerke, auch solche, die ihm gar kein rechter Begriff mehr waren, die ihn um Entlastung baten. Er selber nahm daraufhin auch Kontakt zu seiner ehemaligen Sekretärin auf und wäre gerne entlastet worden. Sie wohnte weiterhin in der nun russischen Zone. Dort fand sich jedoch niemand, etwas derartiges für ihn zu tun. Zum einen waren viele gestorben, bzw. noch nicht aus der Gefangenschaft zurück. Zum anderen waren auch etliche geflüchtet und letztendlich begannen bereits damals die später berühmt-berüchtigten Bespitzelungen und Denunziationen. Niemand wusste, wem er noch trauen konnte. Schließlich gab Hans diese Bemühungen auf und versuchte lediglich, sich dem Entnazifizierungsversuch der Briten zu entziehen, was ihm auch gelang.
Ich nahm ihm das sehr übel, weil ich der festen Ansicht war, dass er damit einen guten Neuanfang für uns verhinderte. Mit einem „Persil-Schein“ in der Hand, den er nach der Entnazifizierung gewiss von der Spruchkammer erhalten hätte, da er in eine der unteren Kategorien einzuordnen gewesen wäre, hätte er die besten Aussichten gehabt, wieder eine adäquate Anstellung zu bekommen. Durch seinen Entzug hatte er nichts in der Hand, und dadurch gelang ihm keine Rückkehr in eine gehobene Position. Also blieb er zunächst Landarbeiter bei Bertha mit großen Träumen für eine berufliche Veränderung. Dies wurde ein immer wiederkehrender Streitpunkt zwischen uns.
Zunächst einmal suchten wir aber nach Wegen, wie wir meinem Bruder, der sehr unter Hunger litt, helfen konnten. Schließlich kam uns ein glücklicher Umstand zu Hilfe, denn wir erhielten Post aus Berlin. Der Kamerad, Otto CL., mit dem Hans aus dem Gefangenenlager der Russen geflüchtet war, teilte mit, dass er gut nach Hause gekommen war und inzwischen sogar wieder ein wenig „Fuß gefasst“ hatte. Er verdiente mit allerlei Tätigkeiten seinen Lebensunterhalt für sich und seine Frau, jedoch fehlte es allerorts an Lebensmitteln. Das brachte uns auf eine Idee, schließlich heißt es nicht umsonst: „Not macht erfinderisch“.
Durch die Landwirtschaft und unsere Arbeit auf dem Hof bekamen wir von Bertha Kartoffeln und Rüben. Außerdem hatte sie uns ein Stück Land zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Deshalb konnten wir, bei äußerst sparsamem Verbrauch, immer wieder etwas davon abzweigen. So trafen wir mit Otto ein Abkommen: Da es für uns keine Möglichkeit gab, meinem Bruder Lebensmittel zu schicken, gingen diese Pakete an Otto. Dieser leitete sie an meinen Bruder im Osten weiter, was von Berlin aus möglich war. Mein Bruder füllte wiederum seinerseits die, nun wieder leeren Kartons, die absolute Mangelware waren, mit Dingen, die ursprünglich mir gehörten und er sie in Schönebeck nicht benötigte.
Als Dank für Ottos Hilfe, erhielt auch er von allem, was wir erübrigen konnten. So gingen die Pakete hin und her und jedem war damit geholfen. Auf diese Weise konnte Hans auch seinen alten Eltern, seinem Bruder und seinen beiden Töchtern, die in Dessau lebten und ebenso unter Hunger zu leiden hatten, helfen.
Hans und Otto entwickelten daraufhin bald einen lebhaften Handel, weil alle davon profitieren konnten. Binnen kurzem gab es regelrechte Wunschzettel, die man zu erfüllen versuchte. Mein Bruder brauchte einen Anzug, da seiner völlig zerschlissen war, also wurde Otto damit beauftragt, weil auch wir keinen auftreiben konnten. Meist klappte es. Später fertigte Hans Pantoffeln aus Stroh, die Otto in Berlin gegen alles, was uns fehlte, eintauschte. Damit Otto die Pakete, die er lediglich weiterleiten sollte, von denen unterscheiden konnte, die er für sich behalten sollte und über die genauestens Buch geführt wurde, adressierten wir die einen an Otto und die anderen an Maria, seine Frau. Das ersparte ihm Zeit. Auf diese Weise gelangten wir sogar wieder in den Besitz so manchen Möbelstückes aus unserer ehemaligen Wohnung und schließlich sogar meines Fahrrades. Allerdings fehlten die Muttern, so dass ich es erst viele Monate später, nachdem Hans diese Muttern irgendwo erstehen konnte, wieder in Betrieb nehmen konnte. Gerne hätten wir noch mehr und noch öfter Waren geschickt und erhalten, aber der Mangel an Kartons und Kisten ließ es meist nicht zu. Außerdem stauten sich bei Otto aus verschiedenen Gründen häufig die Sendungen aus „Ost“ und „West“, so dass immer wieder Engpässe bei den Lieferungen auftraten. Auch gingen oftmals Pakete und Briefe verloren. Da wir uns immer gegenseitig den Erhalt der nummerierten Briefe und Sendungen bestätigten, wussten wir jedes Mal ziemlich schnell, wann wieder eines verschwunden war.
Sogar Bertha schaltete sich in diesen Kreislauf mit ein, da sie ja viel mehr zu bieten hatte als wir und sie für ihren Hof auch mehr benötigte. Das „Geschäft“ florierte.
Viel Zeit blieb uns allerdings nicht, denn neben unserer Arbeit auf dem Hof suchte Hans nach einer richtigen Arbeit. Ich kümmerte mich um unseren Garten, die damit verbundene Ernte und das Einkochen. Nebenher ging ich oft in den Wald zum Beeren pflücken, die zu Hause zu Marmeladen verarbeitet wurden, um nicht nur in unsere eigene Versorgungskette zu gelangen, sondern auch als Geschenke bestimmt waren. Die Kinder gingen gerne mit und aßen sich stets an allem satt, was gerade reif war.
Weihnachten 1947 hätten wir unseren Kindern fast nichts schenken können, wäre Familie CL. aus Berlin nicht gewesen. Hans führte einen regen Schriftwechsel mit Otto, daher wussten wir gegenseitig, was uns fehlte. Ohne eine Bitte von uns, schickten sie ein Paket, das Geschenke für unsere Kinder und uns enthielt. Wir hatten ihnen für das Fest ein Sechspfundbrot, Marmelade, Maisflocken, Weizengrütze, Honigkuchen, Makronen, Trockenkohl, Tabak und etliches mehr geschickt, denn an Lebensmitteln mangelte es ihnen vor allem.
Unter dem Baum, den Hans im Wald geschlagen hatte, fanden die Kinder dann auch ihre Geschenke vom Weihnachtsmann: Für Sigrun gab es eine kleine Küchengarnitur, ein Malbuch, einen Fingerring und ein Buch mit Versen, die sie gleich auswendig lernte und Heidi fand einen Fingerring, etwas Malkreide, einen kleinen Leiterwagen und Puppenmöbel. Den Leiterwagen liebte sie so sehr, dass man sich Heidi zukünftig nicht mehr ohne ihn denken konnte.
10. Lieselotte, Hans, Sigrun und Heide
Mitte Januar 1948 tauchte plötzlich Heinz, der Bruder von Hans, bei uns auf. Wir waren alle glücklich, uns einigermaßen gesund wiederzusehen. Er hatte sich – zunächst ohne Frau und Kind – in den Westen abgesetzt und suchte nun Arbeit. Eine Woche blieb er bei uns und obwohl wir sehr beengt wohnten und „Schmalhans“ ständiger Gast bei uns war, teilten wir alles mit ihm und verlebten eine fröhliche Zeit. Die Brüder machten Pläne. Sie sahen eine große Chance darin, wenn ihnen schon nicht die Möglichkeit einer guten Festanstellung geboten wurde, sich selbständig zu machen. So zogen sie allerlei in Betracht, um es anschließend wieder zu verwerfen, da niemand genügend Geld für ein solches Unternehmen aufzubringen imstande war. Außerdem besaß Heinz durch Entnazifizierung einen „Persil-Schein“, der ihm Tür und Tor öffnete, Hans aber nicht.
Da ich kurz zuvor an einer Lungen- und Rippenfellentzündung erkrankt und noch nicht wieder richtig genesen war und auch Hans durch eine Blutvergiftung an der Hand noch ein wenig schwächelte, tat uns dieser Besuch sehr gut. Wir hatten viel Vergnügen miteinander, denn die beiden ergötzten sich an der Absicht, gemeinsam eine Pelztierfarm zu betreiben, was uns zu recht amüsanten Vorstellungen brachte. Beim Abschied gaben wir uns das Versprechen, uns bald wiederzusehen.
Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass ich unbedingt zu meiner Schwester Gisela nach Berlin musste, um mit ihr über grundsätzliche Erbschaftsfragen zu sprechen. Ausgestattet mit einem Interzonenpass und Klein-Sigrun an der Hand, machten wir uns beide für drei Wochen auf die große Reise nach Berlin, wo wir bei der guten Familie CL. wohnen konnten, denen wir unseren Aufenthalt wiederum mit Lebensmitteln honorierten. Gerne wäre ich mit Sigrun nach Dessau zu den Schwieger- bzw. Großeltern gefahren. Da die Lage in Berlin aber recht angespannt war, erschien es nicht ratsam, jetzt den Russen in die Hände zu fallen.
Sigrun war höchst entzückt von Berlin, denn sie hatte noch nie eine so große Stadt gesehen. Die S-Bahn begeisterte sie und völlig fasziniert war sie von den vielen „Königsschlössern“, womit sie die großen Mietshäuser meinte, weil die so viele Fenster hatten, wie sie sie nur von Königsschlössern aus Bilderbüchern kannte. Alles in allem war diese große Reise für sie ein Erlebnis ganz besonderer Art, während sie für mich, was meine Schwester betraf, zu einer großen Enttäuschung wurde.
Gisela hatte sich – im Glauben, ich würde es nicht mehr beanspruchen können – nicht nur an meinem Erbe, sondern auch an meinem persönlichen Besitz vergriffen und war nicht bereit, es wieder heraus zu geben. Was folgte, war ein ellenlanger Briefwechsel, in dem alle Beteiligten versuchten, sie zur Herausgabe zu bewegen, was aber nie geschah. Enttäuscht über diese Veränderung, die nach dem Krieg mit meiner Schwester vor sich gegangen war, beendeten wir den Kontakt zueinander. Das wäre wahrscheinlich nie so weit gekommen, hätten sich nicht unsere Männer in die Angelegenheit eingemischt, denn die letzten Briefe wurden nur noch zwischen ihnen ausgetauscht. Danach haben wir uns nie mehr wieder gesehen.
Nach unserer Rückkehr aus Berlin musste ich die Fehltage wieder aufarbeiten, denn ein Teil unserer Entlohnung bestand aus einem Schwein, das geschlachtet wurde. Darauf waren wir dringend angewiesen. Deshalb musste ich doppelt soviel arbeiten. Sogar die Kinder halfen mit. Sie jäteten Unkraut, legten Erbsen, steckten Zwiebeln und stellten sich dabei recht geschickt an. Am liebsten gingen sie mit mir in den Wald, um Bickbeeren zu pflücken, die sie sich zumeist aber ins Mäulchen steckten und bald nicht nur blaue Finger, sondern auch blaue Münder bekamen. Auch Waldhimbeeren, Brombeeren und Schlehen ernteten sie mit. Dadurch entwickelten sie sich zu richtigen kleinen Waldläufern, denen Weg und Steg und vielerlei Getier auf diese Art bekannt wurde.
Kurz vor meiner Reise hatte Hans auf eine Annonce in der Zeitung geantwortet. Eine Bausparkasse, die ungenannt blieb, suchte Mitarbeiter. Da er sich im Bank- und Bauwesen auskannte, sah er darin seine große Chance, sich beruflich wieder etablieren zu können, denn es gab unzählige zerstörte Häuser, die wieder aufgebaut werden mussten und überall gab es Wohnungsnot. Demzufolge pokerte er bei der Bewerbung. Er wusste es nicht, aber er vermutete, dass die Annonce von der Bausparkasse Wüstenrot aufgegeben war. Deshalb fasste er seine Bewerbung entsprechend ab, indem er schrieb, dass sein Interesse an der beschriebenen Tätigkeit nur dann bestünde, wenn es sich um diese Bausparkasse, der er noch einige lobende Worte hinzufügte, handeln würde. Er war sich darüber klar, dass er natürlich keine Antwort erhielte, sofern es sich nicht tatsächlich um Wüstenrot handelte.
Während meiner Abwesenheit ging alles sehr schnell. Hans traf sich mit einem zuständigen Herrn dieser Bausparkasse, der ihm erklärte, worum es ging. Da ihm bis dato nichts Entsprechendes angeboten worden war, griff Hans zu und arbeitete bereits ab dem 1. Juni 1948 als selbständiger Mitarbeiter für die Bausparkasse Wüstenrot, die ihren Sitz in Ludwigsburg hatte. Zunächst waren wir recht froh darüber und hofften, dass er durch diesen Beginn eines Tages wieder eine Beschäftigung finden würde, die seiner Ausbildung entsprach. So einfach, wie wir uns das vorgestellt hatten, war es dann jedoch nicht.
Sein Bezirk war groß, deshalb benötigte er mein Fahrrad, an dem aber noch die Reifen fehlten; die Muttern besaßen wir inzwischen. Wir hätten die Reifen vielleicht sogar bezahlen können, aber kurz vor der Währungsreform nahm kaum noch jemand Geld an. Der Schwarzmarkt blühte. Die Preise stiegen ins Unermessliche. Für ein Pfund Butter zahlte man 250 Mark, ein Pfund Zucker kostete 85 Mark und für einen Liter Öl musste man sogar 300 Mark hinlegen. Wir hätten die Reifen zwar in Zigarettenwährung, das war eines der beliebtesten Zahlungsmittel jener Zeit, oder auch in Speckwährung zahlen können, aber wir besaßen weder Zigaretten, noch Speck. Allerdings hatte ich aus Berlin zwei Küchenwaagen mitgebracht, die hier bei uns Mangelware waren. Die tauschten wir zunächst in Speck um und den Speck anschließend in Reifen. Schließlich bekam Hans ein fahrtüchtiges Rad, mit dem er an manchen Tagen bis zu 100 Kilometer weit fahren musste.
Zur Mangelware gehörte auch Papier. Hans benötigte jedoch Schreibmaschinenpapier. Um 1000 Blatt davon zu bekommen, hätte er in Lüneburg 40 Kilogramm Altpapier abliefern müssen, – aber es gab nichts. Hinzu kam, dass er keinen Lohn mehr von Bertha bekam und deshalb auch unser Schweinchen entsprechend „verkleinert“ wurde.
All das machte den Anfang sehr schwer. Hans hatte zwar gute Ideen und tätigte dadurch viele Abschlüsse für die Bausparkasse, die auch gut honoriert wurden. Jedoch erfolgte die Verrechnung der Honorare erst nach Eingang der Abschlussgebühren, – und das in vierteljährlichem Turnus, so dass wir nun täglich von der Hand in den Mund leben mussten, ohne zu wissen, ob wir am nächsten Tag noch etwas zu essen haben würden.
Der Kontakt zu Familie CL. in Berlin war deshalb kaum noch aufrecht zu erhalten. Wir konnten das Geld für das Porto mitunter nicht erübrigen. Es ging uns nicht gut. Berlin hingegen wurde über die Luftbrücke versorgt und leistete erheblichen Widerstand gegen die Versuche der Russen, Westberlin zu isolieren, indem sie zum Beispiel die Gas- und Stromversorgung der Westsektoren drastisch einschränkten. Durch die Berlin-Blockade sollten die Westmächte gezwungen werden, auf die geplante Gründung eines Weststaates zu verzichten.
Otto CL. schrieb uns davon und bestätigte dadurch all das, was wir übers Radio oder die Zeitungen mitgeteilt bekamen. Über Lebensmittelkarten erhielten sie fast alles, was sie zum Überleben benötigten. Allerdings wünschten sie sich Kartoffeln, die wir ihm auch gern geschickt hätten, aber wir hatten selber nicht genug zu essen. Der Winter rückte näher und wir hatten große Sorgen, wie wir die Kohlen für die kalte Jahreszeit bezahlen sollten.
Da ich wieder schwanger war und außerdem eine sehr schmerzhafte Schleimbeutelentzündung unter dem Arm hatte, die schließlich operiert werden musste, war ich keine große Hilfe für unseren Haushalt. Es sah sehr düster aus, obwohl die Schwarzmarktpreise nach der Währungsreform 1948 schlagartig in den Keller gefallen waren.
Plötzlich trugen nämlich die Obstbäume wieder Kirschen, Äpfel und Pflaumen, auch die Hühner legten wieder Eier, die Schlachthäuser füllten sich mit Vieh und es gab alles, was man hätte kaufen wollen. Sämtliche Dinge, die zuvor gehortet worden waren, wurden wieder angeboten. Dieses Wunder hatte die Währungsreform im Westen bewirkt.
Alle begannen mit der gleichen Menge an Geld: Wer vorher keines mehr besaß, bekam jetzt etwas und wer vorher viel besaß, hatte nun genau so viel, wie alle anderen auch. Wer sich jedoch zu den Landbesitzern zählen konnte, der besaß mehr als die anderen und hatte dadurch auch mehr Möglichkeiten. Unser Eigentum in Schönebeck war für uns unerreichbar geworden, wir hatten nichts mehr.
Zu allem Unglück war mein Fahrrad für die weiten Fahrten von Hans nicht geeignet und ging irreparabel kaputt, so dass Hans fast alle Termine absagen musste. Nur einen konnte er Anfang Dezember vorläufig noch wahrnehmen, weil dieser Interessent zu uns nach Hause kam. Das sollte der Auftakt zu einer länger anhaltenden Serie von Aufträgen werden, die uns tatsächlich über den Berg brachten, so dass auch Familie CL. ihre ersehnten Kartoffeln – und manch’ anderes – von uns bekam.
Das Weihnachtsfest 1948 verbrachten wir sehr gemütlich. Der Weihnachtsmann konnte Sigrun und Heidi gut und reich bedenken. Unter dem hübschen Baum war alles aufgebaut: Schuhe, Strümpfe, Unterwäsche und Strickjacken. Dazu gab es Spielsachen vom Berliner Weihnachtsmann, den Tante und Onkel CL. bestellt hatten. Beide Kinder konnten das für sie lange Weihnachtsgedicht „Knecht Ruprecht“ aufsagen und Heidi – unser kleiner neugieriger Naseweis – entdeckte schließlich noch unter dem Tisch, der mit einem Tuch verhängt war, das Allerschönste: Für jedes Kind gab es einen Hocker und – o Seligkeit – eine Puppe, vollständig angekleidet. In der Aufregung haben sie gar nicht gemerkt, dass Heidis Püppchen die alte, seit zwei Jahren verschwundene Erika war. Den Kopf und die Schuhe haben sie wieder erkannt, aber mehr nicht.
Das neue Jahr begann mit einer ganz neuen Hoffnung, da sich überall ein gewisser Aufwärtsschwung bemerkbar machte. Die Menschen waren nicht mehr so verzagt. Es war uns sogar gelungen, unsere winzige Wohnung etwas aufzupäppeln, so dass wir wieder ein Gefühl von „Zuhause“ empfanden. Allerdings begann für uns das neue Jahr auch mit einem Stickhusten bei beiden Kindern, der zum Teil recht heftig, trotz der verabreichten Spritzen, auftrat und erst Anfang März 1949 langsam wieder besser wurde.
In diesem Monat erhielten wir endlich eine Antwort von Hans’ Mutter aus Dessau, der wir im Januar ein Paket zu ihrem 75. Geburtstag geschickt hatten, nachdem wir vorher schon lange nichts mehr von ihr gehört hatten. Sie schrieb ausführlich von der Geburtstagsfeier, nicht aber von ihrem sonstigen Befinden. Wir konnten ihrem Brief aber deutlich entnehmen, dass sie sehr unglücklich über die Trennung der Familie war, da nun beide Söhne im Westen lebten. Es war ein Trost für sie, dass wenigstens Käthe, ihre einzige Tochter, mit Mann und Kindern in der Nähe geblieben war und die sich, dem Brief nach, um Vater und Mutter kümmerte. Da Hans ihr von meiner Schwangerschaft geschrieben hatte, fragte sie ihn vorwurfsvoll, ob das ‚nötig gewesen wäre‘ und ‚drei Kinder seien doch wohl genug, was wohl sicher auch die Meinung seiner Frau sei‘, womit sie sicher Recht hatte. Es war der vorletzte Brief von ihr. Einmal schrieb sie noch im Januar 1950, danach hörten wir über vier Jahre nichts mehr von Hans’ Eltern, worüber wir sehr in Sorge waren.