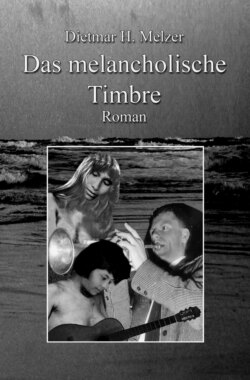Читать книгу Das melancholische Timbre - Dietmar H. Melzer - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII Negermusik
Dieses ewige Rollen auf Eisen hatte mich irgendwann einschlafen lassen. Doch immer, wenn die Räder über Weichen polterten, schreckte ich aus wirren Träumen auf, ohne wirklich zu mir zu kommen. Ich hatte viel getrunken, und die beklemmende Lähmung meiner Empfindungen machten die Nacht und die Geräusche des fahrenden Zuges quälend, wenn sich ihre Monotonie änderte. Ich erwachte, als der Ton der rollenden Räder hohl klang und ihr rhythmisches Pochen verlangsamten. Fabriken und Lagerhallen ließen unerträglichen Lärm daraus werden. Ich schloss das Fenster und merkte endlich, wie eisig die Luft im Abteil war. Mein Herz klopfte, im Mund spürte ich eklig Süßsäuerliches und im Kopf ein beharrliches Ziehen. Wie war ich nur zum Bahnhof gekommen? Ich suchte die Zigaretten. Nach dem ersten Zug meinte ich, brechen zu müssen. Vielleicht würde kaltes Wasser helfen und ich hatte noch genug Zeit. Also drückte ich die Zigarette aus, konnte den stinkenden Rauch aus dem Aschenbecher aber nicht aufhalten. Die Abteilungstür quietschte, als ich sie aufschob. Ich stützte mich mit den Händen an den Wänden des schwankenden Ganges ab. Zum Glück war die Toilette frei.
Ich ließ alles aus meinem Körper in diesen schmutzigen Trichter sprudeln und in das Dröhnen da unten verdampfen. Das würde vom Schnaps und von den Bieren befreien. Und das kalte Wasser tat gut im Gesicht. Ein müdes, verkatertes Gesicht sah ich im Spiegel, und ein blödes Grinsen. Den drängenden Wunsch, dieses Wasser auch zu trinken, musste ich wohl unterdrücken. Durstig begab ich mich in das Abteil zurück und öffnete wieder das Fenster. Die Schienen hatten sich vermehrt und blinkten kalt in den vorbeifliegenden Lichtern. Eine Lokomotive schob dampfend Güterwagen vor sich her.
Der Zug würde in einen Kopfbahnhof einlaufen. Ich hatte genügend Zeit zum Aussteigen. Trotzdem zog ich schon meinen Mantel an, ein etwas abgewetztes Stück aus blauem Popelin, und wuchtete meinen Koffer und meine Tasche aus dem Gepäcknetz. Vor meinem Abteil schoben sich andere Passagiere mit ihrem Gepäck vor-bei. Sie hatten es noch eiliger als ich. Dabei war es völlig egal, ob ich um 21.13 Uhr aus dem Zug stieg oder eine Stunde später. Trotzdem drängte ich mich aus dem Abteil in die Menschenschlange, stieß mit dem Koffer gegen Körper, stellte die Tasche auf einen fremden Fuß. Entschuldigung. Entschuldigung. Lichter fluteten herein. Als der Zug mit einem Ruck anhielt, musste ich mich an einem Arm festhalten. Entschuldigung. Die Schlange setzte sich in Bewegung und stieß mich Schritt für Schritt auf den Bahnsteig in eine Menschentraube hinein. Stuttgart Hauptbahnhof, brüllte es aus Lautsprechern. Die nächsten Anschlüsse. Eilzug nach Mannheim über Ludwigsburg, Heilbronn, Heidelberg um 21.40 Uhr auf Gleis 14; Fernschnellzug nach Hamburg Altona über Würzburg, Kassel, Göttingen, Hannover um 22.10 Uhr auf Gleis 9; Personenzug nach Karlsruhe… Die Dampflokomotive am gegenüberliegenden Bahnsteig hüllte alles in graublauen, nach heißem Wasser und Kohle riechenden Dunst. Die Bundesbahn wollte bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts das Rauchen aufgeben, hatte ich in einer Anzeige gelesen. Der Beruf des Heizers fiele weg. Auf Hauptstrecken sollten nur noch elektrische Lokomotiven die Züge ziehen, auf den anderen leicht zu bedienende Dieselmaschinen. Aber die stanken und rußten ja auch. Elektrisch wäre alles besser. Ich hörte das schnarrende Signal des Gepäcktransporters und wich mit anderen Leuten zur Seite. Der Transporter surrte mit seinen Wagen voller Gepäckstücke vorbei. Elektrische Motoren waren ideal. Sie stanken nicht und machten keinen Lärm. Das Hin- und Hereilen mit Raunen und Plappern um mich herum ließ mich kribbelig werden. Ich rempelte eine kleine Person an. Entschuldigung. Eine alte Frau. Ich sah zuerst nur ein geblümtes Kopftuch von ihr. Ich muss auf den Zug nach Hamburg! Dann gehen Sie auf den Bahnsteig neun. Ja, ja. Aber ich sehe nicht mehr so richtig. Die Frau hatte in jeder Hand einen Koffer. Wie sollte ich ihr Gepäck mit dem meinen dazu auf ihren Bahnsteig schleppen? Meine Koffer können Sie mich ruhig tragen lassen, junger Mann. Ich meinte, Spott in ihrer Stimme zu hören. Führen Sie mich nur bis zu meinem Zug, bitte. Das war nicht weit. Und ich hatte ja Zeit. Ein weiß gekleideter Mann mit einem Bauchladen drängelte sich vorbei. Leibnitz Keks, Tabak, Zigaretten, schrie er. Dann stand ich ziemlich verwirrt an der Treppe zum Arnulf-Klett-Platz hinunter. Die alte Frau hatte mich zum Abschied geküsst, aus Dankbarkeit vielleicht, hatte meinen Kopf zu sich hinabgezogen, hatte ihre Zungenspitze flüchtig in meinen Mund gleiten lassen, und ich hatte gemerkt, dass sie nicht so alt war. Meine Kopfschmerzen fielen mir jetzt wieder ein. An der Sperre hatte mir ein mürrischer Beamter meine Fahrkarte abgenommen. Ich versuchte, mit festen Schritten die Stufen zu den Straßenbahnen hinunter zu kommen. Mein vorher trockener Mund fühlte sich nun aber weich und fließend an. Die Zungenspitze einer alten Frau mit einem Kopftuch, die gar nicht so alt war… Sie haben zu viel Alkohol getrunken, junger Mann, und – geben Sie das Rauchen auf!
Draußen nieselte dünner Regen herab. Den lärmenden Verkehr von Autos und Straßenbahnen, die eilenden Menschen, die vielen Lichter und grellen Neonreklamen, die sich in den nassen Straßen spiegelten, war ich nicht gewohnt. Ich wusste nicht, wohin ich sollte. Unschlüssig trottete ich an den Sandsteinmauern des Bahnhofsgebäudes entlang bis ich auf eine breite Straße mit noch mehr Verkehr stieß, die aus der Stadt hinaus zu führen schien. Der Koffer und die Tasche wurden mir schwer, und in den Nacken rieselte kaltes Nass. Ich kehrte um. Ein Polizist stand an den Stufen zu den Bahnsteigen hinauf. Wie komme ich in die Rötestraße, bitte schön? Fahren Sie mit der Einser oder mit der Sechser bis zur Station Schwabstraße. Dann die nächste Straße rechts. Vielen Dank, Herr Wachtmeister. Der Polizist wies mit seinem Gesicht auf eine Fußgängerampel, die gerade Grün anzeigte. Ich ging über den Zebrastreifen auf die Haltestelle der Straßenbahn zu. Weiter auf der anderen Seite sah ich die leuchtende Reklame eines preiswerten Schnellrestaurants. Da merkte ich, dass ich hungrig war. Wohl hatte ich etwas gegessen, Würstchen mit Kartoffelsalat, bevor wir meinen Abschied in den Nachmittag hinein begossen hatten, doch meinte ich beim Anblick des strahlenden Glasbildes, auf dem ein saftiges Kotelett und goldene Bratkartoffeln mit knusprig braun gerösteten Rändern zu sehen waren, wochenlang nicht mehr richtig gefuttert zu haben. Ich überquerte die Straßenbahnschienen und die andere Fahrbahn. „Nur drei Mark fünfundneunzig“ war auf dem Bild zu lesen. Es war preiswert, auch wenn noch zehn Prozent Bedienung hinzukämen. Ich trank zwei Biere dazu. Königliches Hofbräu nannte sich der Gerstensaft mit einer verschnörkelten Krone auf den Gläsern. Der Geschmack des vergangenen Königs war Garant für die Bekömmlichkeit des Bieres. Der hatte ja so viel davon trinken und dazu essen können wie er wollte, hatte er doch seinen Wohlstand bei den Bauern eingetrieben, gleich, ob die danach noch etwas zu trinken und etwas zu knabbern hatten. Eigentlich konnte ich mir das Kotelett und die beiden Biere nicht leisten. Fünf Mark fünfundvierzig zusammen. Die Franzosen hatten ihren König nach ihrer großen Revolution geköpft. Deutsche machten so etwas nicht, unschuldige Könige köpfen. Die ließen nur russische Kriegsgefangene verhungern und verbrannten jüdische Nachbarn, die am Elend dieser Welt schuldig waren. Unser demokratisch gewählter Ministerpräsident verbeugte sich artig vor den Nachfahren des abgesetzten württembergischen Königs, wegen derer unschätzbaren Verdienste für das Land, unschätzbaren Verdienste durch das Land. Sie residierten in schönen Schlössern und das Familienoberhaupt, von Gottes Gnaden, ließ sich noch immer mit Eure Majestät anreden. Auch von unserem Ministerpräsidenten, der ein aufrechter Patriot war, hatte er doch bis zum letzten Tag des Krieges versprengte Soldaten als feige Deserteure hinrichten lassen. Ich hatte ihn einmal in einem Dreihunderter Mercedes auf dem Romäusring gesehen, als er von einer kurzen Visite im Rathaus unter Beifall des Volkes zu einem fetten Bankett ins Donaueschinger Schloss unterwegs war.
Indes war ich von dem Kotelett und der Portion Bratkartoffeln nicht satt. Sechs Mark mit Bedienung. Nachdem der Kellner abgerechnet hatte, besaß ich noch Zweiundfünfzig Mark und fünfundvierzig Pfennig. Das würde mir nicht bis zum Monatsende reichen. Ich hätte doch etwas Geld von meiner Mutter borgen sollen. Als ich aufstand, konnte ich einen Blick auf den Fernseher werfen, der hinter mir die ganze Zeit gequäkt hatte. Unser Bundeskanzler war zurückgetreten, scheinbar auf Drängen des Koalitionspartners. Ich verharrte einen Augenblick und sah Bilder eines alten Mannes, in einem Zug nach Moskau, um deutsche Kriegsgefangene zu befreien, und dann neben einem jugendlichen, amerikanischen Präsidenten, der in eine jubelnde Menge rief: „Ich bin ein Berliner!“ Einem Kanzler, der vorher von den Nazis verhaftet und in ein Konzentrationslager verschleppt worden war, hätte man noch länger vertrauen sollen.
Draußen schlug ich fröstelnd den Mantelkragen hoch und tappte, von den Bieren wieder betrunken, auf die Haltestelle zu. Der Einser oder der Sechser. Ich hielt dem Schaffner einen Fünfmarkschein hin, der mir gerade in die Hand kam. Haben Sie es nicht kleiner? Ich hob die Schultern. Die Königstraße war in ein Meer aus bunten Reklamelichtern getaucht. Unzählige Passanten waren im Nieselregen unterwegs. Immer wieder überquerten sie sorglos die Fahrbahn, trotz hupender Autos und dem Geklingel der Straßenbahn. Eine pulsierende, schwäbische Metropole. Es fiel kaum auf, dass die Läden hinter den leuchtenden Neonröhren vielfach nur einstöckige Provisorien waren, manchmal nicht viel mehr als eine Baracke. Immerhin fuhr die Straßenbahn an vielen Baustellen vorbei. Es würde aber Jahrzehnte dauern, bis die Stadt nach den Bombenangriffen wieder aufgebaut war. Und ob das einen Sinn hatte? Ich war vor vierzehn Tagen als Gefreiter aus dem Wehrdienst entlassen worden. Die Bundeswehr sollte abschrecken, einen weiteren Krieg verhindern. Nun hätte man Stuttgart mit einer einzigen Bombe zerstören können, und zwar so gründlich, dass niemand mehr eine Straße fand, um dort provisorische Läden zu errichten.
Der Schaffner rief die Haltestelle Schwabstraße aus. Ich griff nach meinem Gepäck und stolperte in die Dunkelheit. Von funkelnder Reklame war hier nichts mehr zu sehen. Meine Augen gewöhnten sich aber bald an das diffuse Licht der städtischen Straßenbeleuchtung. Mein Ziel lag in der nächsten Straße rechts. Eine schmale Straße. Sie schien mir noch dunkler zu sein. Selbst das Licht aus einer Kneipe war abweisend. Junge Leute traten heraus. Offenbar betrunken. Sie schwatzten laut durcheinander, kicherten und johlten, Männer und Frauen. Eine trat mir in den Weg. Schaut euch diesen Frosch hier an. Der kommt von einer großen Reise. Sie lachte gurrend. Im Licht der Kneipe wirkten ihr Gesicht und ihre glatten, langen Haare gleichmäßig elfenbeinfarbig. Der grellrot geschminkte Mund, aus dem das Gurren kam, sprang einen regelrecht an. Mir war kalt in meinem nassen Mantel, und ich wunderte mich, dass das Mädchen vor mir nicht fror in ihrem schulterfreien Fetzen. Auch ihren Freunden in recht sommerlichem Aufzug schien das kalte Oktoberrieseln nichts auszumachen.
„Ich möchte zu Frau Neumeier“, sagte ich. „Im Dunkeln kann man die Hausnummern nicht sehen.“
„Die fesche Olga? Sie vermietet Zimmer, gell?“
Ihre Lippen bewegten sich durch den Alkohol schwerfällig, wenn sie sprach. Aber das anschließende Gurren konnte einen anmachen, auch wenn man müde war. Theatralisch drehte sich die junge Frau um und zeigte, dass an ihren Körperformen an keiner Seite etwas auszusetzen war. Sie würde wohl überall unter der Wäsche elfenbeinfarbig sein.
„Geh auf dieser Seite einfach weiter. Da kommt dann ein Haus mit einem größeren Tor. Da musst du rein.“
Sie drehte sich wieder zu mir.
„Wenn du bei Olga wohnst, werden wir uns wieder mal über den Weg laufen.“ In ihren Haaren und auf ihren nackten Schultern begann das Nieseln zu glänzen. Ihr musste doch kalt sein.
„Wie heißt du denn?“
„Nina, und du?“
Ich nannte meinen Namen. Was sie an dieser trüben Tasse denn finde, rumorte der Protest unter ihren Freunden. Wenn sie nicht gleich losfuhren, wäre der Jazz mangels Publikum zu Ende. Die Funzel da verstünde sowieso nichts davon. Ich hörte das Wort Jazz, nicht „Dschäss“ gesprochen, sondern „Jatss“, wie bei schwäbischen Musikern üblich, um nicht mit englisch radebrechenden Klugscheißern in einen Topf geworfen zu werden. Auf einmal war ich wach.
„Wo ist denn der Jatss?“
„Ich nehme dich das nächste Mal mit.“
Am Straßenrand liefen längst die Motoren von zwei Wagen, einem alten Opel Kapitän mit dem schrägen Rücken und einer immer noch elegant wirkenden Isabella. Diese Nina stieg in den Opel mit ein, und die beiden Wagen fuhren die Straße hinauf davon. Mich packte die Müdigkeit wieder. Erst jetzt merkte ich, dass ich mein Gepäck abgestellt hatte. Ich griff danach und schleppte mich und meinen Besitz in die angegebene Richtung, an Mauern entlang, die durch Licht aus den Fenstern alle dunkel zu sein schienen. Aus einem Fenster drang laute Radiomusik. In Hamburg sind die Nächte lang… An dem Tor konnte ich keine Namensschilder finden. Also drückte ich die schwere Klinke herunter und schob das Tor auf. Ein finsterer Gang befand sich dahinter. Etwas glimmte an einer Seite. Ein Lichtschalter. Der Gang führte in einen Hof, der durch meinen Druck auf den Schalter in elektrisches Licht getaucht wurde. Auf der einen Seite standen zwei Fahrräder und ein paar Mülleimer. Auf der anderen Seite sah ich einen Sandhaufen und einen Berg von Kieselsteinen. Sonnenlicht fiele sicher nie in diesen Hof. Am anderen Ende befand sich eine Haustür. Sie musste ganz neu sein. Dickes Glas in einem soliden Holzrahmen. Hier fand ich auch die Namensschilder. Gedruckt und ordentlich aufgereiht hinter Metall und Plexiglas und beleuchtet. Ich tippte auf den Knopf hinter Neumeier. Es dauerte eine Weile bis sich ein Fenster oben öffnete. Wer ist da?
Eine krächzende Frauenstimme. Die hörte sich zunächst nicht sympathisch an. Ich rief hinauf, wer ich war und wies auf Briefe hin, die gewechselt worden waren, wegen eines Zimmers…
„Und da kommen Sie mitten in der Nacht!“
„Ich konnte vorher keinen Zug nehmen, und dann habe ich noch Hunger gehabt, am Bahnhof…“
„Ja, ja, kommen Sie herauf! In den vierten Stock!“
Der Türöffner summte. Ich trat in einen braun gefliesten Flur, an jeder Seite eine Wohnungstür, an der Treppe zu den oberen Stockwerken stapelten sich Kartons mit Keramikfliesen und staubige Papiersäcke, die wohl Zement oder so was enthielten. Vier Stockwerke mache ich sonst im Dauerlauf, auch mit Gepäck, aber die Etagen waren hier höher als im sozialen Wohnungsbau, und ich war so müde. Atemlos kam ich oben an. In einer offenen Glastür erwartete mich eine Frau in einem blassblau verblichenen Mor-genmantel mit blassrot verblichenen Blüten bedruckt. Ihr kastanienfarbenes Haar, vielleicht auch schon graue Strähnen darin, war zu einem Knoten gebunden, was dem schmalen, faltigen Gesicht mit den dünnen Lippen trotz der schlampigen Kleidung ein strenges Aussehen gab. Ob das die fesche Olga war?
„Sie sind also der Herr Kalisch.“ In ihrem Blick meinte ich, Herablassung zu spüren. „In bester Kondition sind Sie ja nicht gerade.“ Sie öffnete den Mund zu einem breiten Lachen und zeigte überraschend schöne Zähne dabei. Bei Frauen, die Nächte in Luftschutzkellern verbracht hatten, konnte man nie schätzen, wie alt sie waren. Eine Dreißigjährige sah möglicherweise wie eine Sechzigjährige aus. „Wohl gesoffen unterwegs.“ Sie winkte mich herein. „Ich bin Frau Olga Neumeier.“
Ich betrat honigfarbenen Parkettboten eines geräumigen Korridors mit bläulichgrau gesprenkelter Tapete an den Wänden und weiß gestrichenen Türrahmen. Die Türen waren alle verschlossen. Sie öffnete eine und wies hinein. „Die Küche, die alle Untermieter auf diesem Stock benutzen.“ Die Stimme etwas gedämpft. „Sie schlafen schon alle.“ Eine andere Tür wurde von ihr geöffnet, die Toilette, und eine weitere. „Das Bad für die Untermieter. Sie müssen sich abstimmen.“
„Könnte ich heute Abend noch baden?“
„Sie meinen heute Nacht. Das wird die anderen stören. Mit kaltem Wasser, wenn Sie wollen. Sonst müssen Sie den Badeofen anheizen, also vorher Holz und Kohlen herauftragen. Das geht um diese Zeit nicht. Für warmes Badewasser berechne ich einen Zuschlag von einer Mark auf die Miete. Wenn Sie mir sagen, wie oft Sie warm baden wollen, können wir es pauschal regeln.“ Sie deutete auf eine Tür mit einem Knauf anstatt der Klinke, wie bei allen anderen Türen: „Meine Wohnung. Sonst wohnen auf dieser Etage Frau Grabowsky, Herr Bovensipen, der ist aber meist auf Montage, und das Fräulein Schormann, aus Thüringen, hat sie mal erzählt, und Herr Becker, schon seit fünfundvierzig, nachdem wir das gröbste aufgeräumt hatten…“ Sie öffnete eine weitere Tür. „Ihr Zimmer.“ Sie knipste den Lichtschalter an. Ich blickte auf Wände mit heller Blümchentapete, auf dunkel gebeizten Holzfußboden,auf grell geblümte Gardinen und ein Fenster, das wohl auf den Hof hinausging. Darunter standen ein dunkelbrauner Holztisch ohne Tischdecke und zwei dunkelbraune Stühle mit geflochtenen Sitzen, an der linken Wand befand sich ein solide aussehendes Bett, ebenfalls dunkelbraun, mit schneeweißer Bettwäsche, Kopfkissen und das Federbett ordentlich aufgetürmt mit einem Knick, eine Kieferkommode daneben, gegenüber stand ein jugendstilartig verzierter Kleiderschrank, auch dunkelbraun, im rechten Eck sah ich einen gusseisernen Kohleofen. „Sechzig Mark im Monat, wie ich Ihnen bereits geschrieben habe. Etwas Preiswerteres werden Sie in Stuttgart nicht finden. Die Kohle berechne ich Ihnen extra. Manche frieren leicht, andere nicht…“
„In Ordnung.“
„Für die vierzehn Tage Oktober bekomme ich von Ihnen jetzt dreißig Mark.“
„Könnte ich Ihnen das Geld am Ende des Monats geben?“
„Miete ist immer im Voraus fällig.“
„Ausnahmsweise… Ich meine, es würde mir helfen in der fremden Stadt… Wenn ich Ihnen am Ende des Monats… Und dann auch gleich die Miete für den November…“
Sie betrachtete mich von oben bis unten, meine nassen Haare, den nicht ganz neuen Mantel, die von Eisenbahn und Regen verbeulte graue Hose ohne Bügelfalte, meine feuchten Schuhe, die Schmutz auf dem schönen Parkettboden hinterlassen hatten. Ihr Blick blieb durchdringend auf meinem Gesicht haften, zu dieser Stunde war ich nicht frisch rasiert… „Wie ein Betrüger sehen Sie nicht aus“, murmelte sie, „und Ihr Brief und Ihre Schrift waren ordentlich. Wenn Sie bei Pfleiderer anfangen, sparen Sie das Fahrgeld, Sie kommen zu Fuß von hier aus in die Fabrik. Wissen Sie, ich brauche dringend die Einnahmen aus der Miete, es hat viel Geld gekostet, alles wieder instand zu setzen und dann zu modernisieren, alles nur mit Schulden, und die Bank…“ Sie schwieg eine Weile. „Bezahlen Sie mir die Miete also am 31. Oktober“, sagte sie wieder etwas lauter.
„Danke. Das hilft mir sehr.“
„Ach ja, bevor ich es vergesse. Sie schrieben von einem Musikin-strument, das sie spielen und jeden Tag üben wollten. Mein Mann ist Posaunist gewesen in der Kräherwaldgarde. An einem Sonntag haben sie sogar im Schlossgarten gespielt. Deswegen. Man hat eigentlich immer Ärger… Also… Sie dürfen nie länger als eine Stunde üben und nie vor neun Uhr morgens und nie nach acht Uhr abends.“
Danke, danke, schaute ich sie an, danke. Sie hatte gar keine unsympathische Stimme. Und sie hatte braune Augen. Ich erwartete nun, dass sie noch etwas über Damenbesuche sagen würde, sie wären nicht erlaubt oder nach zweiundzwanzig Uhr nicht mehr erlaubt. Aber sie wandte sich um. „Schlafen Sie gut. Ich klopfe bei Ihnen morgen etwas später, um neun, und bringe den Kaffee. Das Frühstück ist im Mietpreis enthalten. Zwei Tassen Kaffee, Butter und zwei Marmeladenbrötchen.“
Danke, danke…
Ich war allein. Blümchen an den Wänden. Aber recht geräumig. Ich stellte die Tasche auf den Tisch. Der Koffer mit der Trompete war darin. Und mein Waschzeug. Die Klamotten würde ich morgen einräumen. Ich zog mich bis auf die Unterhosen aus und schlich in das Bad. Zähne putzen. Das Wasser im Badeofen war vielleicht überschlagen. Ich kauerte mich in die Wanne und hielt die Brause über meinen Kopf. Das Wasser war noch kälter als der Regen, den ich unterwegs abgekommen hatte. Aber ich wusch mich, klemmte den Duschkopf zwischen die Knie, da war ein Stück Seife, wusch meine Haare, mein Gesicht, meine Arme, die Achseln darunter, stand auf, wusch meinen Hintern, meine Beine, spülte Biere und Schnäpse aus der Haut, die Reste von Urin zwischen den Beinen davon, ein blaues Frotteehandtuch hing an einem Haken.
Mit der schmutzigen Unterhose in einer Hand tippelte ich in mein Zimmer zurück. Durch das kalte Wasser und das Rubbeln mit dem Handtuch war mir so heiß geworden, dass ich erwog, mich nackt in das Federbett zu legen. Aber ohne den heizenden Ofen würde ich mich bald unter der bauschigen Zudecke verkriechen müssen und dann nicht mehr genug Luft zum Atmen bekommen. Also öffnete ich auch den Koffer und wühlte einen Schlafanzug heraus. Wäh-rend ich ihn anzog, nahm ich mir vor, Frau Neumeier nach einer Wäscherei zu fragen, oder wie das geregelt sei, ob sie vielleicht, und zu welchem Preis. Ein Radio hätte ich jetzt gerne gehabt, hätte gerne Musik im AFN gehört. Der amerikanische Soldatensender hatte inzwischen mehr deutsche als amerikanische Zuhörer, weil man hier Elvis Presley, Brenda Lee und Fats Domino hören konnte und nicht, wie im Südwestfunk bei Horst Use, dauernd das Lied, Drüben in der Heimat, da blüht ein Rosengarten. Die Jazz-Sendung mit Joachim Ernst Berendt kam samstags nur alle vierzehn Tage, und dann mitten in der Nacht, wenn man irgendwo unterwegs war. Ich müsste mir als erstes ein Radio kaufen. Ein Kofferradio? Das hatte einen schlechten Klang. Vielleicht konnte ich preiswert ein gebrauchtes Grundig Gerät mit Stereoklang auftreiben und einen Plattenspieler dazu. Meine Jazzplatten hatte ich alle dabei, Roy Eldridge. Eddie Condon, Miles Davis… Aufnahmen, die man in Deutschland nur unter der Hand von Freunden bekam. In Schallplattengeschäften war diese Art von Negermusik nicht zu haben. Die wollten als Jazz einem die Papa Bues Viking Jazzband verkaufen mit Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, was wir gerne mitsangen, am Sonntag will mein Süßer mit mir vögeln gehen… Immerhin hatte ich in unserem Musikgeschäft auch mal zwei gute Jazzplatten bekommen, Benny Goodmans Konzert von 1938 in der Carnegie Hall und ein Konzert mit Louis Armstrong und Jack Teagarden in der Boston-Symphony-Hall. Meine Schallplatten hatten im Koffer gerade noch hineingepasst zwischen Wäsche, Anzug und den beiden Hemden. Ich hatte auch zwei Bücher mitgenommen. Hermann Hesse, der soll früher nackt am Ufer des Bodensees herumgelaufen sein, Narziß und Goldmund, und Albert Camus, Der Fremde. Gestern ist meine Mutter gestorben…
Meine Mutter würde so bald nicht sterben, hoffte ich natürlich, denn ich bin bei ihr immer geborgen gewesen und fühlte mich hier auf einmal einsam. Ich legte das Kopfkissen und das Federbett zurecht, machte es mir bequem und zündete eine Zigarette an. Sie schmeckte wieder. Nach der kalten Dusche war der Kater verflogen. Ich müsste das Rauchen aufgeben, hat Siegrid Dörflinger immer gesagt. Hatte ich meine kleine Stadt aus Neugierde auf die Fremde verlassen oder weil ich Siegrid nicht mehr begegnen wollte? Ach, du Feigling! Wir sind eineinhalb Jahre miteinander gegangen. An einem warmen Nachmittag auf einer Wiese an der Brigach hatte sie mich gefragt, ob ich es schon mal richtig gemacht hätte. Hatte ich nicht. Seit dem Nachmittag war sie meine große Liebe gewesen. Ich hatte danach alles an ihr geliebt, wie gewählt sie sprach, wie ungelenk sie tanzte, wie sie sich kleidete, hochgeschlossene Bluse, Strickjäckchen und ein langer Rock, alles in bester Qualität, Seide, Angorawolle, englischen Tweed, mal ein Kostüm, mal ein feines Baumwollkleid. Auf der Wiese trug sie das alles nicht und auch später nicht, wenn wir im Grünen Baum in Sigmaringen übernachteten. Sie war ein anständiges, zuverlässiges Mädchen. Sogar meine Mutter mochte sie, wenn auch mit ziemlicher Distanz. Sie wäre eine gute Partie. Sie sei in meinen sensiblen Mund verliebt, hatte Siegrid mir immer ins Ohr geflüstert, in meine treuen, blauen Augen und in meine malefizblonden Locken, liebte aber sonst nicht alles an mir. Dass ich Trompete im Stadtorchester spielte, hätte ihr nichts ausgemacht. Aber ich spielte auch in einem Tuttlinger Keller mit dem Vibraphonisten Bernd Gerber und in Bad Dürrheim mit den vier Reinhardt Brüdern, in Siegrids Augen schmuddelige Zigeuner. So wie die aussahen, hätte man sie im noblen Hotel Arkadien nicht auftreten lassen dürfen, nur in Schnaps und Bier trinkenden Gesellschaften heruntergekommener Kaschemmen. Die vier Brüder spielten alle virtuos Piano, Gitarre, Bass und Schlagzeug, und sie wechselten sich während einer Vorstelung, oft mitten eines Stückes, an ihren Instrumenten ab. Ihr Onkel Django war ein Weltstar auf der Gitarre. Und ihr Vater hatte dank schmachtendem Timbre mit seiner Geige das Warschauer Getto und Auschwitz überlebt. Für mich waren die vier Brüder Vorbilder in der Kunst, Gefühle in Melodien auszudrücken. Ihre musikalische Überlegenheit und ihre darin begründete Arroganz, versuchten sie mit übertriebener Hilfsbereitschaft zu überspielen, mit Höflichkeit, die fast an Unterwürfigkeit grenzte. Ihren Charakter und ihr Gehabe hatte ich schlicht freundschaftlich angenommen, denn über Musik hatte ich bei ihnen mehr erfahren, als von meinen Lehrern davor. Von den ernsthaften Musiklehrern unseres Stadtorchesters. Sie duldeten keine Abweichungen, wenn ich meine Etüden blies, und scheuten Experimente. Einer von ihnen hatte mich entdeckt, Herr Beller, als er mich pfeifend auf der Straße hörte. Er hatte meine Mutter angesprochen, ich würde die Töne jedes Liedes genau treffen und darüber hinaus eigene, melodische Weisen finden. Ich sei musikalisch und müsse unbedingt ein Instrument lernen. Im Verein sei es kostenlos, und man würde mir am Anfang auch ein vereinseigenes Instrument stellen. Ich wollte die Trompete. Da war ich zwölf. Der Verein lieh mir eine gute, alte, tschechische Trompete mit Hebelventilen. Sie sah zwar nicht so aus, wie die von Louis Armstrong, aber ich begann zu spielen. Zwei Jahre später waren wir bei einem Schulausflug durch eine Buspanne in der Altstadt von Tübingen gelandet. In einem Trödelladen dort in der Hanggasse hatte ich mein Instrument entdeckt, matt silbern, fleckig, eine Trompete mit Hubventilen, auch eine tschechische, man müsste sie nur putzen. Und sie ist einmal geputzt worden von Siegrid Dörflinger, meine Trompete, mit einem flachen Mundstück für meine Lippen, auf dem ich mühelos das hohe C blies. Später hatte ich das Instrument dazu frei auf den Tisch gelegt. Ich erinnerte mich genau an den Händler, einem grauhaarigen, älteren Herrn, schlank und mit flinken Bewegungen, Herr Masarik, ich habe seinen Namen zwanzigmal auf ein Postscheckformular geschrieben, um die Raten zu bezahlen. Denn als Herr Masarik mich in seinem Laden spielen hörte, war er ohne Umstände bereit, mir die Trompete für hundert Mark mit einer Anzahlung von drei Mark fünfzig zu verkaufen.
Meine geliebte Siegrid hatte mich musikalisch nur in Konzerten unseres Stadtorchesters erlebt. Nie hatte sie mit mir nach Bad Dürrheim oder nach Tuttlingen kommen wollen, und schon gar nicht, wenn ich zum Fasching mit einer anderen Gruppe in Rottweil und in Schwenningen zum Tanz aufspielte. Da konnte man mehr verdienen als bei meiner normalen Arbeit im Lohnbüro der Werkzeugmaschinenfabrik Hettich und Co. Sie mochte es nicht, wenn ich mit zwielichtigen Gesellen musizierte. Trotzdem wollte ich für ewig mit ihr zusammen bleiben, wegen der Wiese an der Brigach, und dann der Grüne Baum, als ich in Sigmaringen meinen Wehrdienst leisten musste. Dreimal hatte sie mich in der kleinen Garnisonsstadt besucht, wenn ich keinen Heimaturlaub bekam. Dann war nur noch ein Brief gekommen. Ich glaube, ihre Eltern konnten mich nicht leiden. Ihr Vater, ein Rechtsanwalt, hatte mich einmal nach meinen Plänen gefragt, nach meinen beruflichen Aussichten, nach meinen Zielen. Ich hatte keine Pläne und kannte meine beruflichen Aussichten nicht. Meine Ziele bestanden darin, Mädchen zu küssen und ihre Brüste anzufassen, und alle Ziele und Pläne waren durch seine Tochter übererfüllt. Ich lebe mehr in einer Traumwelt als in der Wirklichkeit, hatte Sigrid mir in ihrem Brief geschrieben. Ich heulte nachts in mein Kopfkissen und hoffte, dass keiner es auf meiner Bude mitbekommen würde.
Zur Freude meiner Vorgesetzten und zur Belustigung meiner Kameraden blies ich jeden Abend um zehn den Zapfenstreich. Die Lilli Marleen, wenn ich dem Herrn Oberst und dem alten Hauptfeldwebel einen Gefallen tun wollte, und Verdammt in alle Ewigkeit für alle anderen. Dadurch zog ich Musiker des Bataillons an. Im Waschraum unserer Batterie begannen wir zu musizieren. Drei der Jungen fand ich gut, um mit ihnen eine Band zu gründen. Hans Kohler am Saxophon, Siegbert Görens am Schlagzeug und Dieter Kirkowitz am Bass. Als wir dem Oberst Dream vorspielten, kam auch der Pianist Volker Grams hinzu. Im Casino befand sich ein Klavier, und wir durften fortan dort proben. Zuerst spielten wir auf Feiern von Batterien und Kompanien. Aber dann empfahl uns der Oberst zu einem Ball des Jägervereins. Auf einmal war ich Kapellmeister, so nannte mich jedenfalls der Hauptfeldwebel. Denn nun wollten alle Vereine der Gegend die Tanzkapelle der Bundeswehr zu ihren Festen haben. Und unser Oberst war begeistert davon. Seht her, unsere künstlerisch begabten Staatsbürger in Uniform! Es war Werbung für ihn und die Bundeswehr. Der Gruppenführer einer ABC-Abwehrtruppe war ich nur noch auf dem Papier. Wir hatten Musik zu üben. Es begann die Zeit, in der mir der Wehrdienst Spaß machte. Wir spielten zum Tanz für den Trachtenverein, für den Fußballverein, für die Rotarier, und dann nicht nur in Sigmaringen. Wir bekamen einen Unimog mit Chauffeur gestellt. Nach Hause konnte ich nicht mehr fahren, und auch meine Kameraden wollten es nicht. Denn wir spielten in Pfullendorf, in Singen, in Überlingen, in Friedrichshafen…, bekamen schließlich auch Geld dafür. Und zur Fasnet waren wir tagelang unterwegs. Negermusik durfte dabei sein, Tiger Rag und Muskrat Ramble, und etwas aus Südamerika, den Gummi Mambo, Das ist die Liebe im Vorübergeh’n…, und Schuld war nur der Bossa Nova, und zum Schmusen den Mitternachtsblues, und immer wieder Schunkelwalzer, Heute blau und morgen blau und Kornblumenblau… Ich musste nie wieder Wache schieben. Meine Siegrid ging inzwischen mit Herbert Reuter, einem Klassenkameraden, der in Heidelberg Jura studierte.
Jemand klopfte an die Tür. Siegrid? Käme herein, um es richtig zu machen? Das Klopfen an der Tür wurde eindringlich. Komm doch herein! Durch das Fenster fiel graues Licht. Hatte ich von Siegrid geträumt? Komm doch herein. Ich glaubte, meine Stimme gehört zu haben. Die Tür ging auf und Frau Neumeier trat ins Zimmer. Im marinefarbenen Hosenanzug. Das Kastanienhaar offen mit grauen Strähnen darin. Die fesche Olga. Der Kaffee, bitte schön. Der war heiß und bitter und süß und zwei Brötchen mit Butter und Erdbeermarmelade dazu. Ich kroch in die Federn zurück. Von Siegrid hatte ich nicht geträumt. Ich schloss die Augen. Und hatte sogleich Musik im Kopf. Ich spielte Negermusik mit Jimmy auf der Mundharmonika. In Grafenwöhr. Tief im Süden Dixies, Mein Herz erträgt es kaum, Da hängt meine Geliebte, An einem knorrig kahlen Baum… Jimmy war einer von denen, die die Atomsprengköpfe bewachten. So wie er aussah mit dunkler Haut und krausem Haar und rollenden Augen, und wie er sich immer fröhlich lachend gab, nannte ich ihn Sonnyboy. Und er hatte mir einmal gesagt, ich sei der einzige Mensch auf der Welt, der Sonnyboy zu ihm sagen dürfe. Allen anderen würde er ein Messer zwischen die Rippen rammen.