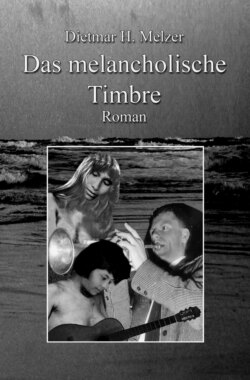Читать книгу Das melancholische Timbre - Dietmar H. Melzer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV Jatss
Der Abend dämmerte. Regen trommelte gegen die Scheiben. Ich lag auf dem Bett und schaute zu, wie es dunkel wurde. Wenn im Hof die Beleuchtung anging, entstanden Lichtrauten an der Decke und erhellten den Raum. Das war nicht lange unterhaltsam. Ich war wieder hungrig. Zu kauen hatte ich nichts. Das Brot hatte ich bei dem netten Fräulein vergessen. Ich stand auf, zog mir den Pullover an und den Mantel. Bis ich in der Cantina Guernica ankam, würde ich klitschnass sein. Vielleicht wären dann auch meine Schuhe und die Hosen unten sauber. Ich griff nach dem Koffer mit der Trompete. Wenn Nina und ihre Freunde nicht in der Bar auftauchten, würde ich nach dem Jazzclub fragen. Aber sie waren schon da, an der Bar, Nina und ihre Freunde. Alle in fast sommerlicher Kleidung. Und ich fühlte mich nass bis auf die Unterhose. Ich versuchte, mich an die Bar in Ninas Nähe zu drängen und bestellte ein Glas Portwein. Aber ihre Freunde waren gerade im Begriff, das Lokal zu verlassen.
„Wo ist der Jatss? Ich würde gerne mitspielen.“
Nina musterte mich. Ihr Blick blieb auf dem Trompetenkoffer haften. Sie nahm ihr Glas und trank den Inhalt in einem Zug. Der samtige Portwein. Sie stand von ihrem Hocker auf.
„Komm mit“, sagte sie, ohne zu gurren. Ich ließ den Portwein stehen, legte ein Markstück neben das Glas und folgte ihr. Draußen drängten die jungen Leute unter Kreischen und Lachen in Autos, die am Bürgersteig parkten. Abwartend blieb ich im Regen stehen. Die vordere Tür eines der Autos war offen geblieben. Ein schwarzer, hundertneunziger Mercedes. „Steig ein!“ Aber da vorne waren schon zwei Mädchen auf dem Sitz „Los. Steig ein!“ Ich klemmte mich zu Körper und Kleid und Perlonstrümpfe, den Koffer auf den Knien, dann irgendwie auf die Seite geschoben, um die Tür zu schließen. Protestierendes Geschrei erklang. „Hilfe, ein Frosch. Der Frosch hat mich völlig nass gemacht.“ „Küss ihn, er ist vielleicht ein Prinz.“ Eine männliche Stimme von der Rückbank. Wir waren acht Personen in dem Auto. Nina am Steuer. Sie fuhr schnell, die Rotebühlstraße hinunter in die Rote Straße, die mir wie eine Autobahn vorkam, bremste auf einmal scharf und bog nach rechts ab und noch einmal nach rechts. Sie parkte den Wagen hinter einer Reihe anderer, die in der schmalen Straße halb auf dem Bürgersteig standen. Hinter uns fuhren Ninas andere Freunde auf. Es war nicht unangenehm, mit einem schwankenden und reibenden Mädchenkörper zusammengepresst zu sein, doch war ich auch froh, aus der Enge wieder herauszukommen. Wir standen vor einem Haus mit neoklassizistischer Fassade, die irgendwie alle Bombenangriffe überstanden hatte. Neben der Haustür war ein offenes Tor, hinter dem Stufen zu einem Keller hinab führten. Ich sah ein schwach beleuchtetes Holzschild an der Wand. Die in das Holz geschnitzten Buchstaben waren mit roter Farbe gefüllt. JATSS-KÄHER las ich. Das war schönstes Schwäbisch. Zwar war auch ich das Kind eines hergelaufenen Flüchtlingsweibes, verstand aber den Dialekt inzwischen gut. Und mein Tonfall und meine Aussprache hatten sich bereits ins Alemannische gefärbt. In Hochdeutsch übersetzt stand auf dem Schild JAZZKELLER.
Das war auch zu hören. Musikfetzen drangen von unten durch eine geschlossene Tür herauf. Als die Tür sich öffnete und wir in das Lokal stürmten, packte mich sofort die Musik. Ragtime. Ich kam in ein Gewölbe, aus Ziegeln gemauert, das vielleicht mal ein Weinkeller gewesen war. Gleich hinter der Tür, die man von innen wie eine Steppdecke gepolstert hatte, befand sich eine Theke. Wir wurden von den hier herumstehenden Leuten mit Hallo begrüßt, mit Handschlag und Schulterklopfen, mit Wangenküsschen links und rechts. Auch ich bekam das alles ab. Mir wurde augenblicklich heiß. Ich begann zu schwitzen. Nicht wegen der Küsschen. Hier wurde gut geheizt. Ich habe später erfahren, dass Rohre einer neuen, zentralen Heizungsanlage in einem Nebenhaus, die auch den Laden und die Wohnungen über uns wärmen sollte, durch den Keller führten. Ich riss mir Mantel und Pullover vom Leib. Und schwitzte doch. Das konnte aber an dem Gedränge liegen. Der Jazz kam aus einem großen Raum, der links von der Theke zwei Stufen niedriger lag. Die Gäste dort saßen im Kerzenlicht um hochgestellte Fässer vor einem Podium, auf dem unter grellen Lampen die Band in Aktion war. Sechs Mann, Piano, Schlagzeug, Bass, Klari-nette, Posaune und Trompete. Der Trompeter indes spielte ziemlich hölzern. Er war nicht routiniert genug in seinen Improvisationen. Wenn ich heute Abend bei der Band einstieg, würde er mich sicher nicht mögen.
Der Mann hinter der Theke schob den Neuankömmlingen Bierflaschen und Gläser zu. Er sah aus wie Friedrich Wilhelm Nietzsche, mit einem grimmigen Gesicht und einem dichten, dunklen Oberlippenbart, der über den Mund schier bis ans Kinn fiel. Wie nahm er das Essen zu sich? Und wie küsste er eine Frau? Er sagte etwas zu mir, was durch diesen Bart und die Schallwellen von drei Bläsern und zischendem Schlagzeug mein Ohr nicht erreichte. „Das ist Horst Krohn“, rief Nina mir ins Ohr. Der Maler des grässlichen Bildes in der Cantina Guernica? „Er sagt, wenn du Musiker bist und einmal mitspielst, bekommst du ein Bier gratis.“ Ja. Das wollte ich ja. Ich hob meinen Koffer in seinen Blick. Er nickte mir zu. Wie sollte ich Flasche und Glas an mich nehmen mit dem Koffer in der einen Hand und Pullover und Mantel in der anderen?
Nina nahm mir alles ab, Flasche, Glas, Mantel, Pullover, den Koffer mit der Trompete. Mit auffordernder Geste ihres Elfenbeingesichtes stieg sie die Stufen in den großen Raum hinunter. Ich folgte ihr an eines dieser hochgestellten Fässer, um das auch schon einige Leute hockten. Man rutschte zur Seite, bildete eine Lücke, Hocker kamen über eine Kette von Armen herbei, meine Bierflasche und mein Glas standen bei den anderen Getränken auf dem Fass, mein Mantel und mein Pullover verschwanden irgendwo hin. Nur den Koffer hielt Nina fest auf den Knien, als sie sich setzte und dem Mann an ihrer Seite etwas ins Ohr schrie. Und dann mir: „Pass auf dein Bier auf, sonst trinkt es ein anderer!“ Ich schaute mich etwas um und war überrascht, wie viel ältere Herrschaften unter den Zuhörern waren. Damen und Herren. Ganz vorne eine Grauhaarige in einem Abendkleid. Bisher hatte ich immer gedacht, Jazzmusik sei nur etwas für Junge. Aber was hier gespielt wurde, sei auch die Musik ihrer Jugend gewesen, brachten mir diese „Alten“ nachher bei. Obwohl von den Nazis verboten, hätte man sie in bestimmten Kreisen heimlich gespielt, besonders in Hamburg, aber auch in Berlin und sogar im behäbigen Stuttgart. Den Ragtime? Ach was – Chicagoer Swing! Die in Rahmen aufgehängten Bilder an den Wänden konnte ich im Zigarettenrauch und dem Licht nicht richtig erkennen. Alte Plakate von Jazzveranstaltugen in New Orleans, New York, St. Louis, Chicago, Hamburg… Ein Stuttgarter Malermeister habe sie gesammelt, auch in den Jahren zwischen1933 und 1945, und auch, als er an der Front war, erst im Westen, dann im Osten. Seine Tochter habe sie dem Jazzclub geschenkt.
Der Pianist war ein schlanker Kerl, der auf dem Hocker hin und her rutschte, als wäre unter ihm ein Ameisenhaufen. Er trug lange, braune Haare, die wie mit Lockenwicklern gedreht auf seine Schultern fielen. Wäre nicht ein dunkler Bart um Lippen und Kinn gewachsen, hätte ich ihn für eine Frau gehalten. Zum Ende des Stücks stand er auf und hämmerte in die Tasten wie auf ein Schlagzeug. Ragtime. Humpta – humpta. Nicht unbedingt mein Stil, in dem ich spielen wollte, mit kurzen Stößen aus der Trompete, was dem jungen, weißblonden Mann gut gelang, so gut, wie man Etüden an der Villinger Musikschule lernte. Er war mindestens einen Kopf größer als ich. Es gab starken Applaus. Auch ich klatschte natürlich. Wie hieß das Stück? Cornet Chop Suey. Ein gefühlsloser Phlegmatiker, den solch fröhliche Musik nicht ansteckte! Dummerweise war ich auf einmal nicht fröhlich. Wieso war mir jetzt Siegrid in den Sinn gekommen? Auf der Sommerwiese an der Brigach.
Als die Musiker ihre Instrumente abstellten, ging Nina mit meinem Koffer auf das Podium und sprach mit dem Pianisten. Der wandte sich mir zu und versuchte, mich aus dem hellen Licht heraus im Schein der Kerzen zu begutachten. Ein Frauengesicht mit Locken und einem Bart. Er hatte übergroße, dunkle Augen mit kräftigen Brauen. Bei seinem prüfenden Blick fühlte ich mich in meiner so unvermittelt aufgekommenen Trauerwollust durchschaut. Nina quatschte auf ihn ein. Er nickte mir zu. Sollte ich jetzt aufstehen und auf das Podium gehen. Nicht aufdringlich sein. Lieber noch warten. Er winkte mir zu. Wie hätte ich ahnen können, dass mein Leben mit dieser Geste ein ganz anderes werden würde. Ein ganz anderes.
Ich begab mich auf das Podium hinauf. Vom Hocker auf mich her-aufschauend sagte er: „Fräulein Kornasow meint, du könntest ganz gut mit dem Dschass.“
Fräulein Kornasow? „Nina?“ Das wusste sie doch gar nicht. Wieso sagte er Dschass und nicht Dschäss oder Jatss?
„Isch würde mich freuen, wenn es zuträfe, was deine Freundin gerade erzählt hat.“
Meine Freundin? Was hatte sie denn erzählt? Und was war das für ein Akzent?
Er stand auf. „Ich bin Jean Christian“, und ergriff meine Hand, „mit vollem Namen Jean Christian Viennois. Welches Stück möchtest du bei uns spielen?“
„Als erstes vielleicht etwas Langsameres, so im swingenden Bummelschritt. I Can’t Give You Anything But Love, habe ich gedacht. In B-Dur. Du müsstest ein paar Harmonien vorgeben, die Posaune und die Klarinette müssten sie übernehmen und halten und ich würde die Melodie darüber spielen. Dann bekommen Posaune, Klarinette und Piano ihr Solo, dann zusammen im Dixie auseinanderfallend und noch einmal in einer Kollektivimprovisation…“
„Wenn du hier spielst, müsstest du dich uns anpassen“, warf der Posaunist ein. Er war rundlich, schon etwas älter, so um die fünfzig herum, mit einer Glatze. Dabei grinste er freundlich. Er hieß Jürgen Hersfeld. Außer Posaunist sei er auch freier Dekorateur, erfuhr ich noch am Abend.
„Lass ihn“, winkte Jean Christian ab. „Er soll zeigen, was er kann.“
„Der Rhythmus müsste schwingender sein, eleganter, dschumm, dschumm, dschumm, nicht auf das Charlston schlagen, nur treten, und das Becken streichen, und erst bei der Kollektivimprovisation auf alles draufhauen…“
Der Schlagzeuger, ein schmales, blondes Kerlchen, schaute den Pianisten fragend an. Dieser nickte. „Das ist Klaus Beckstein“, wurde ich informiert.
„Und das nächste Stück?“ Der Bassist. Auch schon etwas älter, um die vierzig. Ein großer, massiger Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Vollbart. Ariel Joas. Er sei Maschinenbauingenieur ineiner Firma in Tailfingen, hörte ich dann beim Bier, und käme jedes Wochenende zum Jazz nach Stuttgart. Er würde im Laufe des Abends mit heiserer Stimme Bei mir bist du scheen singen, in jiddisch.
„Etwas Flottes. I’ve Found A New Baby. Von Anfang an gleich im Dixiedurcheinander. Danach vielleicht Big Butter And Egg Man? Ja? Und dann vielleicht Dans les rues d’Antibes.”
„Bist du ein Fan von Sidney Bechet?“
Ich lachte. „Auch. Aber mehr von dem Trompeter Teddy Buckner, der mal in seiner Band gespielt hat. Die beiden haben nicht gut zusammengepasst.“ Die anderen schauten mich fragend an. Vielleicht hatten sie von dem verkrachten Konzert noch nichts gehört. „Wenn ihr das Stück nicht kennt, versuchen wir ein anderes.“
„Ist in Ordnung. Das spielen wir.“ Der Klarinettist, Rüdiger Vollmer. Ein schlaksiger, junger Mann mit einer blonden Lockenmähne. Später würde ich mich manchmal über ihn ärgern. Wenn er sein Solo hatte, war er oft nicht zu bremsen und steigerte sich in immer wildere Läufe ohne Ende hinein. Wie Sidney Bechet.
„Das reicht jetzt“, meinte der Posaunist.
„Noch eines. Etwas Sentimentaleres. Some Of These Days. Zum Schluss. Und da sollten Klarinette und Posaune zunächst auch nur die Akkorde halten…”
Der andere Trompeter hatte sich ins Publikum zurückgezogen. Er hieß Peter Wegner und war sonst Angestellter in einer Firma, die Kühlschränke produzierte. An diesem Abend würde er nicht mehr spielen, und ich würde mich wundern, wie gelassen er es hinnahm.
Ich packte mein Instrument aus. Jean Christian wandte sich dem Klavier zu. Leicht glitten seine Finger über die Tasten, perlende Töne, ganz anders, als ich ihn bis jetzt gehört hatte, wie eine Harfe, von unten bis zu den hohen Tönen und wieder zurück, hin und her, ließ allmählich Dreiklänge einfließen, erst sacht, sanft, wie die schüchterne Annäherung eines Mannes an eine Frau, dann immer deutlicher, kräftiger, drängender, bis sie das Perlen beherrschten und die Klänge sich wehmütigen Harmonien und einem langsamen Rhythmus unterwarfen. Das war der Einsatz für Schlagzeug und Bass und dann, als man aus Rhythmus und Akkorden die Melodie erraten konnte, der Einsatz für Posaune und Klarinette, im Satz, gezogen, ich war begeistert, wie gut es klappte, und leistete mir eine winzige Verzögerung bei meinem ersten Ton, die Harmonien mussten mich einfangen, tragen, bis ich mit der Melodie über sie zu gleiten begann, I can’t give you anything but love, die Melodie mit der hellen Stimme meiner Trompete… Ich machte mein Timbre nicht mit den Fingern auf den Ventilen, sondern von hinten mit Luft und Lippen, konnte damit schnelle Schwingungen erzeugen wie ich sie von anderen so noch nicht gehört hatte, konnte Töne vibrierend zu scharfen Attacken wachsen oder aushauchen, sterben lassen. Ich spiele eine sentimentale Trompete, hatte eine Zeitung einmal geschrieben, eine andere, ich spiele mit einem melancholischen Timbre. Und es war angebracht bei dem Stück, Ich kann dir nichts als Liebe geben.
Der Klarinettist Rüdiger Vollmer wollte sich von Sentimentalität nicht einfangen lassen. Bei Beginn seines Solos spießte er mit hohen Tönen aus dem Holz die Pianoakkorde auf und verdoppelte den Rhythmus durch rasante Läufe mit gekonnter Betonung. Dem Schlagzeuger blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen und aus dem gefühlvollen Gleiten einen heißen Beat zu machen. Rüdiger quiekte, grunzte, pfiff auf der Klarinette in wilden Tonfolgen. Er war der Star in diesem Club und erntete nach seinem Spiel solch stürmischen Beifall, dass man Jürgens Posaune eine Weile gar nicht wahrnahm. Indes gelang es ihm, mit ruhig gezogener Improvisation wieder an den Herzschmerz von Nichts-als-Liebe-geben zurückzuführen. Er war mein Verbündeter, merkte ich da, mein Bruder, er hauchte die Posaune mit einem weichen Timbre. Am Ende seines Spiels zog er die Töne aus der Tiefe und leitete den Chorus des Pianisten ein.
Von Jean Christian war zunächst nicht viel zu hören im Applaus für die Posaune. Aber auch danach war das Piano kaum hörbar, schlich sich ganz allmählich in den Raum mit breiten Akkorden in ungewohnten Variationen, über die sich, auch nur ganz allmählich, eine Melodie entwickelte, von Dur in Moll und wieder in Dur, Nichts-als-Liebe-geben, mit perlenden Klängen, die zu einer Harfenorgie wurden, rauf und runter, in die sich der Rhythmus ein-fand, immer lauter, immer drängender, dann beherrschend. Das war mein Einsatz.
Ich stieß ins Horn. Wollte eigentlich nicht gleich so hoch hinaus, weil es Kraft kostete und der Ansatz ein launischer Scheißkerl war, oftmals viel zu früh verschlissen. Aber ich war gestochen von der Klarinette und im Bann der Pianoakkorde und setzte in der Kollektivimprovisation noch einen drauf, eine Oktave darüber bis ins hohe C. Ich würde eben früher schlappmachen. Auch wenn ich niemals Rüdigers virtuoses Spiel erreichen würde, konnte ich ihm mit hohen, spitzen Tönen, mit meinem melancholischen Timbre, die Show stehlen. Über dem mittleren C ist es leicht, schneidende Läufe zu spielen, und ich fühlte Hilfe aus den Tiefen der Posaune, wurde gereizt durch schrilles Umtanzen der Klarinette, wurde getrieben durch Bass und Schlagzeug und von den Pianoakkorden. Bis ich keine Luft mehr bekam.
Stille.
Stille.
Jemand hustete.
Dann brach ein Orkan über uns aus. Klatschen, Schreien, Stampfen, Pfeifen… Tobende Menschen. Fässer fielen um, Gläser zerbrachen, der grauhaarigen Dame riss ein Träger ihres Abendkleides. Ich hatte so etwas noch nicht erlebt. Jean Christian winkte. Spielen! Spielen! I’ve Found A New Baby. Schneller Rhythmus, eleganter Swing, leicht dahingesprüht, ohne Mühen, die reinste Erholung. In meinem Chorus spielte ich einfach Max Kaminskis Improvisation nach, aus einer Aufnahme vom Februar 1959 in New York, ohne zu denken. Das Leben ging weiter. Ein neues Mädchen gefunden. Ich ließ der Klarinette den doppelten Chorus, in der sie herumflötete, wie sie konnte. Auch sie würde müde werden. Für den Schluss brauchte ich nur wenige spitze Töne, und dann noch einen, mit vibrierendem Timbre aushauchen lassen.
Solch temperamentvollen Beifall war ich nicht gewohnt und fürchtete, die begeisterten Leute würden gleich das Podium stürmen. Halt suchend wandte ich mich um und stieß gegen Jean Christian, der auch applaudierte, mir zuzwinkerte, mir applaudierte. Mir? Er war doch der Meister. Zwar hatte die Klarinette mich provoziert. Aber geführt hatten mich die Akkorde des Pianos. Ich applaudierte ihm. Meinem Meister. Aber das interessierte gerade niemanden.
Ariel Joas räusperte sich. Mikrophone, Verstärker und Lautsprecher gab es hier noch nicht. Ariel räusperte sich, immer wieder etwas lauter, bis er die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog. Dann sprach er mit tiefer, lauter Stimme, und das war sicher bis in das Gewölbe der Theke zu hören: „Wir haben heute einen jungen Musiker aus dem Schwarzwald zu Gast. Was er eben hier vorgetragen hat, wird wohl alle verwirrt haben, die dachten, in jenem finsteren Wald gebe es nur Holzfäller und Uhrmacher…“ Lachen. Strampeln. Fässer wurden wieder aufgestellt und Glasscherben weggefegt. Die grauhaarige Dame kam auf mich zu, fasste meine Hände, in einer hatte ich noch meine Trompete, du wirst die Seele dieses Orchesters sein. Hier duzten sich alle. Ich schaute vom Podium auf sie hinab, in ihr gerötetes Gesicht, auf ihre Brüste, ein Träger gerissen, die eine Brust fast unbedeckt, Brüste mit Fältchen wie im Gesicht. Ich schüttelte den Kopf. Nicht ich. Jean Christian ist die Seele des Orchesters. Und er würde meine haben können.
Wir spielten die anderen ausgemachten Stücke. Fröhlicher Chicago Swing. Es fiel mir leicht mit diesen Musikern. Auch Rüdiger richtete sich eigentlich nach Jean Christians Regie. Und dann Some Of These Days. Eine melancholische Trompete auf getragenen Akkorden von Piano und Bläser. Ich seufzte in Moll mit dem Instrument, als hätte mich süße Melancholie gepackt. You’ll miss my hugging, miss my kissing too… Hätte? Vor dem Podium saß ein Mädchen, das sich als meine Freundin ausgegeben hatte. Sie trug heute einen langen, weiten Rock und einen dünnen Baumwollpulli, so dass ich von dem Elfenbein nur das Gesicht sehen konnte. Wir machten eine Pause. Ich setzte mich zu ihr, und sie strich mit der Hand über meinen Arm. Horst Krohn kam zu uns herunter, blickte Nina finster an, sagte aber zu mir: „Du kannst hier trinken, was und wie viel du willst. Bis zum Vollrausch. Bis du umfällst.“ Ich hatte eher Hunger. Das war kein Problem. Jemand würde Essen für alle Musiker bringen.
Wir spielten dann den Royal Garden Blues, den St. Louis Blues,
St. James Infirmary und Creole’s Love Call, und das klappte auch ganz gut im Satz mit gestopfter Trompete. An der hinteren Wand wogen sich zwei Paare im langsamen Rhythmus des romantischen Stücks. Mit den spitzen Tönen musste ich mich etwas zurückhalten, weil ich die Kraft für die letzten Stücke brauchen würde, für das Finale. Und ich hatte nun wirklich Hunger. Horst Krohn winkte uns da zu sich herauf. Jemand hatte die Mahlzeiten gebracht. Wir setzten uns auf hohen Hockern an die Theke. Auch der Trompeter Peter Wegner, der ja richtig zur Band gehörte. Er lachte mir unbefangen zu, als ob es ihm egal wäre, dass er heute nicht mehr spielen sollte. Sieben große Steingutschüsseln mit Deckeln wurden uns über die Theke zugeschoben. Vorsicht! Sie sind heiß! Ich werde die Deckel der Schüsseln mit Topflappen selbst abnehmen. Die Worte ganz vorne aus dem Mund herausgepoltert. Iker Etscheberria hatte das Essen gebracht, der Baske, und als er den Deckel meiner Schüssel anhob, schlug mir heiß fremdartiger Duft ins Gesicht. Ich erkannte goldgelbenen Reis mit Fleischstücken darin, die von einem Huhn sein mussten, kleine, rotbräunliche Klumpen, die irgendwie fischig rochen und weiße, vernarbte, kleine Schlangen, bei denen ich einen Geruch zunächst nicht bestimmen konnte. Ich zog einen mit der Gabel heraus und biss in einen weichen, knorpeligen Körper. Er schmeckte so zwischen Kalbfleisch und gekochtem Kabeljau. Die rötlichen Klumpen schienen eine mehlige Fischart zu sein. Sie hatten aber sehnige Fasern an sich, die einem zwischen den Zähnen hängen blieben. Unsere Mahlzeit sei ein spanisches Nationalgericht, erklärte Iker, eine Paella, die Miesmuscheln und den Pulpo hätte er tiefgefroren in einem Feinkostgeschäft bekommen… Pulpo? Pulpo. Tintenfisch. Ich stellte mir einen Kraken vor, der mit Fangarmen eine Kogge in die Tiefe zieht und meinte einen Augenblick, mich ekeln zu müssen. Aber ich hatte Hunger. Und der Reis mit dem Hühnerfleisch und den Muscheln und dem Pulpo – Tintenfisch – schmeckte eigentlich auch. Mit jedem Bissen besser. Diese Paella war ja ein fantastisches Gericht! Wir tranken Rotwein dazu, den der Baske uns in dicken Gläsern zu den Schüsseln geschoben hatte.
Ich spürte Nina neben mir, ihre Brüste durch dünne Baumwolle und mein Perlonhemd, und schnuppernd ihre Nase in meiner Schüssel. Gurren. Paella. Ich steckte eine der Schlangen mit etwas Reis auf die Gabel und schob sie in ihren Mund. Ihre Brüste lösten sich von meinem Hemd, von meiner Lende, ich saß auf dem Hocker und sie stand neben mir, sie kaute und schluckte und lachte dann breit, schob mit der Zunge ein Reiskorn von den Zähnen. Muy rico este pulpo. Was hast du gesagt? Der Pulpo schmeckt ausgezeichnet. Wir müssen die Paella mal allein essen, gemeinsam alleine, ohne die anderen Leute. Ja. Gerne. Ja. Noch einmal Brüste an meinem Körper, von hinten, im Rücken. So etwas spürt man sofort. Die ältere Dame, der eine Träger immer noch lose von einer Spitze Stoff herunterhängend, der eigentlich heben und bedecken sollte. Meine Enkelin heiratet nächsten Sonntag. Ich wandte mich ihr fragend zu. Fältchengesicht, Fältchenhals, Fältchenbrüste und Schweißperlen dazwischen und an den Ohren, eine Oma war sie, aber alles an ihr umwerfend anziehend, wohl nur bei elektrischem Licht. Meine Enkelin ist genau so dumm wie meine Tochter und genau so dumm wie ich es war. Mit zwanzig zu heiraten. Und solch einen Macher, der außer von Bilanzen sonst nichts von der Welt versteht. Ich habe ihr das auszureden versucht, wie ich es bei meiner Tochter versucht habe, hatte auch nichts genützt, als es meine Mutter bei mir versuchte. Glanzvolle Hochzeiten, prächtige Roben, luxuriöse Hochzeitsreisen, man denkt, ein herrliches Leben vor sich zu haben und wacht erst allmählich auf, wenn man von Venedig oder Portofino zurück ist und merkt, dass in einer Villa auf dem Klo auch nur geschissen wird. Was wollte die Oma? Ihr spielt am Sonntag auf der Hochzeit. Horst wird euch alles genau erklären. Ich bezahle euch zweitausend Mark für den Abend und für die Nacht. Wenn das Kind schon in ihr wohlhabendes Unglück rennt, dann wenigstens mit Musik, die in mir noch Träume wecken kann. Some of these days… Auch meine Enkelin hat alle Regeln unseres Klans befolgt, ordentlich sittsam gelebt, sich mit keinem anderen eingelassen, will wie ich, bei dem ersten bleiben, so dumm wäre bei Bauern und Bürgern nicht mal die frömmste Katholikin, da passt es gut, das unschuldige Weiß ihres prunkvollen Kleides in der Heiligen Messe, obwohl wir nicht richtig katholisch sind, auch nicht richtig protestantisch, nur geldlich, immer satt, eben, von allem satt…
Zweitausend Mark für den Abend und für die Nacht. Die Oma war auf einmal hinter der Theke und diskutierte mit Horst Krohn. „Das sind dreihundertdreißig Mark für dich“, sagte Nina mir ins Ohr. Ich zog sie fest an mich heran. Einen Pulpo für den Musiker und einen für ein wunderschönes Mädchen. Lachen. Gurren. Gurren. Wir spielten danach Stardust. After You’ve Gone, flotte Swingnummern, auch schwermütigen Blues und ein Stück, das ich besonders gerne mochte, aus der Oper Porgy And Bess von George Gershwin, Summertime, und sonnte mich im Applaus. Zum Schluss gab es, das würde wohl immer so sein, When The Saints Go Marchin’ in, bei tobendem Publikum.
Nach dem Konzert blieben viele Leute an der Theke, davor und dahinter. Die aufregende Oma wollte Champagner. Den gab es hier nicht, auch keinen Sekt, nur Bier, das Königliche, und Schnäpse aus Äpfeln vom Bodensee und Trollinger Rotwein vom Neckar. Iker besorgte spanischen Schaumwein aus seiner Cantina. Die Oma hieß Hildrun von Hohenberg, erfuhr ich, sie stammte aus Ostpreußen, war von dort aber nicht mit einem Pferdefuhrwerk geflüchtet, als die Russen ins Land stürmten, um sich an verwundeten Landsern zu rächen und an Frauen und Kindern, sondern viel früher, in einem Maybach mit Chauffeur, und es war kein überstürzter Aufbruch in die Fremde gewesen, eher eine Heimkehr, in die Villa Schwanenburg am Rande des Schönbucher Waldes. Nach einer Flucht, wie sie Millionen Menschen erleiden mussten, wäre sie wohl keine solch attraktive Oma. Sie bezahlte alle Getränke, auch meine, obwohl die aufs Haus gingen. Ein junger Mann in einem dunklen Anzug mit Krawatte hielt ihr einen Pelzmantel zum Anziehen entgegen. Ihr Fahrer, erzählte man mir, als sie gegangen war, und viele andere mit ihr. Wir tranken den spanischen Schaumwein und Bier, und als sich nur noch eine kleine Gruppe um die Theke scharte, wollten wir mehr über das Angebot der Oma wissen. „Die Hochzeit findet nächsten Sonntag in ihrer Villa oben im Schönbuch statt“, bestätigte Horst Krohn. „Die bereits bestellte Kapelle wird Hildrun ausladen und euch stattdessen spielen lassen. Aber nur mit dem neuen Trompeter.“ Er schaute mich an. Und dann ging sein Blick an mir vorbei finster auf Nina, die sich stehend an mich geschmiegt hatte. Wir müssten am Nachmittag von vier bis um sechs spielen und am Abend ab acht bis um zwei Uhr in der Nacht. Bei der Gage hätten wir vierundzwanzig Stunden lang musiziert. Wir quatschten über das Wie und das Was, welche Kleidung, eine elektrische Verstärkeranlage wäre vielleicht nicht schlecht, und tranken noch ein paar Gläser dazu. Irgendwann saß ich mit einer Menge Leute in Ninas Wagen, alle betrunken und enthusiastisch gestimmt. Wir kurvten durch die nächtliche Stadt, brachten nacheinander die Freunde nach Hause, Mädchen und Jungen, ein kicherndes Paar, bis ich neben ihr allein war. Es ging ein paar Kurven die Weinsteige hinauf und dann links ab in eine schmale Straße. Im Schein der Straßenlaternen waren Gärten erkennbar und recht gediegene Häuser dahinter, wie mir schien. Nina hielt vor einem Gittertor und hieß mich, einen Hebel umzulegen und das Tor aufzuschieben, und fuhr das Auto den Weg hinauf.
Im Haus sah man von einem der Fenster auf das Lichtermeer der Stadt. Aber es war kalt in den Räumen. Nina schüttelte sich, um zu zeigen, wie unangenehm es ihr war. Von einem Bügel an der Garderobe griff sie nach einem hellen Wollmantel und zog ihn sich über, während wir ein großes Zimmer betraten. Sie schaltete zwei Stehlampen an. Das Wohnzimmer? Weißgetünchte Wände, sandfarbener Steinfußboden. Ein Salon? Oder ein Park? Palmen und Gummibäume in großen Kübeln, Schränke und Kommoden dazwischen, vielleicht aus Kirschholz, die mit Intarsien und Schnitzereien versehen, sehr alt sein mussten. In einer Wand war ein Bücherregal eingelassen. Die andere war ganz aus Glas mit einer Glastür daneben, die wohl in den Garten führte. In der Mitte des Raumes standen zwei hellblaubeige gemusterte Sofas und vier Sessel um einen niedrigen, runden Tisch aus Stein, aus Marmor?, auf einem schweren, roten Teppich. Nina ließ sich auf einem der Sofas nieder. Sie verschwand schier in der Polsterung. Fröstelnd zog sie den Mantel um sich zusammen. Mit ihrem Gesicht deutete sie auf die gegenüberliegende Wand. Dort war ein Kachelofen. Holz und Kohle lagen in schwarzsilbernen Gestellen bereit. Von einem Schemel griff ich nach einigen Blatt alter Zeitungen und nach dem Holz an der Seite des Ofens. Es brannte im Nu, einen warmen Geruch ausbreitend. Nach einigen Minuten die Kohle. Es dauerte eine Zeit, bis die Kacheln Wärme abstrahlten. Ich setzte mich zu Nina auf das Sofa. Sie zog mich an sich, schob ihre Hände unter meinen Pullover, unter mein Hemd, unter mein Unterhemd. Kalte Hände. In die nächtliche Stille bollerte das Feuer im Ofen. Ich bleibe so, bis mir warm geworden ist. Kalte Hände auf meiner Haut, die sich nach einer Weile zu bewegen begannen, um sich schneller zu erwärmen, über meine Haut strichen, auch mal hineinkniffen, mit den Fingernägeln kratzten… Wohnst du allein hier? Nein. Mit meinen Eltern. Sie sind aber nicht da. Den ganzen Winter nicht bis Ende Februar. In Los Cristianos haben sie ein Haus gemietet. Das ist ein Fischerdorf auf Teneriffa, eine Insel im Atlantischen Ozean. Die Hände streichelten, kniffen, kratzten, waren gar nicht mehr so kalt, eher meine Haut, Gänsehaut, gurren, gurren, und ihre Lippen auf meinen Lippen, und ihre Zunge in meinem Mund, und mir wurde heiß.
Sie ließ von mir ab, stand auf, ging zu dem Ofen und drückte ihren Rücken gegen die Kacheln. Hier ist es schön mollig. Sie zog ihre Schuhe aus. Auch der Fußboden hier ist schon warm. Komm. Fühl mal. Sie zog den Mantel aus. Ich war bei ihr, mit meinen Händen unter der dünnen Baumwolle auf seidigem Nylon und dann darunter auf ihrer Haut. Mädchen küssen und Brüste anfassen. Und was sie vielleicht sonst noch zuließen. Auch wollten. Alles aus Baumwolle wurde gehoben, gerupft, gezupft, davongezupft, und auch alles aus Nylon oder Seide mit und ohne Spitzen und aus Perlon mit den Strapsen daran… Sanft geschwungene Rundungen und alles elfenbeinfarbig, auch die Haare zwischen ihren Beinen, nur die Brustwarzen waren braun, auf anregenden Wölbungen. Ich hatte noch nie solch eine wohlgeformte Frau gesehen. Nicht im Kino. Nicht in einem Magazin. Nicht in einem Pornoheft. Und alles fühlte sich weich und trotzdem fest an ihr an. Nackt neben ihr kam ich mir vor wie ein knöchernes Gestell mit etwas Muskeln drum herum. Und der rote Teppich war flauschigdaunenweich. Te quiero, te quiero… Was heißt das? Ich liebe dich. Aber nicht wie im Deutschen. Es bedeutet eher, ich begehre dich. Und alles war anders als an der Brigach und im Grünen Baum.
Ich wachte am Geschrei von Krähen auf. Ein schüchterner Sonnenstrahl schien auf die gläserne Wand, und dahinter blinkten Regentropfen auf Ästen und faulenden Blättern, die noch nicht herabgefallen waren. Wir waren auf dem Teppich eingeschlafen. Nina in meinen Armen. Ich betrachtete sie. Am Morgen nach der Nacht war sie noch schöner. Ganz leicht ließen sich ihre Lippen mit meiner Zunge öffnen. Sie schmeckte bitter nach zu wenig Schlaf und Alkohol und Zigaretten. In ihrem Haar schnupperte ich Tabakrauch und in ihrem Gesicht und auf ihren Brüsten. Sie würde meine Freundin sein. Unfassbar mein Glück. Sie küssen, ihre Brüste anfassen und in ihr sein, und rechtzeitig wieder draußen. Auf dem roten Teppich waren Flecken.
Sie öffnete die Augen. Braune Augen, die mich liebevoll anschauten. Mit einem Seufzer befreite sie sich aus meinen Armen und drehte sich zur Seite. Ihr Blick blieb auf dem Fleck im Teppich haften. „Den muss ich nachher wegputzen“, murmelte sie und erhob sich. Ich konnte meine Augen nicht von ihr lassen, sog begierig auf, wie sie aufstand, durch den Raum schritt und wie in der Nacht sich mit dem Rücken an die Kacheln des Ofens lehnte. Sie mussten noch warm sein. Ein wunderschönes Mädchen. Eine liebevolle Frau. Ein verführerisches, nacktes Weib.
„Wenn du die Weinsteige hinuntergehst, kommt nach der ersten Kurve die Haltestelle. Die Tram fährt zum Hauptbahnhof, wo du umsteigen kannst.“
„Ja.“
Ich suchte meine Kleider zusammen. Sie blieb an den Kacheln und sah zu, wie ich mich anzog.
„Vergiss die Trompete nicht.“
„Nein.“
Ich versuchte, ihre reine Haut nicht mit meinem schmutzigen Mantel zu berühren. Wir küssten uns auf die Wangen.
Draußen schien inzwischen eine strahlend helle Sonne. Wie Diamanten glitzerten Tropfen im Geäst der Gärten. Aber auf dem Weg die Weinsteige hinunter tauchte ich in dichten Nebel, der über der
Stadt in dem Tal hing. Nach ein paar Schritten konnte ich kaum noch etwas sehen. Kein Auto fuhr vorbei, um mit Scheinwerfern ein paar Meter weit die Straße in die Stadt zu beleuchten, und auch keine Straßenbahn. So tastete ich mich am Bordstein entlang, fand nirgendwo eine Haltestelle, marschierte und marschierte. Der Nebel hob sich endlich etwas von dem Asphalt, als ich mich der Innenstadt näherte. Kalte Schleier in kahlen Bäumen und an grauen Mauern. You’ll be so sorry, when I’m away from you. Ein nacktes, begehrenswertes Weib. Nicht wie an der Brigach. Nicht wie im Grünen Baum. Ich war in der Innenstadt. Jetzt kam auch eine Straßenbahn vorbeigefahren. Vielleicht würde sie weiter vorne halten. Es war mir egal. Ich war schon viel weiter marschiert als bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof und dann noch weiter bis in die Rötestraße, und hätte an diesem Sonntagmorgen auch bis an die Brigach marschieren können. Ich fiel dann über die Brötchen mit Butter und Marmelade her und schlürfte den Kaffee. Der war heiß. Der konnte noch nicht so lange da auf dem Tisch gestanden sein.