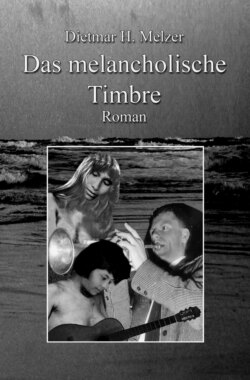Читать книгу Das melancholische Timbre - Dietmar H. Melzer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII Ein nettes Fräulein
Es klopfte, klopfte, klopfte und hörte nicht auf, Herr Kalisch, Herr Kalisch! Mitten in der Nacht. Das Licht ging an. Geblendet fuhr ich hoch. Sie hatten nicht abgeschlossen, Herr Kalisch. Ist auch nicht nötig. Ich bringe Ihnen das Frühstück. Sie wollen doch heute bei Pfleiderer anfangen. Es ist sechs Uhr. Sie sollten am ersten Tag früher aufstehen, um sich zu sammeln. Ich habe den Badeofen angeheizt. Ausnahmsweise. Sonst müssen Sie das selber machen und sich mit den anderen Mieter absprechen. Frau Neumeier in ihrem verblichenen Morgenmantel. Ich musste den ganzen Sonntag geschlafen haben. Sie war schon wieder verschwunden, als ich aus dem Bett taumelte. Mitten in der Nacht. Eine kalte Nacht. Im Bad war es warm. Ich rasierte mich und duschte. Mit heißem Wasser. Welch ein Luxus! Ich hätte danach zehn Brötchen verschlingen und zehn Tassen Kaffee trinken können. Wenn man hungrig bleibt, fällt man nicht in Träumereien oder in depressive Stimmung, man bleibt wach und neugierig. Ich zog den Anzug an, ganz neu aus grauem Flanell, und er würde hoffentlich in ein paar Minuten die Kofferknitter verlieren, und eines der beiden Hemden, bügelfrei, das blaue, das wirkte kaufmännisch gediegen, und eine blauweisrot gemusterte Krawatte dazu. Ich hatte versucht, die nassen Schuhe trocken zu reiben. Baumwollsocken und Körperwärme würden das Leder vollends trocknen. Als ich das Licht löschte, dämmerte der Tag herein.
Im Korridor stand Frau Neumeier. „So wie Sie heute aussehen, könnten Sie auch noch meinen Jahrgang verrückt machen“, lachte sie. Ich fühlte mich geschmeichelt und wuchs ein paar Zentimeter. Beschwingt stieg ich die vier Stockwerke hinunter. Im Hof empfing mich feuchter Nebel. Ein kleiner Junge in einer blauen Jacke kniete im Sandhaufen über Eisenbahnschienen. Er hielt eine Lokomotive in der Hand und schüttelte sie.
„Sie funktioniert nicht.“ Er stand auf und wandte sich mir zu. „Kannst du das reparieren?“
Sand klebte an den Knien seiner wollenen Strumpfhose. „Wie heißt du denn?“
„Ich bin der Walter.“ Er hielt mir die Lokomotive hin.
Ich ging in die Knie und betrachtete das Spielzeug von allen Seiten. Als ich es umdrehte, sah ich die Schraube sofort, die das Ablaufen der Feder blockierte. Wie war die da hineingekommen? Wo fehlte sie jetzt? Man müsste einen Schraubenzieher haben. Walter hatte ein Taschenmesser. Die Schraube fiel in den Sand, und das Federwerk setzte Räder in Bewegung. Der Junge stellte die Lokomotive auf die Geleise und ließ sie im Kreis um einen Hügel fahren. Wir müssen die Schraube suchen. Sie fehlt irgendwo. Dazu hatte er keine Zeit.
„Was hast du da am Hals hängen?“
„Meinen Hausschlüssel.“
„Wie alt bist du denn?“
„Sieben.“
„Wo ist deine Mutter?“
„In der Frühschicht.“
„Und dein Vater?“
„Der hat jetzt eine andere. Solch ein hergelaufenes, schamloses Flüchtlingsweib.“
„Musst du nicht in die Schule?“
„Au Backe!“
Er ließ von seinem Spielzeug. Mir war der Schulranzen gar nicht aufgefallen, der neben dem Sandhaufen lag. Der Junge schnappte ihn und hievte ihn auf seinen Rücken.
„Hast du ein Brot dabei?“
„Hab ich schon gegessen.“
Was ging mich der Junge an? Ich kramte ein Markstück hervor. „Für die große Pause.“
„Danke, auch für die Reparatur der Eisenbahn. Die ist uralt, weißt du. Vielleicht bekomme ich ja mal eine elektrische. Eine Trix oder gar eine Märklin. Aber du bist ja wirklich nett, wie Fräulein Karin, die ist auch ganz nett, sie schenkt mir manchmal einen Apfel oder eine Tüte mit Zwetschgen…“
Wirklich nett, von einem Jungen mit einem Fräulein Karin verglichen zu werden. Ich hatte genügend Zeit und bummelte gemütlich die Rote Waldstraße hinauf zur Eisenbahnunterführung. Dahinter entdeckte ich gleich die Fabrikgebäude von Pfleiderer & Sohn, Elektrogeräte KG. Der Pförtner war ein einarmiger, älterer Herr, der mich misstrauisch beäugte, bevor er mir das Einladungsschreiben der Firma aus der Hand nahm. Er griff zum Telefon und nuschelte etwas hinein, was ich nicht verstand. Danach nuschelte er mir zu. Ich begriff ungefähr, einen Gang entlang gehen zu müssen, dann zwei Treppen hinauf, wieder einen Gang, und dann ins Zimmer drei. Später habe ich erfahren, dass der Pförtner auch die Telefonzentrale bediente, und alle Mitarbeiter der Firma sich fragten, wie Kunden und Lieferanten mit seiner Aussprache zurechtkamen. Ich klopfte an der Zimmertür drei. Nach dem Herein einer weiblichen Stimme blickte ich auf einen Eckschreibtisch mit einer Telefonanlage und einer Schreibmaschine, dahinter ein Fräulein mit blonden Locken um ein rosiges Gesicht. Das war Fräulein Hertel, die Sekretärin. Sie wies auf einen Stuhl und bat mich, etwas zu warten. Im Ausschnitt ihrer Rüschenbluse lugten zwei rosige Bällchen hervor. Deretwegen wäre ich lieber stehen geblieben. Aber das wäre unhöflich gewesen. Also wartete ich mit Blick auf Locken und Telefonkabel, und auf die beiden spitzen Pumps, die sich unter der Blende am Schreibtisch hervorschoben, bis Herr Direktor Allgäuer mich bitten ließ.
Wer sich einen Direktor eines erfolgreichen Industriebetriebes im Wirtschaftswunderland groß, korpulent mit glänzendem Gesicht und einer Glatze vorstellt, wurde beim Anblick des Direktors Allgäuer nicht enttäuscht. Er kam breit lachend, ein rosiges Gesicht wie seine Sekretärin, hinter seinem mächtigen Schreibtisch hervorgeschnellt, um mir die Hand zu schütteln. Ziemlich kräftig zu schütteln. Er war Leiter des Rechnungswesens und Personalchef. Sein Anzug sah zerknittert aus. Ihm würden die falschen Falten in meinem nicht auffallen. Dr. Pfleiderer junior könne mich nicht persönlich begrüßen. Er befände sich auf einer Geschäftsreise in den Vereinigten Staaten. Das klang irgendwie stolz. „So wünsche ich Ihnen ein herzliches Willkommen bei der Pfleiderer & Sohn Elektrogeräte KG. Wir produzieren Radiatoren, Ventilatoren, Heizgebläse, Kühlgebläse, Klimaanlagen für Großraumbüros, Banken, Kaufhäuser und Fabrikationshallen… Sie waren vor Ih-rem Wehrdienst in der Lohnabrechnung tätig und haben sich nun für unsere Nachkalkulation beworben. Eine ganz wichtige Aufgabe. Sonst wüssten wir ja nicht, mit welcher Anlage wir etwas verdient haben, ha, ha, ha… Das Gymnasium abgebrochen ohne Abitur. In der Berufsschule waren Sie in Buchhaltung und im Kaufmännischen Rechnen auch nicht gerade der beste. Ist nicht so schlimm. Wir werden eh alles auf Hollerith umstellen im nächsten Jahr. Da rechnen und buchen dann die Maschinen, ha, ha, ha. Englisch und Französisch haben Sie gelernt. Das kann man immer mal brauchen. Hier schreiben Sie, dass Sie auch Spanisch gelernt hätten, in der Volkshochschule. Ja, warum das denn?“
„Ja, also… Mein Zahnarzt war Chilene, und der spielte bei uns manchmal die Bongos, und…“
„Ist ja auch egal. Wenn Sie mal an der Costa Brava Urlaub machen, können Sie sich dort etwas Ordentliches zum Essen bestellen, ha, ha, ha…“
Ich wurde eingestellt. In einer Wirtschaftszeitung hatte ich mal gelesen, die deutschen Unternehmen würden Personal horten. Es war in dieser Zeit also leicht, eine Stelle zu bekommen, auch mit mittelmäßigen Zeugnissen. Mein Gehalt betrug nach Tarifgruppe K2 mit einer Sonderzulage siebenhundertneun Mark im Monat, das bedeutete netto etwa fünfhundertvierzig Mark. Das war nicht schlecht. Man wollte mir den heutigen Tag als vollen Arbeitstag anrechnen. Herr Direktor Allgäuer führte mich einen Stock tiefer durch einen Gang, links und rechts hinter Glas fleißige Frauen und Männer an Schreibtischen, in eines dieser Büros zu einem rundlichen Herrn mit langen, silbernen Haaren, zu Herrn Burian, dem Leiter der Nachkalkulation. Ich war nicht passend gekleidet. Die Angestellten in diesem Büro trugen weiße Arbeitskittel. Mit mir waren es sechs in diesem Raum. Herr Burian wies mir freundlich einen von zwei freien Schreibtischen zu. Er sprach mit weichem, böhmischen Akzent. Ich bekam von einem der neuen Kollegen zwei Rechenmaschinen auf den Schreibtisch gestellt, eine mit einer Kurbel für Multiplikationen und Divisionen und eine mit einer Zehnertastatur und einem Papierstreifen für Additionen und Subtraktionen, und einen Karton voller Lohnzettel dazu. Die sollte ich durchsehen, sollte sie nachrechnen, falls mir auffiel, dass etwas nicht stimmen konnte, wenn zum Beispiel die Sollzeit viel höher war als die tatsächlich verbrauchte Zeit, war der Lohn zu hoch. Ab hundertdreißig Prozent musste ich es gesondert notieren, damit der Refamann den Arbeitsgang untersuchte und gegebenenfalls die Vorgabe reduzierte. Sonst verdienten die Akkordarbeiter zu viel. Es hing also von mir ab, ob man ihnen das Einkommen kürzte. Zeiten und Löhne, die geplanten und die tatsächlichen, hatte ich dann je Auftrag zu addieren und die Ergebnisse an Herrn Burian zu reichen, der von den Kollegen die anderen geplanten und angefallenen Kosten, Rohmaterial und Teile, zugeleitet bekam. Das würde nächstes Jahr alles wegfallen, erläuterte Herr Burian bei Gelegenheit. Man würde alle Daten auf Lochkarten sammeln und in Hollerithmaschinen einlesen, man würde alle Informationen automatisch auf Listen gedruckt bekommen. In der Buchhaltung habe sich das System bereits bewährt. Bald könnte dort die Mahnabteilung wegfallen, weil die Maschine merkte, wenn ein Kunde in Verzug war und automatisch die Mahnung erstellte. Meine Arbeit begann um halb acht und endete um halb sechs. Samstags und sonntags hatte ich frei. Von zwölf bis eins war Mittagspause. In der Kantine kostete das Essen zwei Mark. An meinem ersten Arbeitstag gab es eine Gemüsebouillon, Kassler Ripple mit Sauerkraut und Püree und einen Apfelkompott. Die Portionen waren für Schwerarbeiter gedacht. Beim ersten Mittagessen aß ich alles auf. Ich kam mit einem Kollegen von der Auftragsbearbeitung ins Gespräch und erfuhr, dass in der Nähe meiner Wohnung ein Konsum Laden war. Sie bedienten auch Kunden, die nicht in der Gewerkschaft waren. Die Preise dort wären günstig, und am Ende des Jahres bekäme man eine Vergütung auf den Umsatz.
Auf dem Heimweg am Abend versuchte ich auszurechnen, ob ich, bei diesem Lohn und den Kosten für ein Mittagessen, bald ein gebrauchtes Auto anzahlen konnte, einen VW Käfer oder einen Kadett. Zunächst aber musste ich ein ordentliches Radio und einen Plattenspieler haben. Im Licht der Hofbeleuchtung stieß ich auf Walter. An seine Lokomotive hatte er nun einen Personenwaggon gehängt.
„Es ist dunkel. Müsstest du nicht längst zu Hause sein?“
„Ja, schon. Herr Becker hat mir den Waggon besorgt, und den wollt ich geschwind probieren. Er will auch noch nach weiteren Schienen schauen. Ach, heute gings mir ja gut, beim Schulbeck einen Wurstwecken, mit der Mark komme ich eine ganze Woche aus, und das nette Fräulein Karin hat mir auch noch Weintrauben geschenkt.“
„Wer ist denn das nette Fräulein?“
„Na, die da oben, im vierten Stock. Könnst dich in sie verlieben.“
„Das will ich mal versuchen.“ Ich musste lachen. „Pack jetzt deine Sachen und geh nach Hause, bevor dich die Nachtgespenster holen!“
„Nachtgespenster? So’n Blödsinn. Es gibt gar keine Gespenster.“
Bei den Lohnscheinen waren sehr viele dabei, die einen höheren Lohn auswiesen als den vorgegebenen, und darunter auch viele, welche die erlaubten hundertdreißig Prozent überschritten. Musste ich wirklich geschickten Akkordarbeiterinnen und Akkordarbeitern, die cleverer als die Refaleute waren, den gerechten Verdienst kürzen? Wenn ich alle übersähe, würde mein Vorgesetzter es merken. Jeden zweiten zu übersehen, wäre ungerecht, und möglicherweise würde eine anständige, ehrliche Haut weniger bekommen und… Ich könnte alle Frauen durchgehen lassen, die verdienten sowieso zu wenig. Aber man sah es der Personalnummer nicht an, ob Frau oder Mann, und ich wusste noch nicht, in welcher Montageabteilung Frauen und in welcher Männer arbeiteten. Indes würde ich dann schwer arbeitenden Männern das Einkommen schmälern, die Ehefrau und zwei Kinder zu ernähren hatten. Ein Kollege musste gemerkt haben, wie ich zögerte. Er trat hinter mich. Alle haben die gleichen Bedenken wie Sie, wenn sie die Lohnscheine kontrollieren, raunte er mir zu. Herr Burian rechnet nach und wird Sie rügen, wenn Sie welche übersehen. Und wenn es wiederholt geschieht, wird er Ihnen Vorsatz unterstellen und Schadenersatz verlangen. Überlassen Sie es lieber der Gewerkschaft, sich mit der Refa herumzuschlagen.
Das Frühstück von Frau Neumeier und die Mahlzeiten in der Kantine reichten mir zum Leben. Ein Abendbrot brauchte ich eigent-lich nicht. Die Kneipe, aus der ich an meinem ersten Abend in dieser Stadt die schöne Nina heraustreten gesehen hatte, nannte sich Cantina Guernica, Sie war ein langer Raum mit einer genauso langen Bar auf der linken Seite mit hohen Hockern davor. Rechts standen eine Reihe Tische an der Wand, die mit einem ungewöhnlichen Bild bemalt war, fliehende, sich windende, vor Entsetzen schreiende Menschen, ein Pferd, das Maul aufgerissen voller Qual, darüber ein unbeteiligt scheinender Stier und eine fliegende Frauengestalt mit einer Leuchte. Der Wirt erklärte, das Bild sei die ungefähre Kopie eines Werkes von Picasso, ein Freund, Horst Krohn, habe es an die Wand gemalt, hätte es ganz gut getroffen, jeder wüsste hier sofort, was mit Menschen im Krieg geschieht, hier das Beispiel, als die deutsche Luftwaffe Guernica bombardierte, es sei bestimmt auch so in Stuttgart gewesen… Der Wirt hatte einen ungewohnten Akzent. Er bildete seine Worte irgendwie ganz vorne im Mund und ließ dabei das R polternd herausstolpern und das S ähnlich wie ein englisches Th lispeln.
„Guernica?“
„Eine baskische Stadt östlich von Bilbao. Ich bin von dort.“
Aus Spanien? Groß und blond wie er war, sah er nicht so aus, wie man sich einen Spanier vorstellt. Und sein Name klang auch nicht gerade spanisch, Iker Etscheberria. Ich fragte ihn, warum er aus dem sonnigen Spanien ins verregnete Stuttgart gekommen sei, um hier eine Bar aufzumachen. Der Wirt begann zu lachen.
„Guernica liegt im Norden ganz nah am Atlantik, und dort regnet es doppelt so viel wie in Stuttgart. Die meisten Häuser haben keine richtige Heizung, einen Kamin vielleicht oder einen Gasofen, der ein Gitterrost zum Glühen bringt. Ein halbes Jahr frierst du und ein halbes Jahr hast du Rheuma.“ Er wurde ernst. „Aber ich bin nicht deswegen von dort abgehauen. Franco mag unsere Sprache nicht, obwohl sie im Baskenland schon mindestens siebentausend Jahre gesprochen wird. Wer Baskisch spricht, wird beschuldigt, ein Staatsfeind zu sein, der das Baskenland von Spanien lösen will. Ein schweres Verbrechen. Und ich wurde zudem verdächtigt, mit subversiven Komplizen ein Polizeiauto mit vier Beamten in Bilbao in die Luft gesprengt zu haben.“
„Und?“
„Natürlich will ich die Unabhängigkeit der Basken, unser Euskadi, damit wir unsere Sprache Euskera und unsere Kultur behalten. Nach dem Ende des Königreiches von Pamplona hatten alle spanischen Landesherren an der Heiligen Eiche in Guernica geschworen, unsere Eigenständigkeit zu respektieren. Nur Franco nicht. Die Deutschen glaubten mir, nichts mit der Bombe in Bilbao zu tun zu haben. Ich bekam hier Asyl.“
Von Basken wusste ich bisher nur, dass es bei ihnen eine besondere Form von Mützen gab, die mein Französischlehrer gerne aufhatte, sonst aber vornehmlich von Franzosen getragen wurden. Mir fiel ein, während der Kubakrise erwogen zu haben, mich im Fall eines Krieges nach Spanien abzusetzen. Was hätten ihrer Regierung treu dienende Beamte mit einem desertierten deutschen Soldaten angefangen? Wenn schon die Basken Schwierigkeiten nur wegen einer eigenen Sprache hatten. Nur das mit der Bombe. Sah der große, blonde Wirt so aus, als könnte er Polizisten ermorden?
„In einem Francogefängnis hätte ich auch zugegeben, die Heilige Jungfrau vergewaltigt zu haben.“ Er deutete auf die Wand. „Bomben lösen nichts. Sie töten nur. Und dass Alexander der Große den Gordischen Knoten mit dem Schwert gelöst hätte, ist eine Erfindung antiker Faschisten.“
Picasso hatte auch viele nackte Frauen gemalt. Die Wand wäre schöner gewesen, wenn der Maler Horst Krohn solche Bilder kopiert hätte. Man bekam hier samtigen Portwein zu trinken und ein süßes, weinhaltiges Getränk mit Stücken von Ananas und Orangen, Sangria nannte es der Wirt und erklärte, man mische auch eine gehörige Portion Orangenlikör dazu. Ich bekam Kopfweh, wenn ich zu viel davon trank. Es wurden aber auch drei verschiedene Sorten von Bier serviert. Frisch vom Fass. Eines aus der Eifel, eines aus Ostfriesland und jenes Königliche Hofbräu von hier, das ich ja kannte. Für wenig Geld wurden kleine Schalen mit Oliven gereicht und geröstete Stücke von Weißbrot mit einer Sardellenpaste. Ein ordentliches Abendbrot brauchte ich ja nicht. Aber solche Tapas, wie der Wirt es nannte, ließ ich mir manchmal kommen, wenn ich nach Büroschluss auf einen Schluck in diese
Kneipe ging. Immer in der Hoffnung, die schöne Nina zu treffen. Samstags wäre sie oft hier, bevor sie und ihre Freunde in den Jazzkeller in der Calwer Straße gingen.
Am Wochenende musste ich mich selbst verköstigen. Ein Restaurant kam dafür nicht in Frage, weil die dreißig Mark, die mir nach dem Bezahlen der Essensmarken für die Kantine geblieben waren, durch Sangria und Königliches Hofbräu dahinflossen. Am Samstag kaufte ich gegen Mittag in dem Konsumladen um die Ecke zwölf Eier und einen Laib Brot. Das würde mir nach Frau Neumeiers Frühstück auch für den Sonntag reichen, und ich hatte noch genug Geld, wenn sich etwas mit dem Jatss ergab. Ich wollte in der Küche auf unserer Etage Rühreier zubereiten.
Die vier Stockwerke nahm ich die Treppen zwei Stufen weise hinauf, öffnete so in Fahrt die Korridortür und wollte in die Küche. Die Tür ging auch ein Stück auf, prallte aber wieder zurück mit Scheppern und Poltern und einem spitzen Schrei. Etwas kam hinter der halboffenen Küchentür hervor geschossen, eine gräuliche Schlange, die zu einem Menschen wurde, eine junge Frau, ein recht mageres Mädchen. Ich ließ vor Schreck die Tüte mit den Eiern fallen.
„Wer sind Sie denn?“, stammelte ich.
„Und wer sind Sie?“ Die Stimme klang zornig.
Ich schaute auf krause Falten um eine spitze Nase, und in blaue Augen, die wütend funkelten. Wie eine angriffslustige Schlange lauerte das Mädchen an der halboffenen Tür. Meine eben aufgekommene Entrüstung schwand gleich wieder. Die aus dem Papier sickernde, wässrige Gallertmasse mit gelben Schleiern wurde bedeutungslos. Bald würde sie an meinen Schuhen kleben. Ich zeigte mit dem Brotlaib in der Hand auf den Boden „Das hätte mein Mittagessen werden sollen.“ Meine Stimme schien ohne Kraft zu sein.
Das Mädchen, die junge Frau, steckte in einem grauen Rollkragenpullover und einem grauen Rock, aus dem zwei dünne Beine hervorschauten. Sie trat einen Schritt zurück, nahm etwas vom Boden auf und ließ die Tür in die Küche hineinschwingen. Sie hatte einen leeren Topf in der Hand. Auf den Küchenfliesen breitete sich eine dampfende Flüssigkeit aus, anregend duftende Bouillon, wie ich
nun merkte, Stücke von Karotten und Kartoffeln darin und Fleisch. „Das hätte mein Mittagessen werden sollen!“
„Ja.“
„Tollpatsch!“
„Entschuldigung.“
„Was nun?“
„Saubermachen, glaub ich, man müsste …“
„Frauenarbeit, natürlich!“
„Nein. Ich helfe. Bei der Bundeswehr habe ich alles Mögliche schrubben müssen.“
„Und was esse ich dann?“
„Ich habe hier noch das Brot.“ Mein Friedensangebot.
Ihrer Mimik und ihrem Blick nach schien sie es aber nicht annehmen zu wollen. Sie drehte sich um. Mit ein, zwei, drei Schritten war sie im Inneren der Küche, an der Spüle unter einem Fenster, und stellte den Topf in den Ausguss. Dann öffnete sie die Tür zu einer Kammer, aus der sie Schrubber, Wischlappen und zwei Eimer hervorholte. Einen Eimer füllte sie mit Wasser und Spülmittel und tauchte den Wischlappen hinein, den anderen drückte sie mir in die Hand.
„Lesen Sie alle festen Stücke auf und werfen Sie alles da hinein.“ Ich hatte damit Ei und Bouillon an den Schuhen und, es ließ sich nicht vermeiden, auch an der Hose. Jeder Quadratmeter, den ich von fester Nahrung befreite, wurde von ihr mit dem Wischtuch aufgenommen. Zwischendurch stellte sie einen großen Topf Wasser auf den Gasherd. „Mit heißer Seifenlauge die Fettreste vom Boden zu wischen, würde ich gerne machen.“ Sie schaute zu, wie ich mit Lappen und Schrubber über Fliesen und Parkett fuhr, ganz gründlich, immer wieder von neuem, bis nichts mehr glitschig war. „Das können Sie ganz gut.“ War es ein Lob oder war es Spott? Auf ihrem Pullover zeichneten sich nur zwei kleine Beulen ab, und von einem Hintern war auch nicht viel zu sehen. Sie war wohl mehr mager als schlank. Sie sind der neue Mieter, nicht wahr? Wie heißen Sie überhaupt? Ich nannte meinen Namen. Und sie war Karin Schormann, das nette Fräulein. Wir räumten die Putzsachen weg und wuschen uns gemeinsam im Bad die Hände. „Hier hängt kein
Handtuch von Ihnen.“ Da hingen doch drei. Ich bemerkte die kleinen Namensschilder über den Haken. Das blaue Frotteehandtuch war ihres. Handtücher hatte ich gar nicht dabei.
„Ich habe zwei Dosen mit Makrelenfilets in Tomatensoße. Wenn Sie eine wollen, gebe ich sie Ihnen.“
„Gerne. Ich teile das Brot mit Ihnen.“
„Ach was…“
„Doch, doch…“
Ich folgte ihr in ihr Zimmer. Das Fenster ging hier zur Straße hinaus. Man hörte Autos vorbeifahren. An einer Wand stand ein Wohnzimmerschrank, der aussah wie zwei übereinander gestellte Eisenbahnwaggons. Sonst war es eingerichtet wie meines. Im Ofen brannte ein Feuer. Auf dem Blech daneben waren Briketts gestapelt. Es war angenehm warm bei ihr. Sie ging an den Wohnzimmerschrank und holte eine flache Konserve heraus. Geben Sie mir ein Messer, damit ich das Brot durchschneiden kann. Lassen Sie das. Sie können mir den Fisch oder so etwas Ähnliches am Montag zurückgeben. Ja, aber das Brot möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Es war ja meine Schuld, weil ich die Küchentür so ungestüm… Sie gab mir ein Brotmesser. Wir können zusammen hier essen, wenn Sie wollen. Schneiden Sie Scheiben für uns beide von dem Brot. Auf ihrem Tisch lag eine weiße Decke mit blauen Stickereien. Sie legte einen aus Weiden geflochtenen, flachen Korb darauf. Da sollten die Brotscheiben hinein. Wie ich das Brot schnitt, den Laib auf die Brust gepresst, über den Brotkorb gebeugt, wegen der Krümel, kamen Teller, Gläser und Besteck dazu, eine offene Butterdose und zwei kleine Schalen mit den Fischfilets in Tomatensoße. Ich sah auf, als sie mit einer Flasche am Tisch stand.
„Apfelsaft aus einem Sonderangebot.“ Sie setzte sich auf einen der beiden Stühle und deutete auf den anderen ihr gegenüber. Ich legte das Brot auf den Tisch. Trotz meiner Umsicht, hatte ich das schöne Tischtuch vollgekrümelt. Sie schenkte den Apfelsaft in die Gläser. Umständlich rückte ich meinen Stuhl hin und her bis ich meinte, ihr in richtiger Haltung gegenüber zu sitzen. Jetzt greifen Sie schon zu. Sie hatte kleine Hände. Butterbrot mit Fischfilets in Tomatensoße. Apfelsaft aus einem Sonderangebot. Ich merkte gar nicht,
was ich aß. Haben Sie keinen Hunger? Ihr Gesicht wirkte blass unter den braunen, kurzgeschorenen Haaren. Schmeckt es Ihnen nicht? Sie sah mich fragend an. Blaue Augen. Einen Moment meinte ich, blaue Augen passten nicht zu dunklen Haaren. Sie senkte die Lider. Hatte ich sie angestarrt? Es waren dunkelblaue Augen. Ich kaute mein Brot und nahm einen Schluck Apfelsaft, und sie kaute ihr Brot und nahm einen Schluck Apfelsaft. Ihre Lippen sind zu groß für das schmale Gesicht, dachte ich. Oder doch nicht? Sie würden vielleicht gut küssen. Ich stellte mir vor, wie sie küssten. Sie legte ihre Hand an den Mund, als ob sie meine Gedanken erraten hätte, wischte sich über die Lippen. Möchten Sie noch etwas Apfelsaft? Es sei eine Verschwendung, das Gemüse und das Fleisch, das auf dem Küchenboden lag, wegzuwerfen. Aber Frau Grabowsky habe einen Hygienewahn. Sie schrubbe die Küche jedes Mal, wenn sie gekocht hat, mit einem scharfen Reinigungsmittel, das garantiert alle Bakterien abtötet, stünde auf dem Etikett. Etwas Schmutz und ein paar Bakterien hätte man leicht abwaschen können. Aber solch ein Putzmittel…! Krause Falten huschten um die Nase. Ganz ohne Zorn. Ganz lustig. Ich musste lachen. Auf der Straße fuhren Autos vorbei. Sie drehte sich auf dem Stuhl halb zur Seite und drückte eine Taste eines kleinen Radios. Die Leute, die hier wohnen, seien alle ganz nett. Mit keinem gebe es Streit wegen des Bades oder wegen der Küche. Sie komme mit allen gut aus. Das Radio war warm geworden. Schwebende Geigen im Raum. Das Zwischenspiel aus der Oper Notre Dame von Franz Schmidt. Das einzige Stück dieses Komponisten, das gelegentlich im Radio gespielt wurde. Seine anderen Werke hatte die Welt alle vergessen.
„Ich habe bis jetzt nur den kleinen Walter kennengelernt.“
„Ach, der kleine Walter…“ Sie lachte wieder. Die Falten huschten auch um blinzelnde Augen. Wurden wieder glatt und ernst. „Sein Vater hat sich davongemacht.“
„Der Arme.“
„Seine Mutter habe ich noch nie gesehen. Die ist immer irgendwo auf Arbeit.“
„Der Arme.“
„Hier im Haus hat er keine Freunde, sagt er, weil die Kinder in
seinem Alter zu einer ostpreußischen Familie gehören. Die kann er nicht leiden. Sie verstünden seinen Dialekt nicht. Was ich nicht so richtig glaube. Kinder nehmen doch ganz leicht die Sprache ihrer Umgebung an. Ich bin ja auch ein Flüchtling, wenn auch keine Vertriebene von fünfundvierzig. Seine Mutter erzieht unnötige Ressentiments in ihm, weil sein Vater… “
„Mit einem schamlosen Flüchtlingsweib…“
Wie herrlich das klang. Flüchtlingsweib. Schamlos.
„Sie haben ihn ja getröstet.“
„Die Schraube in seiner Lokomotive.“
„Und die Mark für den Schulbeck.“
„Und Sie mit den Weintrauben.“
„Hat er das erzählt?“
„Ja. Und auch, dass ich mich in das nette Fräulein verlieben sollte.“
Warum sagte ich das? Warum plapperte ich etwas nach, was im Kopf eines siebenjährigen Buben entstanden war? Ich versuchte zu lachen. Sie lachte aber nicht mit. Keine Falten um die Nase und um blinzelnde Augen. Ich half ihr, das Geschirr in die Küche zu tragen und trocknete auch ab, als sie es spülte.
„Danke für den Fisch und den Apfelsaft. Ich werde es wieder gutmachen, das Gemüse und so…“
„Ja.“
Sie stapelte das Geschirr aufeinander und trug es in ihr Zimmer. Eine Gelegenheit, ihr zu helfen, ergab sich nicht. In meinem Zimmer war es kalt. Ich steckte mir eine Zigarette an und legte mich auf mein Bett. In ein nettes Fräulein verlieben oder in ein schamloses Flüchtlingsweib. In ein Flüchtlingsweib. In ein Weib. In ein Schamloses. Oder in die Tochter eines Flüchtlingsweibes. Oder in ein nettes Fräulein, kein Flüchtlingsweib, weil nicht von fünfundvierzig.