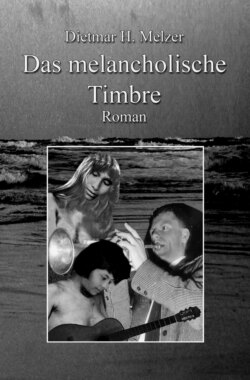Читать книгу Das melancholische Timbre - Dietmar H. Melzer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV Party
Nach der Arbeit ging ich nun noch lieber auf einen Schluck in die Cantina Guernica, um mit Iker zu quatschen, dem großen, blonden Spanier, der kein Spanier sein wollte. Warum nicht?
„Weil Basken keine Spanier sind!“ Die Schwaben, die Sachsen, die Bayern, die Tiroler… Die wären alle Deutsche irgendwie. Aber doch nicht die Ungarn. Und die Kastilianer, die Andalusier, die Galizier, die Katalonier… Die wären eben alle Spanier irgendwie. Aber auf keinen Fall die Basken. Die sind immer ein eigenes Volk geblieben, trotz der Kelten, der Römer, der Vandalen, der Goten… Iker erzählte auch, Jean Christian habe bestimmt, dass der Trompeter Peter Wegner freitags im Jazzkeller spielen sollte und ich samstags. Und ich sollte alle Stücke aufschreiben, die ich spielen konnte, auch wegen der GEMA; der man das alles melden musste, damit die Komponisten ihr Honorar bekämen, und es wäre ganz gut, wenn ich mittwochs zum Proben in den Keller kommen könnte. Klaus Beckstein würde mich diesen Mittwoch um sieben Uhr abholen, ob das bei mir so früh ginge, man würde alle Stücke besprechen und die Arrangements festlegen und proben, die man auf der Hochzeit spielen wollte. Hildrun erwarte Blues und Chicagoer Jatss. Das würde sie ja bekommen. An dem Samstag vor der Feier würden wir aber nur bis elf spielen, damit wir am Sonntag ausgeruht wären. Und Iker erzählte auch, dass das Haus und der Keller darunter Horst Krohn gehörte: Und die Cantina Guernica eigentlich auch.
Am Mittwoch ging ich nach der Arbeit also gleich nach Hause und wartete auf den Schlagzeuger. Kurz vor sieben klopfte es an meiner Tür. Frau Neumeier mit offenen Haaren, kastanienfarben mit grauen Strähnen, in einem schimmernden Kleid, kastanienfarben mit silbernen Streifen und arg kurz für eine Vermieterin, die ein ordentliches Haus mit gesitteten Bewohnern führen wollte. Die fesche Olga. So wie sie aussah, und mit dem Dekolletee, hätte sie auch meinen Jahrgang verrückt machen können. Ich verbiss mir die Bemerkung natürlich. Frau Neumeier konnte so etwas zu mir sagen. Von mir wäre es Spott oder eine Unverschämtheit gewesen. Sie strahlte mich an. Unten wartet ein junger Mann auf Sie. Vielen Dank. Ich strahlte zurück.
Klaus Beckstein saß am Steuer jenes Opels mit dem schrägen Rücken.
„Dein Auto?“
„Nein. Gehört dem Horst.“
Was gehörte dem noch alles?„Jean Christian meint, es sei ein Glück für die Band, dass du zu uns gestoßen bist. Wir hätten nun andere Möglichkeiten. Internationale Chancen…“
„Internationale Chancen? Wie meint er das?“
„Keine Ahnung. Ein Auftritt in Frankreich vielleicht. Jean Christian ist ja ein richtiger Musiker. Hat Musik studiert in Karlsruhe und in Paris. Hat er mal erwähnt. Vielleicht hat er von da her noch Beziehungen.“
„Und der andere Trompeter? Peter Wegner?“
„Peter spielt noch nicht so lange, und er ist froh, wenigstens freitags mit der Band musizieren zu können. Das wird ihm auf jeden Fall helfen, weiter zu kommen.“
„Keine Eifersucht? Eitel Sonnenschein überall?“
Klaus lachte. „Du wirst ja sehen.“ Wir bogen in die Rotebühlstraße ein. Er habe erst im April seine kaufmännische Lehre abgeschlossen, erzählte er, in einer recht großen Firma, die alles mögliche elektrisches Zeugs herstelle, und er sei in dem Bereich tätig, der Zündkerzen für Autos produziere. Ein ganz sicherer Arbeitsplatz in der Auftragsbearbeitung. Autos werde es ja immer geben. Aber er ließe die Stelle sausen, wenn es mit der Musik eine internationale Dingsda… Wenn er mit dem Schlagzeug Geld verdienen könnte. Ich sah zu, wie er aufmerksam auf die Straße schaute, das Fahrzeug lenkte, und doch auf träumerische Art vor sich hinlächelte. Ein kleines, blondes Kerlchen mit blauen Augen. Mit Musik konnte man gelegentlich ganz gut zu Geld kommen, im Fasching mit Rosamunde und Wer soll das bezahlen. Aber das ganze Jahr über und dann mit Jatss?
An diesem Abend war Jean Christian kein Ragtime klimpernder Barmusiker oder ein romantisch verspielter Jazzpianist, sondernein übler Pauker, der uns einzubläuen versuchte, wie unsere Musik auf der Hochzeit zu klingen habe. Stücke mit der Trompete über dem geblasenen Satz von Posaune und Klarinette kamen mir wohl entgegen, aber er wollte alle einmal geprobt haben, und wenn die Klarinette ausbrach oder ich mich verhaspelte, mussten wir die Passage wiederholen. Nicht nur ein Mal. Und dann waren ihm meine Läufe nicht elegant genug. Die musste ich auch wiederholen. Nicht nur einmal. Am Ende hatte ich wunde Lippen und zweifelte, am Sonntag überhaupt mitmachen zu können. Jean Christian ein Schinder! Ein unerbittlicher!
„Was machst du sonst so?“
„Wie?“
„Wenn du keine Musik machst.“
„Isch machche immer Müsike.“
„Franzose?“
„Oui, monsieur.“
„Und warum in Stuttgart?“
„Abgehauen aus Berlin.“
„Berlin ist nicht gerade Frankreich.“
„Ein wenig schon. Ein außergewöhnliches Département, gewiss, der Oberbürgermeister untersteht nicht nur dem französischen Stadtkommandanten, sondern auch dem amerikanischen und dem britischen.“ Er grinste breit. „Ick bin och en Balina.“ Die Sprache der Eingeborenen von Trizonesien hatte er gut gelernt. Obwohl Berlin tatsächlich nicht ganz dazu gehörte. „Ich bin in Berlin aufgewachsen.“, sagte er. Sein Gesicht wurde ernst. „Mein Vater liebt die Deutschen und ist stolz, dass er sie in Berlin vor den Sowjets schützen darf.“
„Glaubst du, er könnte es im Ernstfall?“„In einem neuen Krieg? Sinnlos. Das weißt du so gut wie ich. Mit der Munition, die unseren Generälen zur Verfügung steht, wäre Europa nach deren Einsatz nicht mal mehr ein Ruinenfeld, und im Rest unserer Welt wäre menschliches Leben nirgendwo lebenswert. Jeder Soldat, ob im Ostblock oder in der NATO, müsste jeden Tag daran denken.“ Er trommelte nervös mit den Fingern auf dem Deckel des Klaviers. „Ich hätte auch in die Armee eintreten und Offizier werden sollen. Sinnlos. Sinnlos, wie es immer war, ob Legionär, Landsknecht oder Sansculotte für die Gloire de la Patrie. Nie ist einer von denen für Volk und Vaterland verreckt oder für die Freiheit, sondern immer nur für den König oder für den Kaiser. Für Glanz und Gloria der Herrschenden. Auf keinen Fall wollte ich da mitmachen. Also habe ich nach dem Abitur meine Eltern verlassen. Ehrenwerte, aufrechte Leute in Berlin, die glauben, mit Atombomben die Freiheit zu retten. Meine Mutter steckt mir regelmäßig etwas Geld zu. Das Musikstudium hat mir Onkel Augustin finanziert. Der versteht mich. Mit dem kannst du gut diskutieren über Freiheit und unnütze, gesellschaftliche Zwänge. Die Ehe bedeutet für ihn zum Beispiel Freiheitsberaubung. Wenn Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt wären, müssten sie auch von Fall zu Fall entscheiden dürfen, wann und mit wem sie lieben möchten. Tonton lebt in Juan-les-Pins, in Südfrankreich. Einen Anarchisten hat man ihn schon geschimpft. Dabei hat Freisein mit Anarchie nichts zu tun…“
In der Probe hatte Jean Christian uns gerade Freiheiten genommen. Um keine anarchische Musik zu bieten? In der Musik konnte es eigentlich keine Anarchie geben, weil sie an Tonleitern und Harmonien gebunden war. Das hatte ich damals geglaubt. Und auch in der Liebe, wenn man einmal einander den Körper und die Seele preisgegeben hatte, müsste eine Frau einem Mann für immer gehören und ein Mann für immer einer Frau. Eigentlich.
Am Samstag war nicht viel Publikum im Jatsskähr, weil wir nur bis um elf spielen wollten. Wir trugen die Stücke vor, die Jean Christian für schwierig hielt. Es war eine gelungene Generalprobe, trotz einiger Patzer, die aber im Jazzclub nicht auffielen. So stiegen wir am Sonntag Nachmittag ausgeruht mit unseren Instrumenten in drei Autos, Trommeln und Becken des Schlagzeuges passten in Kofferraum und Rücksitz eines Rekords, der Bass füllte den Innenraum eines Mercedes und ich kam im VW Käfer Jürgen Hersfelds unter. Wir fuhren auf der Bundesstraße nach Böblingen und bogen dort in eine Landstraße Richtung Weil ab. Kurz vor Schaichhof ging es auf einem Feldweg weiter über eine Wiese an einem Bach entlang in einen lichten Wald. Die Villa Schwanenburg, inmitten eines herbstlich verwilderten Gartens um einen silbern blinkenden Teich, kam mir wie ein verwunschenes Schloss vor. Solide wirkende, helle Mauern, große Fenster im ersten Stock, der Eingang unter Säulen, das Stockwerk darüber ein Fachwerkbau mit kleinen Fenstern, Stützholz und Fensterläden blaugrau gestrichen. Efeu rankte von der Nordseite her an das Dach hinauf. Blaugrüne Blätter mit heller Maserung glänzten matt in der schwachen Sonne, die hier oben durch den Nebel brach. Wir fuhren durch ein weit geöffnetes Tor. Ein Mann kam uns entgegen, schwarze Hose, weißes Hemd, eine schwarzweiß gestreifte Weste darüber, so musste ein Diener wohl aussehen, winkte und winkte uns weiter auf einen Platz hinter dem Haus. Da standen schon ein paar andere Autos. Ein Dreihunderter darunter, ein Rolls Royce und an der Hauswand ein kleines MG Cabriolet. Von solch einem hatte ich immer geträumt. Wir mussten eng auf die Wagen auffahren. Es wurden viele Gäste erwartet.
Der Mann führte uns durch einen Seiteneingang in den Saal, in dem der Hochzeitsball stattfinden sollte. Die großen Fenster machten ihn zu einem heiter stimmenden Raum. Rötliche Schatten schimmerten an der hellen Decke zwischen Stuckverzierungen. Die Wände waren in einem ganz blassen Rosa getüncht. Nischen darin mit Skulpturen, eine nackte Frau, ein nackter Mann, ein Paar in erotischer Pose…, dezent bemalt, trotzdem leicht zu sehen, was sonst hinter Wäsche verborgen war. Überdimensionale Ölgemälde hier und dort, ein bunt gekleidetes Paar unter einem Olivenbaum, zwei Damen in hauchdünner Kleidung, hinter ihnen vermummte Soldaten in napoleonischen Uniformen, ein Prinz in Blau mit goldenen Knöpfen und schwarzweißroter Schärpe mit goldenen Fransen, ein Degen an seiner linken Seite… Glitzernde Wandlampen dazwischen. Ein riesiger Kristallkronleuchter an der Decke. Tische in mehreren Reihen vor einer freien Fläche für die Hochzeitstänze. Unser Podium mit einem Klavier dahinter an der Wand. Wir bauten unsere Instrumente auf. Ein anderer Mann kam auf uns zu. Ein Herr. Im Frack und gestärktem Hemd. Wir würden um vier mit unserer Musik beginnen. Etwas dezent, bitte sehr, zum Aperitif. Und dann erst wieder ab neun. Bis drei Uhr in der Nacht. Getränke während unseres Auftritts brächte uns ein bestimmter Kellner, der sich diskret bei uns erkundigen würde. Der Herr bat uns, den Saal zu verlassen, wenn alle Instrumente einsatzbereit seien. Er geleitete uns durch einen Korridor in eine Stube mit zwei blankgescheuerten Tischen, am Fenster blauweiß karierte Gardinen, die Wände halbhoch mit Holz verkleidet, grünlichbraun alles Holz, Fichte vielleicht, auch die Kommode auf der einen Seite, die Tischplatten vielleicht nicht. Der Herr war auf einmal nicht mehr da. Ein anderer an seiner Stelle, gekleidet wie jener auf dem Parkplatz. Was wir trinken möchten. Und er würde uns einen Imbiss servieren. Das Abendessen bekämen wir auch hier um achtzehnuhrdreißig. Wir baten um Bier und bekamen goldbraun geröstete Hähnchenschlegel und eine Art Kartoffelplätzchen dazu. Ich begann zu schwitzen. Unter den Achseln bildeten sich nasse Flecken auf meinem frisch gewaschenen Nylonhemd.
Damen und Herren in festlicher Kleidung, viele Kinder und Jugendliche darunter. Der Saal im Glitzern von Licht und Kristall. Solch einen Anblick kannte ich nur aus Illustrierten. Überwiegend schwarz die Herren, einige dunkelgrau, die Damen cremefarben, hellblau, zartlila in Spitzen und Rüschen und Schleifen, tief geschnittene Dekolletees, glänzende Seide bis zu den Spitzen der Pumps. Manch jüngere Frau trug ein freches Kleid nur bis zu den Knien. Wo kamen die Hochzeitsgäste auf einmal alle her? Sie standen in Gruppen schwatzend und lachend vor den Tischen und auf der Tanzfläche, Sektgläser in der Hand. Kellner balancierten auf silbernen Tabletts den Nachschub herbei. Die Tische waren mit goldenem Besteck und weißem Porzellan gedeckt. Wir begannen mit gestopfter Trompete. How High Is The Moon. In einer der Gruppen sah ich die Dame Hildrun von Hohenberg. Sie beachtete uns Musiker nicht. Wir spielten unsere Nachmittagsrunde gedämpft, beschwingt, nicht allzu schnell, obwohl das Schwatzen und Lachen immer lauter wurde. Die Braut trug ein langes, weißes, züchtig geschlossenes Kleid. Dunkle Locken quollen unter dem Schleier hervor. Sie hatte ein blasses, vornehmes Gesicht.
In der Stube bekamen wir Salate zu essen, einen Teller mit kleinen, rothäutigen Tieren in einem schweren Öl, deren Fleisch süßlich schmeckte, Crevettes nannte Jean Christian die Kreaturen, dann gebratene Fleischstücke, die Jean Christian als von einem Reh stammend erkennen wollte, fadendünne Bohnen und Kroketten in einer dunklen Soße dabei. Danach wollte ich nichts mehr von den Gerichten, die noch angeboten wurden, auch keinen Käse, keinen Mousse au chocolat, keinen Pfirsich. Die Freunde überredeten mich, wenigstens Mangoscheiben in Champagner zu probieren. Die Pause bis um neun Uhr brauchte ich sehr wohl, damit sich mein Bauch mit den ungewohnten Speisen anfreunden konnte. Ich fühlte mich müde und schwer, als wir mit unserem Jazz zum Tanz begannen. Richard Wagners Brautchor, Treulich geführt, hatte man schon von einem Tonband abgespielt und den Walzer zur Eröffnung auch, den Donauwalzer von Johann Strauß.
Wir begannen mit dem Stück I’m In The Mood For Love. Die Tanzfläche war sofort voll. Ein Tänzer sprang mir sofort ins Auge, weil er einen weißen Smoking trug. Ich war überrascht, Horst Krohn hier zu sehen. Und dann war ich auf einmal hellwach. Er tanzte mit Nina!
Ein kurzes, rauchblaues Kleid aus durchsichtig scheinenden Spitzen auf erregend gerundetem Elfenbein. Ihr Haar flog davon bei jeder Drehung und der rasant auffliegende Rock zeigte ihre Beine bis zu den Strapsen hinauf. Ich versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erheischen, wenn ein anderer seinen Chorus hatte. Sie bemerkte es aber nicht. Als ob sie noch nie im Jazzkäher gewesen wäre und niemanden von der Band kannte und niemals mit mir vor dem warmen Kachelofen…, streiften ihre Blicke gelegentlich gleichgültig über uns Musiker hinweg. Und auch Horst Krohn tat so, als kannte er uns nicht.
„Idiot“, zischte mir jemand ins Ohr. „Konzentrier dich auf dein Spiel!“ Jean Christian hatte sich nach einem breiten, hingehauenen Akkord erhoben, sich tänzelnd zu mir gedreht, so erzählte man mir später, um mir verbal in den Arsch zu treten. Alle lachten nach dem Auftritt. Es hätte ausgesehen, als gehörte dies zu unserer Show. Nach Jean Christians Rüffel wurde ich wütend und blies scharf in das Horn. Stormy Weather, im Satz, Rüdiger Vollmer mit dem Altsaxophon anstatt der Klarinette. Die Gäste an den Tischen wurden lauter, und auf der Tanzfläche ging es frivol zu. Um Mitternacht mochte man glauben, in einem Bierzelt unter besoffenen Proletariern zu sein, in derbem Gelächter und Schreien und Keifen, und Hildegard von Hohenberg winkte uns nun einmal, Träger ihres Kleides waren noch keine gerissen, und Tänzerinnen und Tänzer mit obszönen Bewegungen und Schritten und Handgreiflichkeiten schienen aus einer Hafenkaschemme zu sein anstatt aus vornehmem Haus. Kinder und Jugendliche waren schon lange nicht mehr im Publikum, und Horst Krohn war verschwunden – und auch meine Nina Kornasow. Um halb drei ging ich vor der letzten Runde aufs Klo und sah in einem Gang, wie ein Herr seiner Dame den Rock gehoben und seine Hand zwischen ihre Beine geschoben hatte und hörte, wie sie jauchzte. Und ich sah in der Stube, in der wir gegessen hatten, eine Dame mit geöffneten Beinen auf einer der blankgeschliffenen Tischplatten sitzen und einen Herrn davor, die Hose herunter gelassen. Von denen konnte man nichts hören. Sich vielleicht nur lautes Atmen vorstellen. Und eine Dame tanzte in der letzten Runde mit nacktem Oberkörper vor unserer Bühne und ließ ihre Brüste im Rhythmus kreisen. Wir spielten When It’s Sleeping Time Down South. Nachdem wir unsere Instrumente versorgt hatten, bat uns jener Herr im Frack in die Stube, um uns das Honorar zu bezahlen, abgezählt in kleinen Scheinen, so dass jeder von uns dreihundertdreiunddreißig Mark bekam. Eine Mark mehr für Jean Christian. Ich schaute dauernd auf die eine Tischplatte, ob da Schweiß und Flecken zu sehen waren. Auf dem Heimweg drückten Himmelsgewichte meinen Brustkorb zusammen. Mein Herz, eingeklemmt zwischen Wut und Enttäuschung, schien platzen zu wollen. Nicht wegen der Damen und Herren der vornehmen Gesellschaft, die nicht so sittsam wie die gerade verheiratete Enkelin waren. Warum hätte man sonst seinerzeit den Keuschheitsgürtel erfunden? Den unnützen, weil Minnesänger und Gärtner Nachschlüssel hatten. Mich drückten Gurren, Elfenbein und Augenbraun. Te quiero, nicht im deutschen Sinn, im Sinn…
Am Montag war ich müde und depressiv gestimmt, so richtig in black and blue, und konnte mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Es gab ziemliche Aufregung wegen einer Herta Bernauer. Sie hatte die Firma beschissen, den Akkord überzogen und die Vorgabe geändert. Bei der Kontrolle der Stempelkarte war es aufgefallen. Ob ich es nicht gesehen hätte. Natürlich hatte ich. Aus einer drei eine Fünf, die dumme Frau, mit der Farbe eines anderen Kugelschreibers. An die gestempelte Zeit hatte ich nicht gedacht, als ich den Lohnschein ablegte. Herta Bernauer rauschte in wehendem Glockenrock an mir vorbei zu Herrn Burian. Als sie meine Neugierde bemerkte, drehte sie sich zu mir um. Blonde Locken, ein trotziges Gesicht und ein Blick voller Verachtung aus graublauen Augen. Für sie musste ich der Scheißkerl sein, der sie hatte auffliegen lassen. Bei Büroschluss rügte Herr Burian mich. Ich würde doch dafür bezahlt, solche Unregelmäßigkeit nicht zu übersehen.
Eine Welt voller Ungerechtigkeiten!
Wenigstens konnte ich am Abend Frau Neumeier die halbe Miete für den Oktober und gleich die ganze für den November bezahlen. Und eine Mark dazu für ein heißes Bad, das ich danach brauchte. Von dem Honorar blieb noch viel übrig. Wüsste sie vielleicht, wo man ein gebrauchtes Radio mit einem guten Klang und einen Plattenspieler her bekäme? Sie wolle Herrn Becker danach fragen, sagte Frau Neumeier, die heute eine graue Kittelschürze trug. Andere Mütter hätten auch schöne Töchter, meinte Klaus Beckstein, als er mich am Mittwoch abholte. Im Auto von Horst Krohn. Die Kornasow sei eigentlich seit längerer Zeit schon dessen Freundin. Bei der Probe tadelte mich Jean Christian. Verkrachte Liebesbeziehungen würden einem echten Musiker die Lust zur Musik nicht vermiesen. Sie würden ihn beflügeln, inspirieren, je größer das Liebesleid, desto mitreißender seine Musik. Ich kam mir aber wie gelähmt vor. Litt ich wegen Nina? War ich enttäuscht? Ich fühlte mich irgendwie Blue. Wie black and blue. Ach ja, warum nicht Fats Wallers Komposition Black And Blue? Die Trompete über dem getragenen Satz von Posaune und Saxophon. Das Stück hatte am Samstag so gefallen, dass wir es dreimal spielen mussten. What dit I do, to feel so black and blue… Nina war nicht in den Jatsskäher gekommen. Und Horst Krohn regierte das Lokal souverän von der Theke aus. Ich kannte ihn nicht anders. Nach dem Konzert begaben wir uns zu den Abschiedsbieren zu ihm hinauf. Alle Getränke gingen aufs Haus. Und da ich nun festes Mitglied der Jazzband sei, wäre ich auch am Umsatz beteiligt. Er schob mir dreißig Mark zu. Ich sah auch meine Freunde Geldscheine einstecken. Etwas verlegen, aber doch erfreut, nahm ich das Geld an mich. Mal ist es mehr, aber es war schon viel weniger, lachte Jürgen Hersfeld. Letzten Samstag hätte ich es, weil ich ein Gastmusiker war, nicht mitbekommen. Wir stießen die Biergläser aneinander. Meine Gehaltsabrechnung war mir am Freitag auf den Schreibtisch gelegt worden. Netto zweihundertsiebzig Mark für die vierzehn Tage. Nach der Einstellung bei Pfleiderer und Sohn hatte mir die Bank für Gemeinwirtschaft einen Brief geschickt. Wenn ich das Gehaltskonto bei ihnen eröffnete, würden Sie mir ein Startkapital von fünf Mark gutschreiben. Dieses Angebot hatte ich angenommen. Am Montag würde ich den Kontoauszug mit meinem ersten zivil verdienten Gehalt bekommen. Aber ich hatte mal wieder eine Freundin verloren. War sie überhaupt meine Freundin gewesen? Für einen Abend. Für eine Nacht. War es möglich, wollüstig zu sein, ohne zu lieben? Mit dem Jatss und der Arbeit kamen mir meine Zukunftsaussichten indes nicht so übel vor.
Gelegentlich traf ich Fräulein Schormann. Auf dem Weg zum Bad trug sie einmal ein dünnes Leibchen. Wir wechselten ein paar Worte. Wie geht’s. Bei einer Bewegung wellte sich der Stoff und gab einen Blick auf eine ihrer Brüste frei. Kleine Brüste. Ich benützte noch immer ihr Handtuch, wenn ich mich wusch oder mich badete. Sie schien es nicht zu merken. Bevor ich ein Radio kaufte, musste ich mir unbedingt ein paar Handtücher besorgen. Im Treppenhaus hatte sie einmal enge, röhrenförmige Hosen an. Sie erinnerten mich an Arbeiterkleidung, schienen in Mode zu kommen, besonders bei Leuten, die jünger als sie und ich waren.
Eines Abends lief ich Frau Grabowsky in die Arme. Eine kräftige Frau mit stämmigen Beinen in einem grauen Kleid. Sie hatte eine laute Stimme, und ich wunderte mich, sie noch nie gehört zu haben. Alle benützten die Küche, aber niemand putze sie richtig. Ob ich sie denn schon mal gereinigt hätte. Warum? Ich war nur einmal in der Küche gewesen, um beim Abtrocknen zu helfen. Sie schüt-telte missbilligend den Kopf. Ich konnte in mein Zimmer entkommen.
Die Tage wurden immer kürzer. Man ging im Dunkeln zur Arbeit und kam im Dunkeln zurück. Mitte November wurde der Nebel so dicht, dass Straßenbeleuchtung und Autoscheinwerfer ihn kaum durchdringen konnten und man als Fußgänger leicht die Orientierung verlor. Restaurants und Kneipen waren abends voller Menschen, und auch im Jatsskäher drängten sich viel mehr Leute als zuvor. Flaschen und Gläser mussten mit Rufen und Schubsen zu den Gästen balanciert werden. In dieser Nacht reichte Horst Krohn jedem von uns Musikern vierzig Mark über die Theke.
Der Mittwoch darauf war Buß- und Bettag, an dem keine Probe stattfinden sollte. Horst Krohn hatte stattdessen zu einer Party in seine Wohnung im Dachgeschoss des Hauses geladen, in dessen Keller wir den Jatss feierten. Jürgen Hersfeld holte mich mit seinem VW Käfer ab.
„Willkommen im Haus von ehemals ehrlich überzeugten Nazischweinen“, begrüßte er uns mit theatralischer Pose an seiner Wohnungstür. „Vor dem Geruch von Toten braucht ihr euch nicht zu ekeln. Frau Doktor Krohn und Herr Professor Krohn haben ihre Taten in Ravensburg vollbracht, alles für die Wissenschaft, nur unwertes Leben ist verschieden. Und die Überlebenden werden nun von ihnen mit Medikamenten gegen ihre leiblichen und seelischen Schmerzen behandelt. Ich darf das jeden Tag sagen. Ihr aber nicht, weil ihr sonst Ärger mit Anwälten bekommt, die auf solche Verleumdungen spezialisiert sind.“
Er führte ein Glas zum Mund und trank es leer. Whisky. Es war sicher nicht der erste heute Abend. Schwankend ging er voraus. Wir betraten eine geräumige, mit vielen kleinen Lampen beleuchtete Diele, deren Wände und Decke mit beige gestrichener Raufaser tapeziert waren. Grässliche Bilder hingen hier, verzerrte Gestalten mit schrecklichen Gesichtern, ähnlich wie in der Cantina Guernica, und einige plastische Werke aus Gips, grell mit Ölfarben beschmiert, Drahtnetze und Nägel und anderes Zeug darin eingear-arbeitet. Wenn das Kunst sein sollte…! Wir stiegen über die Beine eines jungen Mannes, der an der Wand gelehnt saß, ein Glas neben sich auf dem Boden. Alle anderen Partygäste befanden sich hinter dem Bogengang in einem großen, schwach beleuchteten Raum, dessen Decke der Giebel des Hauses war. Sie kauerten auf Kissen und niedrigen Bänken an den Wänden, Mädchen, Frauen, Jungen, Männer, und ich fragte mich, ob man am Gesicht oder am Körper erkennen könne, ob ein Mädchen Frau oder eine Frau Mädchen war und ob unter den Jungen, Männern, auch Jungmänner waren. Als Jungmann fühlte ich mich natürlich nicht, wegen der Brigach und des Grünen Baumes und – ach ja – des Teppichs an einem warmen Kachelofen. Das tat alles weh, aber es gab einem Sicherheit unter so vielen Fremden. Ein Junge, ein Mann, ein junger Mann stand aufrecht in der Mitte und trug etwas vor:
„An den Wintermond
Dein Licht trifft den Pfad
Mit silbernem Schein
Aus Dunkel erwacht Wald
Und möchte verzaubert sein.
Dein gütiges Mondgesicht scheint
Durch’s Geäst in die kalte Welt
Der Schnee dankt es mit Funkeln
Hinauf zum Himmelszelt.
Angeber! Du selbst leuchtest gar nicht
Bist nur aus totem Gestein
Und mein Bruder wird bald einmal
Über deine Nase gelaufen sein.
Doch zu spät ist’s für kluge Gedanken
Deine Magie hat mich gefangen
Dich hätt’ die Geliebte ja auch gesehen
Wäre sie nur an das Fenster gegangen.“
Von den Partygästen hörte man murmeln, vielleicht anerkennende Zustimmung, einige klatschten gar. Der junge Mann verbeugte sich und trat zur Seite. Eine Frau war auf einmal in der Mitte. Kein Mädchen. Eine Frau. Nicht ganz jung. Wo war Horst Krohn geblieben? Und Jürgen Hersfeld war auch irgendwo. Jemand reichte mir ein Glas mit einem komisch, säuerlich schmeckendem Getränk. Tequila mit Limonen, erfuhr ich. Die Frau hatte lange, dunkle Haare, runde Augen und eine scharfe Nase, was mich an eine Eule denken ließ. In dem Schummerlicht war nicht zu erkennen, wie alt sie war, zumal sie ihren Körper unter weit fallenden Stoffen und Wolle verbarg. Aber was sie mit dunkler Stimme nun vortrug, weckte erregende Fantasien:
„Frühling
Nackt wat ich den Bach stromauf
Auf glatten Steinen durch die Flut
Das munt’re Rauschen nimmt mich auf
Die linden Lüfte tun so gut
Die Sonne fühl ich auf der Haut
Und prickelnd kalt des Wassers Fließen
Der Erde Moder wird vertraut
Und überall lichtgrünes Sprießen.
Meine Brüste will ich schenken, meinen Schoß
Auf jener grünen Wiese dort
Und Lippen, Atem, Salz ich kos
Wir lieben uns, o Frühling, immer fort.“
Für die anderen war dies offenbar auch ein aufregendes Gedicht. Sie klatschten und lachten, manche Lacher klangen wie auf der Hochzeit im Schönbucher Wald. Mussten erregende Vorstellungen vulgär sein? Die Frau schaute sich im Raum um. Suchte sie einen Platz? Sie kam auf mich zu. Tatsächlich war neben mir etwas frei. Ich rutschte zur Seite. Sie hockte sich hin, die Beine im Schneidersitz geöffnet, ihr dunkler Rock darüber, und nahm mir mein Glas aus der Hand. Sie trank einen Schluck. Dann wies sie mit dem Glas in den Raum. Ich sah Iker dort stehen. In Baskisch hätten ihn keiner verstanden. Aber sein Gedicht in Spanisch auch nicht viele.
„De una del mar gris
Te regalo mi voz
Te regalo mi cuerpo
Te regalo mi sangre
Te regalo mi corazón
Te regalo mi dolor
Y un rayon illusiónes.”
In ein paar Stunden Volkshochschule und bei dem Chilenen hatte
ich nicht viel gelernt, doch verstand ich, eine am grauen Meer schenkte einem ihre Stimme, ihren Körper, ihr Blut, ihr Herz, ihren Schmerz und Illusionen dazu. Das war ebenfalls aufregend, fand auch die Frau an meiner Seite, die mit dunklem Ah dem Text zustimmte und an meinem Glas nippte. Sie stieß mir dabei ihren Ellenbogen in die Seite. Ich hielt unwillkürlich ihren Arm fest. Überrascht wandte sie sich mir zu. Ein Eulengesicht mit zwei Falten zwischen den runden Augen und einem vollen Kussmund unter der scharfen Nase. Sie zog ihren Arm nicht zurück, sondern drehte ihren Körper zu mir, im Schneidersitz, das Glas balancierend, und stützte sich mit ihrem spitzen Ellenbogen auf meinem Schenkel ab.
Das konnte ich tapfer ertragen. „Wo kann man sich hier etwas zu trinken besorgen?“ fragte ich.
„Ach!“ Sie gab mir mein Glas zurück. Es war leer.
„Komm mit. Ich weiß wo.“
Noch einmal der spitze Ellenbogen. Die Gedichtstunde schien beendet zu sein. Musik war zu hören. Edith Piaf sang Je ne regrette rien. Ich folgte der Frau an schmusend tanzenden Paaren vorbei. Eine Glasfront führte auf eine Dachterrasse hinaus. Durch geöffnete Türen wehte ein kalter Hauch herein. Die Lichter der Stadt schimmerten durch den Nebel. Straßenlärm drang herauf. Wir kamen in die Küche. Einen Augenblick blendete das helle Licht. Ein paar Leute schwatzten vor dem Kühlschrank. Sein Inneres war mit dickem Eis überzogen weil er dauernd geöffnet wurde. Und jetzt von der Frau natürlich. Wie hieß sie denn? Ursula. Bier und Wein gab es in dem Eis und Whisky und Wodka und sonst noch Getränke, die ich nicht kannte, und auf einer Anrichte neben dem Kühlschrank standen unzählige Gläser, große und kleine und unzählige Flaschen mit bunten Etiketten und buntem Inhalt, rot und blau und weiß… Ich sei der neue Trompeter. Ja. Ein Bier hätte ich gerne. Sie mochte am liebsten Tequila mit Limonen. Um ihren Mund waren winzige Falten. Die Tusche um die Augen war verschmiert.
„Hast du dein Gedicht selbst geschrieben?“
„Ja.“
„Ganz schön gewagt.“
„Was ist gewagt daran?“
„Brüste und Schoß schenken…“
„Was ist gewagt daran?“
„Dass du es sagst – und wie…“
„Von Liebeslust zu sprechen und zu schreiben finde ich nicht gewagt. Es ist Freiheit, darüber zu reden und zu schreiben. Man sollte es nicht unterdrücken. Über das Wie kann man natürlich diskutieren.“
Wir wanderten durch die Wohnung. Um uns tanzende Paare zur Musik. Bert Kämpfert mit schmeichelnden Trompeten. Überall mussten Lautsprecher versteckt sein. In einem Erker sah ich das Bild. Dezent beleuchtet. Alles in Elfenbein. Nur die Brustwarzen braun. Nackt vor dem Kachelofen. Nina. So nah. So groß. Als ob sie vor mir stünde. Ich musste meinen Arm zurückhalten, meine Hand. Nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche. Ich hätte ihr Haar gestreichelt, ihre Wangen, ihren Mund, ihre Schultern und alles… Und alles nur Farbe. Mir wurde heiß. Ich fühlte, wie ich rot wurde.
„Ich glaube, du kennst sie, Nina Kornasow“, hörte ich Ursulas dunkle Stimme, „die Freundin von Horst.“
„Ja. Ein wenig.“
„Horst hat auch von mir solch einen Akt gemalt. Im Wohnzimmer da hinten, im Licht der Dachterrasse. Wir waren mal zusammen. Danach hab ich ihm das Bild für tausend Mark abgekauft.“
Das lenkte mich von Nina ab. Ich betrachtete Ursula und versuchte, mit Fantasie den vielen Stoff um sie herum hinwegzuzaubern. Gewiss hatte sie nicht Ninas göttliche Figur. Sie war ja auch älter. Es würde alles nicht so fest sein. Fraulich. Weiblich. Musste nicht göttlich sein.
Ich sah in ihren Eulenaugen, dass sie sah, was ich dachte. Sie verzog ihren Mund zu einem breiten Lachen. „Horst hätte das Bild möglicherweise im Jazzkeller aufgehängt. Dass es irgendwo in seiner Wohnung blieb, wollte ich auch nicht. Ich habe nichts dagegen, nackt zu sein, in einem Bach und auf einer Wiese bin ich das gern, wie ich vorgetragen habe. Aber so lange ich lebe, möchte ich wissen, wer mich so ganz nah betrachtet.“
Jedenfalls konnte Horst Krohn auch schöne Bilder malen. An der gegenüberliegenden Wand hing aber wieder ein abscheuliches. Ein hässliches Männergesicht in verschmierten Farben.
„Das ist der weinende Mann“, sagte Ursula.
„Warum weint er denn?“
„Weil er die Welt scheiße findet.“
„Hätte er besser eine schöne Frau gemalt, die weint.“
„Frauen weinen nicht über die Welt, über ein totes Kind gewiss oder über einen Mann vielleicht…“
Auf einmal wurde die Musik von lärmendem Aufruhr übertönt. Die tanzenden Paare lösten sich und die am Boden kauernden, quatschenden oder schmusenden gingen auseinander. Horst Krohn torkelte herein. „Ich lebe wie es mir gefällt!“, schrie er. „Ich kenne keinen Zwang und keine Gesetze!“ Nina war bei ihm. Sie versuchte ihn zu umarmen, ihn fest zu halten. Er schüttelte sich und stieß sie heftig von sich. Sie stürzte zu Boden. „Ich bin Horst Krohn, der Freie!“, schrie er weiter. „Jubelt mir zu! Über mir ist niemand. Und unter mir der ganze Rest der Welt.“ Sein Bart zitterte. „Und unter dem Rest der Welt sind noch Frau Doktor und Herr Professor, Beschützer der Arier vor rassischer Verschmutzung! Die waren so blöd und wussten gar nicht, was arisch bedeutet…!“
Er hatte verrückte Augen. Zuviel getrunken?
„Der hat sich noch irgendein Zeug reingezogen.“
Nina war wieder bei ihm. Ihr Gesicht gerötet und ihre Haare nass. Warum trug sie nur einen Bademantel? Sie redete auf ihn ein. Beruhige dich. Beruhige dich. Es gelang ihr, Horst aus dem Kreis der Partygäste in ein anderes Zimmer zu ziehen. Einige lachten. Die meisten schwiegen verlegen. Die Musik wurde indes wieder allgegenwärtig. Come prima, come prima, sang der Italiener Tony Dallara. Musik zum Schmusen. Ich tanzte mit Ursula. Sie war schmiegsam. Jeden Schritt und jede Bewegung fühlten wir, als ob wir ein Körper wären. Ihr wurde warm, und sie zog ihren Pullover aus. So konnte ich mehr von ihr spüren. Und wir wogen uns weiter
im Takt, die Platters sangen Only you und Dietmar Schönherr hauchte, Ich suche die Liebe und finde sie nicht. Der Hausherr war
betrunken in irgendeinem Zimmer. Die Party ging trotzdem weiter. Betrunken waren dann auch noch andere Gäste und voll mit Zeug, wie Ursula bemerkte. Das kümmerte mich nicht. Ich wollte nur unsere simultanen Bewegungen spüren.
„Ich bin eigentlich kein Nachtmensch“, sagte sie irgendwann. Ob ich sie nach Hause bringen soll. Nein. Sie gehe jetzt lieber allein. Wir würden uns am Samstag im Jatsskäher sehen, vielleicht, und wenn ich sie dann immer noch so drücken wolle, könnten wir uns mal treffen, vielleicht… Sie küsste mich auf die Wange. Ich hielt eine Weile ihr Gesicht fest. Eulengesicht. Die Falten um den Mund konnte ich nicht mehr sehen. Nur den Kussmund. Sie strich sanft über meine Haare, bevor sie sich zur Seite drehte und ich allein unter den tanzenden Paaren war. Ella Fitzgerald sang Baby it’s cold outside. Ich ging in die Küche, um mir ein Bier zu holen. Ein paar Leute standen da um einen Tisch mit Gläsern und Flaschen in den Händen. Die Nazis hätten pseudowissenschaftliche Thesen über die Arier in ihr Glaubensbekenntnis aufgenommen, hörte ich da und blieb bei der Gruppe stehen. Weder stammten die Arier aus Norddeutschland noch seien sie blond und blauäugig gewesen. Wahrscheinlich seien sie aus Zentralasien nach Indien eingewandert. Ob sie das indogermanische Urvolk gewesen wären, könne man nicht sicher sagen. Aber das Sanskrit, das Iranisch, das Lateinisch, das Germanisch, das Slawisch, das Griechisch, also alle europäischen Sprachen außer Baskisch, Ungarisch und Finnisch, stammten von der arischen Sprache ab. Jeder Perser und die meisten Inder hätte also einen amtlichen Ariernachweis bei den Nazis bekommen müssen. Die Leute lachten grölend und stießen Gläser und Flaschen aneinander. Nachdem das geklärt war, nahm ich einen großen Schluck aus der Bierflasche. Ich versuchte Jürgen Hersfeld zu finden, entdeckte ihn aber nirgendwo. Er sei schon weggegangen, sagte man mir, mit Bärbel Reisnauer. Wer das war? Ich kannte ja fast niemanden hier, außer… Jürgen hätte mich mitnehmen können. Aber er wollte vielleicht mit Bärbel Reisnauer allein sein. Dabei war er verheiratet und hatte zwei Töchter. Wie spät war es? Oder wie früh? Unter einem Berg von Kleidern fand ich meinen Mantel. Viel zu dünn für diese nasskalte Jahreszeit.
Aber ich marschierte so stramm durch die Stadt, dass ich ins Schwitzen kam. Wie still die Stadt am frühen Morgen sein konnte. Es war nicht so weit bis in meine Wohnung. Marschieren war ich gewohnt. Es klopfte an meiner Tür, nachdem ich gerade eingeschlafen war, und duftender Kaffee wurde mir auf den Tisch gestellt.
Im Büro schwirrten mir die Zahlen der Lohnscheine vor den Augen. In der Spulenwicklerei und in der Montage arbeiteten überwiegend Frauen im Akkord, im Großgerätebau überwiegend Männer. Es fiel mir schwer an diesem Donnerstag, bei den Akkordüberschreitungen, die ich bei Frauen und Männern gerecht gleichmäßig durchgehen ließ, keine aus Versehen zusätzlich passieren zu lassen. Die Heftigkeit der eventuellen Rüge wollte ich schon selbst bestimmen.