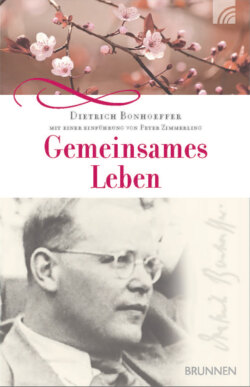Читать книгу Gemeinsames Leben - Dietrich Bonhoeffer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eigenart
ОглавлениеDas „Gemeinsame Leben“ ist weit mehr als ein Erfahrungsbericht vom geistlichen Leben einer Theologengemeinschaft.17 Es ist ein geistliches Übungsbuch, ein Exerzitienbuch für die evangelische Kirche insgesamt, das in der Nachfolge von so berühmten christlichen Exerzitienbüchern wie der Regel des Benediktinerordens, der „Nachfolge Christi“ von Thomas à Kempis und den „Exerzitien“ von Ignatius von Loyola steht. Ganz neu für die evangelische Kirche ist, dass Bonhoeffer in seinem „Gemeinsamen Leben“ den Versuch unternimmt, eben nicht nur die Gestaltung des persönlichen geistlichen Lebens, sondern auch die des gemeinsamen geistlichen Lebens zu bedenken. Schon im Vorwort weist er ausdrücklich darauf hin, dass er der Kirche als Ganzer mit seinen Überlegungen dienen will. „Da es sich nicht um eine Angelegenheit privater Zirkel, sondern um eine der Kirche gestellte Aufgabe handelt, geht es auch nicht um mehr oder weniger zufällige Einzellösungen, sondern um eine gemeinsame kirchliche Verantwortung.“ Bonhoeffer ist sich der vielen Vorbehalte bewusst, die dieser Aufgabe entgegenstehen, und fährt deshalb fort: „Die begreifliche Zurückhaltung in der Behandlung dieser kaum neu erfassten Aufgabe muss allmählich einer kirchlichen Bereitschaft zur Mithilfe weichen.“ Auch wenn der ursprüngliche Sitz im Leben der im Buch beschriebenen geistlichen Übungen eine Theologengemeinschaft war, entfaltet Bonhoeffer seine Überlegungen im Hinblick auf weitere Formen christlicher Gemeinschaft und damit der Kirche insgesamt, z. B. einer christlichen Hausgemeinschaft, einer Familie und unterschiedlicher Formen von Bruderschaften, die nur auf Zeit zusammenleben.
Bonhoeffer geht davon aus, dass die geistliche Übung für jeden Christen unerlässlich ist, weil sie dem Glauben zur Gestaltwerdung verhilft. Geistliche Übungen stellen die Gnade, die Gott dem Menschen im Glauben an Jesus Christus schenkt, in keiner Weise infrage – im Gegenteil. Gegenüber Bonhoeffers Plädoyer für die Notwendigkeit spiritueller Übungen wurde schon bald der Vorwurf der Gesetzlichkeit erhoben. Die Kritik Karl Barths ist das prominenteste Beispiel dafür. Nach der Lektüre der Finkenwalder „Anleitung zur Schriftmeditation“18 schrieb er: „Und wiederum störte mich in jenem Schriftstück ein schwer zu definierender Geruch eines klösterlichen Eros und Pathos …“19 Für Bonhoeffer schwächt die spirituelle Übung den Geschenkcharakter des Glaubens nicht, sondern lässt ihn erst zur persönlichen Erfahrung werden und so zur Entfaltung kommen. In einem Brief an Karl Barth vom 19.9.1936 hält Bonhoeffer fest: „Daß aber sowohl theologische Arbeit wie auch wirkliche seelsorgerliche Gemeinschaft nur erwachsen kann in einem Leben, das durch morgendliche und abendliche Sammlung um das Wort, durch feste Gebetszeit bestimmt ist, ist gewiß […]. Der Vorwurf, das sei gesetzlich, trifft mich wirklich gar nicht. Was soll daran wirklich gesetzlich sein, daß ein Christ sich anschickt zu lernen, was beten ist und an dieses Lernen einen guten Teil seiner Zeit setzt?“20
Im Grunde geht es Bonhoeffer im „Gemeinsamen Leben“ darum zu zeigen, wie die Rechtfertigungslehre einem evangelischen Christen sowohl als Einzelnem als auch in der Gemeinschaft zur Sache der Erfahrung werden kann. Dazu knüpft er an die spirituellen Erfahrungen katholischer Orden an – sie galten und gelten als Fachleute für Spiritualität – und macht diese für evangelische Frömmigkeit fruchtbar. Bonhoeffer ist überzeugt, dass jeder Christ ein verbindliches geistliches Leben nötig hat. Denn nicht nur der innere Glaube wirkt sich auf das äußere Verhalten aus, sondern genauso hat das äußere Verhalten Auswirkungen auf den inneren Glauben. Geistliche Übungen und ein lebendiger Glaube bedingen sich gegenseitig. Die im „Gemeinsamen Leben“ entfalteten geistlichen Übungen sind mit der traditionellen evangelischen Spiritualität kompatibel. Bonhoeffer formuliert seine Überlegungen ausdrücklich im Anschluss an die reformatorische Spiritualität Martin Luthers. An vielen Stellen nimmt er Ausführungen aus dessen Katechismen und dessen „Sermon vom hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leichnams Christi“21 auf und setzt diese in Beziehung zur „Imitatio Christi“ von Thomas à Kempis.
Der Aufbau des „Gemeinsamen Lebens“ zeigt, dass Bonhoeffer das geistliche Grundgesetz, das Frère Roger Schutz von Taizé nach dem Zweiten Weltkrieg mit der griffigen Formel „Kampf und Kontemplation“ weltweit bekannt machte, bereits in Finkenwalde erkannte. Der Dienst als Ziel christlicher Existenz wird flankiert von Überlegungen zum gemeinsamen und einsamen Tag bzw. zur Beichte und zum Abendmahl. Schon im Antrag auf Errichtung des Bruderhauses hatte Bonhoeffer 1935 formuliert: „Nicht klösterliche Abgeschiedenheit, sondern innerste Konzentration für den Dienst nach außen ist das Ziel.“22 Im „Gemeinsamen Leben“ zeigt er, dass das gelebte Christsein der geistlichen Sammlung bedarf, wenn es nicht zum bloßen Versuch der Weltverbesserung verwässern soll.