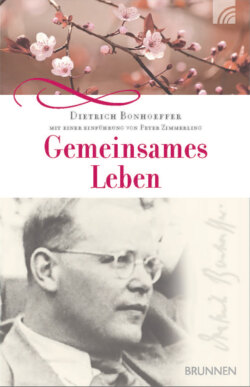Читать книгу Gemeinsames Leben - Dietrich Bonhoeffer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zum Inhalt
ОглавлениеDie Themen der einzelnen Kapitel des „Gemeinsamen Lebens“ sind: Gemeinschaft, der gemeinsame Tag, der einsame Tag, der Dienst, Beichte und Abendmahl. Zentrale Formen der Spiritualität sind dabei Andacht, Gebet, Bibellese, Beichte und Abendmahl.
Die Morgen-, Mittags- und Abendandachten strukturieren den Tagesablauf. Bonhoeffer knüpft hier an die Vorstellung der Hauskirche Martin Luthers an. Jahrhundertelang bildete im Luthertum neben dem Sonntagsgottesdienst die tägliche häusliche Andacht die zweite Säule evangelischer Spiritualität. Die Andachten sollen nach Bonhoeffer Psalmgebet, Schriftlesung, Lied, Gebet und Fürbitte enthalten. Der von Bonhoeffer vorgeschlagene Ablauf der Andachten ist Luthers Gottesdienstverständnis verpflichtet. Das Wesen des evangelischen Gottesdienstes besteht nach dem Reformator in der Anrede Gottes an den Menschen und in dessen Antwort an Gott. In seiner Predigt anlässlich der Einweihung der ersten neu gebauten evangelischen Kirche, der Schlosskirche zu Torgau an der Elbe am 5. Oktober 1544, hielt Luther fest: „Meine lieben Freunde, wir wollen jetzt dies neue Haus einsegnen und unserem Herrn Jesus Christus weihen. […] dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang.“23
Durch seine eigene Beschäftigung mit der Musik in Theorie und Praxis und durch seine Vorliebe für den Psalmengesang war Bonhoeffer die Bedeutung des Kirchenlieds für die evangelische Kirche aufgegangen. Er hat damit Anteil am hymnologischen Aufbruch der Bekennenden Kirche. Im „Gemeinsamen Leben“ fordert er, das evangelische Kirchenlied einstimmig zu singen, weil nur das einstimmig gesungene Gemeindelied seine geistliche Funktion zu erfüllen vermag. Nur das einstimmige Lied lasse erkennen, dass wirklich mit dem ganzen Herzen gesungen wird, dass zur Ehre Gottes gesungen wird, dass es das Wort Gottes ist, das im Lied zum Klingen kommt und dass die Gemeinde in geschwisterlicher Eintracht singt. Bonhoeffer fordert rigide, den mehrstimmigen Gemeindegesang zu verbieten.
Er war einer der ersten evangelischen Theologen im 20. Jahrhundert, der Alleinsein und Schweigen als wichtige spirituelle Mittel entdeckte. Die entsprechenden Ausführungen finden sich im Kapitel „Der einsame Tag“. Erst im Schweigen vor Gott wird der Mensch zum Einzelnen und damit zur Person. Dass ein Christ vor Gott Einzelner sein kann, war auch ein Gegenprogramm zur damals vorherrschenden Naziideologie mit der Vorstellung: „Du bist nichts, dein Volk ist alles.“ Dagegen Bonhoeffer: „Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft.“
Die Frage nach dem persönlichen Bibellesen ließ ihn zu einem Pionier der Meditation im Protestantismus werden. Von Anfang an gehörte zum Tagesablauf in Finkenwalde eine halbe Stunde zweckfreie Meditationszeit nach dem Frühstück.24 Der Meditation lagen, jeweils für eine Woche gleichbleibend, einige wenige gemeinsam vereinbarte Bibelverse zugrunde. Beim Meditieren durfte nicht auf Lexikon, Kommentar oder Urtext zurückgegriffen werden. Bonhoeffer brachte die Idee zur regelmäßigen Meditation aus England mit. Bevor er sein Amt als Predigerseminardirektor antrat, hatte er im März 1935 die wichtigsten englischen Klöster bereist:25 Kelham, Mirfield und Oxford. Er wollte in den Klöstern den Tagesablauf kennenlernen und die praktischen Methoden zur geistlichen Schulung von Theologen. Dazu gehörte neben dem Stundengebet die regelmäßige meditative Versenkung in den Bibeltext. Gerade die geheime Kraft des Schweigens, die Kontemplation, wurde als ein wesentlicher Bestandteil der Ordnung der Klöster angesehen.
In der evangelischen Kirche in Deutschland war die Übung der Meditation damals noch etwas total Fremdes. Ansatzweise hatten die Michaelsbruderschaft und andere hochkirchliche Gruppen sie in ihren eigenen Kreisen wiederentdeckt. Bonhoeffers Meditationsansatz war aber ein anderer: Die von ihm praktizierte und gelehrte Meditation ist Schriftmeditation. Die Widerstände gegen die in Finkenwalde geübte Meditation hingen auch mit der damaligen Fremdheit der Meditationspraxis im Raum der evangelischen Kirche zusammen. Dazu kam, dass sie bei den meisten Kandidaten nicht richtig funktionierte.26 Sie hatten zuvor die Bibel vorwiegend als Grundlage für Predigt, Unterricht oder Vortrag benutzt. Jetzt sollten sie diese zweckfrei lesen, als Wort Gottes für sich persönlich. Viele waren schlicht überfordert. Auch wenn sie sich auf das Experiment einließen, erlebten sie zunächst nur, dass die Gedanken wanderten, dass sie von Träumen überfallen wurden oder dass verdrängte Erinnerungen hochstiegen. Solche Erfahrungen waren für die meisten beängstigend. In den einzelnen Kursen ist es wegen der Schwierigkeiten regelmäßig zu Aussprachen über das Wesen und Ziel der Meditationspraxis gekommen. Man einigte sich darauf, einmal in der Woche, am Samstagmorgen, zu einer gemeinsamen Meditationszeit zusammenzukommen. Nach Art der Austauschrunden in der Oxford-Gruppenbewegung27 und der Quäker durfte hier einander mitgeteilt werden, was den Einzelnen am die Woche über meditierten Bibelwort persönlich wichtig geworden war – ohne dass die anderen das Recht hatten, das Gesagte zu kommentieren.28 Niemand war gezwungen, etwas zu sagen; man konnte einfach schweigend dabeisitzen. Viele Seminaristen erhielten für die eigene Meditationszeit Impulse durch das, was andere austauschten. Vor allem lernten sie, während der Meditationszeit alles, was ihnen durch den Kopf ging, einzufangen und im Gebet vor Gott auszusprechen mit dem Satz: „Gott ich danke dir dafür, dass …“29 Damit wurde das eigene Denken, Fühlen und Erleben bei der Betrachtung der Bibel mit Gott in Verbindung gebracht und ihm unterstellt. Bonhoeffer war also durchaus bereit, Hilfen zur Meditationspraxis zu geben; an der Übung als solcher hielt er jedoch eisern fest. Bis weit in den Krieg hinein wurden allen ehemaligen Finkenwaldern die gemeinsamen Meditationstexte regelmäßig mitgeteilt.
Für Bonhoeffers Meditationsverständnis sind zwei Voraussetzungen grundlegend. Zum einen ein bestimmtes Bibelverständnis, zum anderen die Wichtigkeit der Kontemplation. Ausgangspunkt von Bonhoeffers Schriftverständnis ist die Überzeugung, dass Gott durch die Bibel zum Menschen reden will. Er geht davon aus, dass es Gott selbst war, der bestimmt hat, sich im Wort der Bibel vom Menschen finden zu lassen. Um ihre göttliche Botschaft an den Menschen ausrichten zu können, muss sie gegenüber dem Leser zu einer Größe mit eigenem Gewicht werden. Darin bestehen das Ziel und gleichzeitig das inhaltliche Zentrum der in Finkenwalde geübten Meditationspraxis.30 „Wir suchen den Willen Gottes, der uns ganz fremd und zuwider ist, dessen Wege nicht unsere Wege und dessen Gedanken nicht unsere Gedanken sind, der sich uns verbirgt unter dem Zeichen des Kreuzes, an dem alle unsere Wege und Gedanken ein Ende haben.“31
Das führt aufseiten des Menschen, der Gottes Stimme in der Schrift hören will, zu einer bestimmten Einstellung beim Lesen. Sie muss mit der Erwartung gelesen werden, dass Gott durch sie die existenziellen Fragen des Lesers beantwortet. „[…] ich glaube, daß […] wir nur anhaltend und etwas demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen.“32 Nur wer bereit ist, der Bibel einen Vertrauensvorschuss zu geben, wird auch weiterhelfende Antworten durch sie bekommen.
Die zweite Voraussetzung der in Finkenwalde geübten Meditationspraxis ist die Kontemplation. Es genügt nicht, theologisch überzeugt zu sein, dass Gott in der Bibel zum Menschen reden will. Vielmehr muss die Bereitschaft dazu kommen, sich vorzubereiten, Raum und Zeit zur Verfügung zu stellen, um auf Gott zu hören. Ohne Ruhe und Sammlung vor Gott wird es nur schwer zur Begegnung mit ihm kommen. Weil Gott durch das Wort der Bibel zum Menschen reden will, muss er vor diesem Wort schweigen, um Gott vernehmen zu können. Dass Gott nicht zum einzelnen Christen allein redet, sondern zu diesem als Glied der Gemeinschaft der ganzen Kirche, entreißt die Kontemplation der Privatheit.
Das „Gemeinsame Leben“ zeigt Bonhoeffer aber nicht nur als einen Pionier der Meditation, sondern auch als Vorkämpfer für die Erneuerung der evangelischen Beichte. Neben dem Abschnitt aus Martin Luthers Kleinem Katechismus ist kein evangelischer Text zur Einzelbeichte so bekannt geworden wie Dietrich Bonhoeffers Ausführungen im „Gemeinsamen Leben“. Bonhoeffers Hochschätzung der Beichte folgt aus seiner von Luther geprägten Theologie. Wie den Jüngern das Evangelium durch die Verkündigung Jesu Christi vermittelt wurde, wird es heute in der christlichen Gemeinschaft durch den Bruder erfahrbar: Das Wort des Bruders (bzw. der Schwester) ist das Wort Christi. Wiederum stellen sich Predigerseminar und Bruderhaus als Praxisfeld für die Beichte dar. Nach drei Wochen forderte Bonhoeffer den ersten Vikarskurs auf, vor dem Abendmahlsgang untereinander „Klarheit“ zu schaffen.33 Es kam zu langen Gesprächen, in denen alles „Störende“ ausgesprochen wurde. Entsprechende Beichtgespräche fanden nicht in der Seminarkirche, sondern an einem profanen Ort statt. Am Ende des Gesprächs stand ein einfaches Gebet um Vergebung. Im Rahmen des Bruderhauses wurde später in bestimmten Fällen eine liturgische Form der Zusage der Vergebung praktiziert. Vorbedingung war, dass der Beichthörer ein ordinierter Theologe war, der dann expressis verbis die Vergebung zusprach.
Bonhoeffer führt drei Gründe für die Notwendigkeit der Beichte an: 1. Die Kirche ist ohne Privatbeichte durch das Missverständnis gefährdet, als sei die christliche Gemeinschaft eine Gemeinschaft der Frommen und nicht der Sünder. 2. Die Beichte ist durch Jesus Christus selbst ermöglicht und aufgetragen. 3. Der Beichthörer hört das Sündenbekenntnis sowohl an Christi statt als auch anstelle der Gemeinde. Außerdem beschreibt er vier Wirkungen der Beichte: In der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft, der Durchbruch zum Kreuz, der Durchbruch zum neuen Leben und der Durchbruch zur Gewissheit.
Die Beichte ist in Bonhoeffers Augen unerlässlich, um die teure Gnade vor ihrer Entwertung zur billigen Gnade zu schützen. Gleichzeitig ist sie für ihn – wie für Luther – das Herz der Seelsorge, weil sie die deutlichste Form darstellt, in der ein Mensch die Vergebung durch Gott „allein aus Gnaden“ erfahren kann.
Die Qualität von Bonhoeffers Text über die Beichte beruht nicht zuletzt auf seiner Praxisorientierung. Außerdem verschweigt er die mit ihr verbundenen Gefährdungen nicht, obwohl er für die Beichte wirbt. Bonhoeffer hält die Zeit vor dem Abendmahl für einen besonders geeigneten Zeitpunkt. Indem er die Beichte als Abendmahlsvorbereitung versteht, knüpft er an alte Traditionen an, die in vielen evangelischen Gemeinden zumindest in den 1930er-Jahren noch vorhanden waren. Die größte Gefährdung für den Beichtenden besteht für Bonhoeffer darin, die Beichte als gutes Werk zu betrachten, durch das er vor Gott gerecht wird. Damit ist das Wesen evangelischer Beichte jedoch vollkommen verkannt. Das Augenmerk liegt in der Beichte gerade nicht auf meinem, sondern auf Gottes Tun. In der Beichte handelt Gott an mir! Ich lasse mir von ihm persönlich, stellvertretend durch den Bruder oder die Schwester, den Dienst der Sündenvergebung leisten. Im Zentrum der Beichte steht nicht mein Bekenntnis der Sünden, sondern deren Vergebung durch Gott. Aufseiten des Beichthörers besteht die Gefahr, dass er die Beichte zur Ausübung geistlicher Gewaltherrschaft über die Seelen missbraucht. Das geschieht dann, wenn einer – etwa der Leiter oder die Leiterin einer Gemeinschaft oder Gemeinde – Beichthörer für alle anderen ist. Um diesem Missbrauch zu entgehen, ist es Bonhoeffer wichtig, dass derjenige, der Beichthörer ist, selbst bei jemandem beichtet und dass nicht einer allein, sondern mehrere in einer Gemeinde oder Gemeinschaft die Beichte hören.
Gleichzeitig mit der Wiedereinführung der Einzelbeichte trat Bonhoeffer für den regelmäßigen Empfang des Abendmahls ein. Damals war es in den Landeskirchen üblich, höchstens dreimal im Jahr das Abendmahl zu feiern. Bonhoeffer hatte erkannt, dass das Abendmahl seine spirituelle Kraft jedoch erst dann entfalten kann, wenn es in nicht zu langen zeitlichen Abständen empfangen wird.