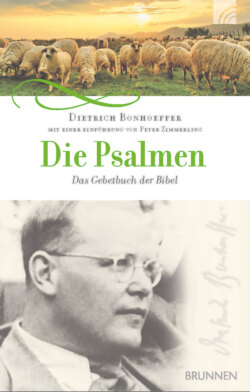Читать книгу Die Psalmen - Dietrich Bonhoeffer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eigenart
Оглавление„Die Psalmen. Das Gebetbuch der Bibel“ ist in der Zeit entstanden, als Bonhoeffer im Dienst der Bekennenden Kirche eines ihrer illegalen Predigerseminare leitete. Die Durchsicht der Lehrveranstaltungen in Finkenwalde und in den Sammelvikariaten zeigt, dass die Auslegung des Neuen und Alten Testaments dabei im Zentrum stand. Das war nicht nur für einen systematischen Theologen wie Bonhoeffer ungewöhnlich, sondern fällt auch aus dem Rahmen des Fächerkanons in den herkömmlichen Predigerseminaren. Die Orientierung von Bonhoeffers Praktischer Theologie an der Bibel wird jedoch von seinem theologischen Ansatz her verständlich. Karl Barths Wort-Gottes-Theologie hatte ihm dabei die Initialzündung vermittelt. Ebenso wichtig war, dass sich die Bibel während des Dritten Reiches in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen mit den Deutschen Christen als Quelle und Norm schwieriger Entscheidungen bewährte. Dadurch kam es in Finkenwalde zu einer Neuentdeckung des theologischen Erkenntnisprinzips der Reformation „allein die Schrift“ – „sola scriptura“. Für alle Beteiligten war verblüffend: Mitten im 20. Jahrhundert – in den Auseinandersetzungen mit Deutschen Christen und Nationalsozialisten – erwies sich das grundlegende Erkenntnisprinzip der Reformation des 16. Jahrhunderts als bestürzend aktuell. Es verwandelte sich vor aller Augen plötzlich von einer verstaubten und abstrakten theologischen Formel aus dem Reformationsmuseum zu einer kraftvollen, inspirierenden und unentbehrlichen Orientierungshilfe der kirchlichen Gegenwart.
Die von Bonhoeffer in Finkenwalde praktizierte und gelehrte Schriftauslegung unterschied sich grundlegend von der an den Universitäten damals vorherrschenden Auslegungspraxis. Es war eine primär theologisch geprägte Schriftauslegung, die die Frage nach der „Sache“ der biblischen Texte – auch hier in den Bahnen von Barths Anliegen – in den Vordergrund stellte.8 Dahinter traten die historisch geprägten Fragestellungen der historisch-kritischen Bibelauslegung mehr oder weniger stark zurück. Das wird schon an Bonhoeffers Erstlingswerk auf diesem Gebiet, „Schöpfung und Fall“, ausdrücklich mit dem Untertitel „Theologische Auslegung von Genesis 1–3“, sichtbar.9 Diese Ausrichtung zeigen seine Bibelarbeiten wie die schon erwähnte über „König David“. Das Gleiche gilt für „Das Gebetbuch der Bibel. Eine Einführung in die Psalmen“.
Rechenschaft über seine Art der Schriftauslegung hat Bonhoeffer vor allem in seinem Vortrag „Vergegenwärtigung neutestamentlicher Texte“10 gegeben: Danach hat sich nicht der Bibeltext vor dem vermeintlich fortgeschrittenen Geist der Gegenwart zu verantworten, sondern die Gegenwart mit ihren Selbstverständlichkeiten muss sich von den biblischen Aussagen kritisch hinterfragen lassen.
Immer wieder ist – schon zu seinen Lebzeiten – Bonhoeffers Schriftgebrauch als „biblizistisch“ und „vormodern“ kritisiert worden.11 Eine gründliche Untersuchung seines Schriftverständnisses steht noch aus und ist hier nicht das Thema.12 Wenn man seiner Schriftauslegung schon ein Adjektiv beifügen wollte, sollte man aber besser von einer „nachmodernen“ Bibelauslegung sprechen. Bonhoeffer lehnt ja nicht die Ergebnisse der historisch-kritischen Exegese pauschal ab, sondern versucht, auf dem Weg ihrer kritischen Überprüfung einen Schritt weiterzukommen und nicht bei der philologischen und historischen Auslegung stehen zu bleiben, und fragt, was die Bibeltexte für den heute gelebten Glauben in seinen unterschiedlichen Bezügen zu sagen haben.
Für Bonhoeffers Buch über die Psalmen ist eine dezidiert auf Christus bezogene Auslegung charakteristisch. Die christologische Auslegung des Alten Testaments war für die ganze Bekennende Kirche typisch.13 Sie wandte sich damit gegen die Preisgabe des Alten Testaments – und damit auch Israels, des alttestamentlichen Gottesvolkes – durch die Deutschen Christen, die bereits durch die liberale Theologie im 19. Jahrhundert vorbereitet worden war. Stattdessen trat die Bekennende Kirche dafür ein, dass es kein Christentum ohne das Erbe des Judentums gibt. Bonhoeffer legt die Psalmen in doppelter Weise christologisch aus. Er fragt zunächst, wie Jesus von Nazareth die Psalmen gebetet hat, und dann, was es theologisch für uns heute heißt, die Psalmen als Christen im Glauben an Jesus Christus zu beten. Jesus von Nazareth hat als Sohn Gottes, der mit den Menschen lebte, die Psalmgebete an Gott den Vater gerichtet. Der Psalter war das Gebetbuch Jesu. Bonhoeffer hält ausdrücklich fest, dass Jesus mit Worten der Psalmen auf den Lippen am Kreuz gestorben ist. Darum können wir gewiss sein, dass wir die Psalmen im Glauben nie allein, sondern immer zusammen mit Jesus Christus beten. Zugleich ist damit auch die Antwort auf die Frage gegeben, warum der Psalter, obwohl als Gebet menschliches Wort an Gott, gleichzeitig Wort Gottes ist. Weil Jesus Christus zugleich Gott und Mensch war, war auch sein Gebet gleichzeitig Gottes- und Menschenwort. Im Hinblick auf die David zugeschriebenen Psalmen fügt Bonhoeffer noch einen weiteren Gedanken hinzu: In ihnen spricht der zu Davids Lebzeiten verheißene Christus bzw. der Heilige Geist. Bonhoeffer beruft sich dabei auf Hebr 2,12; 10,5; 3,7. Da Christus im Herzen Davids wohnte, betete Christus in ihm und mit ihm.
Warum diese komplizierten, ziemlich abstrakt anmutenden theologischen Überlegungen? Bonhoeffer möchte seinen Leserinnen und Lesern klarmachen, wieso der Psalter genau wie das Vaterunser auch für Christen und damit für die Gemeinde Jesu eine zuverlässige und gewisse Gebetsschule darstellt. Von sich aus kann ein Mensch nämlich nicht wissen, worum er Gott bitten und wofür er ihm danken kann. Allein durch das Wort Jesu Christi bekommt er diese Gewissheit und gleichzeitig die Zuversicht, dass Gott sein Gebet erhören wird. Erst von diesem auf Christus bezogenen Verständnis aus werden die Psalmen zum Gebetbuch der Kirche.
Bonhoeffer will mit seinem Buch dem Psalter wieder Heimatrecht in der evangelischen Spiritualität verschaffen. Jahrhundertelang hatten die Klöster mit ihrer Praxis des Stundengebetes im Bewusstsein der Christenheit wachgehalten, dass der Psalter das Gebetbuch der Kirche ist. Schon die Regel des ältesten abendländischen Ordens, des Benediktinerordens, behandelt die Regelungen zum Psalmgebet mit großer Sorgfalt und regelt z. B., wie viele und welche Psalmen in den einzelnen Stundengebeten gebetet werden sollen. Über die Woche verteilt ist der gesamte Psalter zu beten. Die Doxologie an die Dreieinigkeit am Schluss jedes Psalms, zu der Mönche bis zum heutigen Tag aufstehen, macht deutlich, dass es sich bei dem im Psalmgebet angerufenen Gott um den christlichen Gott handelt.
In den reformatorischen Kirchen brach die Tradition des regelmäßigen Psalmgebets mit der Auflösung der Orden und dem Aufhören der Stundengebete ab. Der evangelischen Kirche ging der Psalter als Gebetbuch verloren. Glücklicherweise trifft diese Aussage nur mit Einschränkung zu. So geht aus Martin Luthers verschiedenen Vorreden und Nachworten zum Psalter, aus seinen diversen Schriften über einzelne Psalmen und den Vorlesungen über den Psalter hervor, dass er diesen auch nach der reformatorischen Wende hoch geschätzt hat. Er ist für ihn eine „kleine Biblia“, er enthält in nuce die ganze Bibel, ist das Herz des Alten Testaments, wie der Römerbrief das Hauptstück des Neuen Testaments darstellt.15 Luther scheint den Psalter mit besonderer Sorgfalt ins Deutsche übersetzt zu haben.16 Nicht ohne Grund entspricht der Wortlaut vieler Psalmen in der heutigen Lutherbibel auch nach mehreren Revisionen noch genau Luthers ursprünglicher Übersetzung. Diese Beobachtungen korrespondieren mit der überragenden Bedeutung, die der Psalter für seine persönliche Spiritualität zeitlebens besaß. Auch für Calvins Reformation spielten die Psalmen in Gestalt des Genfer Psalters, dem bedeutendsten Liederbuch der reformierten Tradition, eine wichtige Rolle.
Dennoch trat der Psalter für das gottesdienstliche Leben, aber auch für die private Frömmigkeit der evangelischen Christenheit in der Folgezeit in den Hintergrund. Erst durch die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entstandenen evangelischen Bruderschaften wurde er im Protestantismus wiederentdeckt. Bonhoeffer ist einer der Ersten, der ihm in der Gesamtkirche wieder Heimatrecht geben will. Eine nicht zu unterschätzende Anregung hat er dafür durch die Begegnung mit dem Evensong, dem Abendgebet der anglikanischen Kathedralkirchen, und dem Stundengebet der anglikanischen Klöster während seiner Zeit als Pfarrer der deutschen Auslandsgemeinde in London erhalten. Bonhoeffers Eintreten für den Psalter als Mittel evangelischer Spiritualität hat letztlich inhaltliche Gründe. Er ist überzeugt, dass seine Wiedergewinnung für den Gottesdienst und die persönliche Frömmigkeit sowohl der Kirche als auch dem einzelnen Christen helfen wird, ungeahnte geistliche Kräfte zu gewinnen.