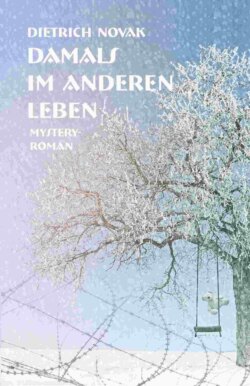Читать книгу Damals im anderen Leben - Dietrich Novak - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеVera Berger war tief in Gedanken versunken, als sie mit dem Zug nach Berlin zurückfuhr. Sie schaute zwar aus dem Fenster, aber nur, um die letzten Stunden innerlich Revue passieren zu lassen. Von der vorbeigleitenden Landschaft bekam sie nichts mit. Sie hatte ihre beste Freundin Marie, die sich gerne Cindy nannte und das auch engen Freunden oder Verwandten erlaubte, in der Klinik besucht. Nein, Marie war nicht ernsthaft erkrankt, sondern hatte sich freiwillig unters Messer begeben, um eine Nasenkorrektur vornehmen zu lassen. Sehr zum Unverständnis von Vera, der Maries „alte“ Nase ausgesprochen gut gefallen hatte. Bei der Operation musste etwas schief gelaufen sein, denn Marie klagte über Schmerzen in der Brust. Sie habe das Gefühl, ein Sumoringer säße auf ihrer Brust, hatte sie gemeint. Für Vera ein eindeutiges Zeichen, dass man Marie wiederbelebt hatte.
Veras Einwand, dass man in diesem Fall wohl ihre Eltern benachrichtigt hätte, ließ Marie nicht gelten. Womöglich hatte man dafür keine Zeit gehabt. Außerdem wären Ärzte, die freiwillig einen Kunstfehler zugaben, äußerst selten, meinte sie.
Vera durchzogen noch immer heiße Wellen, wenn sie daran dachte, dass sie um ein Haar ihre liebste Freundin verloren hätte, eine, die ihr so nahestand wie kein anderer Mensch, wegen so einem Quatsch. Ein kleiner Höcker auf der Nase hatte Maries Schönheit keinen Abbruch getan. Aber Vera hatte der Oberschwester tüchtig die Meinung gesagt, denn zum Arzt hatte man sie gar nicht erst vordringen lassen.
»Dr. Moser operiert. Worum geht es denn?«
»Das fragen Sie mich allen Ernstes? Ich möchte wissen, wie es dazu kommen konnte, dass Frau Falk den Eingriff beinahe nicht überlebt hätte.«
»Wie kommen Sie auf diese abstruse Idee? Ich möchte Sie doch darum bitten, hier keine haltlosen Unterstellungen anzubringen. Und wer sind Sie eigentlich? Eine Verwandte von Frau Falk?«
»Nein, wir sind nur eng befreundet, aber Cindys Beschwerden weisen eindeutig darauf hin, dass sie reanimiert wurde.«
»Sprechen wir von derselben Person? Frau Falks Vorname ist Marie und nicht Cindy.«
»Ja, mein Gott, ich nenne sie nur so, weil ihr das gefällt.«
Die ältere Frau mit leichtem Übergewicht sah Vera durch ihre randlose Brille an, als wäre sie ein Wundertier. »Tut mir leid, wenn Sie mit Frau Falk nicht verwandt sind, darf ich keinerlei Auskünfte geben. Sie können gerne auf Dr. Moser warten. Nur das kann dauern. Außerdem wird er Ihnen nichts anderes sagen.«
»Vielleicht wird der Doktor etwas gesprächiger, wenn wir einen Anwalt einschalten.«
»Das bleibt Frau Falk unbenommen. Sie hingegen hätten wohl keinerlei Handhabe dazu.«
»Ach, Sie mich auch!« Vera hatte sich wutentbrannt auf dem Absatz umgedreht und war zurück zu Marie ins Zimmer gegangen.
Dort hatte sie die nächste Ungeheuerlichkeit erfahren. Ihre Freundin hatte doch tatsächlich nach dem Aufwachen behauptet, Cindy Cromwell zu heißen, als man sie nach ihrem Namen fragte. Nun, Cindy war nicht weiter verwunderlich, aber wo kam plötzlich der Name Cromwell her? Es sei gewesen, als hätte Marie die Geburt von Cindy miterlebt, als sei sie selber Cindy gewesen. Und die Frau, die offensichtlich ihre Mutter war, habe keinerlei Ähnlichkeit mit ihrer jetzigen Mutter Cornell gehabt. Und die Hebamme habe sie außerdem mit Frau Cromwell angesprochen. Und später habe Marie sich in der Gestalt von der ungefähr achtjährigen Cindy erlebt, hatte ihre Freundin berichtet.
»Soso, du beginnst, mir also nachzueifern; zumindest was die Träume angeht!“, hatte Vera erstaunt ausgerufen. Woraufhin Marie protestiert hatte:
»Dass ich geträumt habe, sagst du. Mir hingegen erschien es wie ein reales Erlebnis.«
Nun, das versuchte Vera Marie seit Jahren zu erklären. Marie hatte scheinbar noch immer nicht begriffen, dass Vera nicht träumte, sondern sich erinnerte. Nur war ihr Marie inzwischen einen Schritt voraus, denn nun hatte Cindy einen vollständigen Namen, während Vera den Namen der Person, in der sie sich in ihren Erinnerungen sah, nicht kannte.
Melanie erwachte schweißgebadet. Sie hätte nicht sagen können, ob es heller Tag war oder noch mitten in der Nacht. Die zugezogenen, dichten Vorhänge verhinderten jegliche Spekulation über die Tageszeit. Als ihr Blick auf die Digitalanzeige ihres Radioweckers fiel, war sie überrascht, dass es schon 7.30 Uhr war. Sie hatte das Gefühl, eben erst eingeschlafen zu sein. Nach dem Zubettgehen hatte sie stundenlang wachgelegen und versucht, die geeignete Einschlafposition zu finden. Ihr Bett war total zerwühlt. Das Laken hatte sich zu einer dicken Rolle verschlungen und die Kopfkissen hatten nur noch den halben Umfang wie ursprünglich.
Schwere Träume und unruhiger Schlaf stellten bei Melanie keine Seltenheit dar, nicht umsonst versuchte Trutz, sie ständig dazu zu bewegen, bei ihm zu übernachten. Schließlich war sein Lotterbett, wie er es freiwillig nannte, fast doppelt so groß.
In dieser Nacht hatte Melanie darauf bestanden, in ihrem Bett - allein - zu schlafen. Sie wusste, dass ihr einer der schwersten Tage in ihrem Leben bevorstand. Die Tröstungsversuche von Trutz hatte sie dankbar registriert, aber seine aufgesetzte Fröhlichkeit und seine platten Sprüche, wie „das Leben geht weiter“ und „du hilfst niemandem, wenn du jetzt depressiv wirst“, fielen ihr sichtlich auf die Nerven. Instinktiv fühlte sie ihr Recht auf Trauer und wollte diese auch ausleben.
An diesem regnerischen Novembertag musste sie dem liebsten Menschen das letzte Geleit geben. Die Beerdigung ihrer Großmutter Irmgard war für zehn Uhr angesetzt. Wie sie den Tag überstehen sollte, lag außerhalb von Melanies Vorstellungskraft.
Noch vor wenigen Tagen war die Welt in Ordnung gewesen. Die beiden Frauen hatten sich nach einem gemütlichen Abend voneinander verabschiedet und Melanie war mit dem Bewusstsein heimgegangen, wie wertvoll ihr die Abende mit ihrer Großmutter waren. Erst recht nachdem sie sich vor zwei Jahren für eine eigene Wohnung entschieden hatte. Irmgard war nicht im Geringsten böse gewesen, sondern hatte sich in ihrer verständnisvollen Art mit Melanie auf deren erstes Heim und ihre beginnende Abnabelung gefreut.
Dass Irmgard nach über zwanzig Jahren Bemuttern leichte Ermüdungserscheinungen bemerkte, hatte keiner ausgesprochenen Erwähnung bedurft. Mit Anfang sechzig waren ihr manche Dinge nicht mehr so leicht gefallen und Wollen hatte manchmal im Widerspruch zu Können gestanden. Die tiefe Harmonie zwischen den beiden Frauen hatte zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Entscheidung gesorgt. Kleinkarierte Diskussionen darüber waren überflüssig gewesen. Umso mehr hatte Irmgard von da an die Besuche ihrer Enkelin genossen, bei denen sie so richtig aus dem Vollen schöpfen konnte. Es hatte stets eines von Melanies Lieblingsgerichten und einen guten Wein gegeben.
Am folgenden Tag des letzten gemeinsamen Abends war Melanie merkwürdig unruhig und unkonzentriert gewesen, sehr zur Verwunderung ihres Chefs, der ihre Konzentration schätzte. Am Abend hatte sie einem Impuls folgend versucht, Irmgard telefonisch zu erreichen. Das Freizeichen hatte sie in fälschliche Sicherheit gewiegt, dass ihre Großmutter ihr Theaterabonnement wahrgenommen hatte. Als sie am nächsten Vormittag noch immer keinen Anschluss bekommen hatte, war sie nur mit Mühe davon abzubringen gewesen, sich einige Stunden freizunehmen, um nach ihrer Großmutter zu schauen.
Eine Stunde später hatte dann die Kriminalpolizei Melanie im Büro aufgesucht. Der Grund war Irmgards Tod unter ungeklärten Umständen gewesen. Da Fremdverschulden nicht auszuschließen sei, würde eine Untersuchung folgen, hatten die Beamten sie wissen lassen.
Irmgard war vom Balkon ihrer im dritten Stock gelegenen Wohnung gestürzt und sofort ihren Verletzungen erlegen. Eine vor die Brüstung gestellte Fußbank hatte die Ursache des Sturzes ins Spekulative versetzt. Unfall, Selbstmord oder Mord? war die Frage.
Das Telefon schreckte Melanie aus ihren Gedanken. Sie nahm den Hörer ab und sagte mit trockener, leiser Stimme: »Hallo.«
»Liebling, bist du schon wach?«, fragte Trutz in bewusst unbeschwertem Tonfall.
»Nein, hier ist der Anrufbeantworter«, antwortete Melanie mit müder Stimme.
»Mel, ich wollte dich fragen, ob wir nicht zusammen frühstücken können?« Er überhörte ihre Anspielung auf seine dumme Frage.
»Trutz, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich in der Lage bin, jetzt etwas zu essen?«, sagte Melanie schärfer als sie es beabsichtigt hatte.
»Schon gut, Schatz, ich dachte nur, du solltest nicht nüchtern aus dem Haus gehen«, lenkte er ein. »Wann soll ich mit dem Wagen kommen? Wir müssen doch noch den Kranz abholen.«
Kaum waren die Wörter heraus, hätte er sich die Zunge abbeißen können. Melanies tiefe Verzweiflung brachte langsam seine gewohnte Selbstsicherheit ins Wanken.
Danke, dass du mich daran erinnerst, dachte Melanie, sagte aber nur: »Ich gehe jetzt unter die Dusche und koche mir noch brav eine Tasse Tee. Du kannst mich in einer Stunde abholen. Bis dann!«
Sie legte ohne eine Antwort abzuwarten auf. Im selben Moment tat es ihr leid. Trutz war nicht für ihren Schmerz verantwortlich und gab sich alle Mühe ihr beizustehen. Sie nahm sich vor, in der nächsten Zeit Gesellschaft zu meiden, um nicht unabsichtlich andere zu verletzen.
Auf dem Weg in die Küche entschied sie sich für Kaffee statt Tee. Beim Bedienen der Kaffeemaschine glaubte sie für einen Moment, ihre Beine würden ihr den Dienst versagen. Sie zwang sich, ins Bad zu gehen und zu duschen. Als sie ihr übergroßes T-Shirt auszog, bemerkte sie, dass der feuchte Stoff die Ursache für ihr Frösteln war. Der warme Strahl der Dusche tat ihr gut. Sie wusch ihr verschwitztes, halblanges Haar und befreite ihren Körper von ihrem fiebrigen Schweiß.
Beim Abtrocknen verhinderte der Wasserdampf einen Blick in den beschlagenen Spiegel. Umso entsetzter war sie, als sie beim Haarfönen ihr Gesicht entdeckte. Ihre dunkle Mähne umrahmte ein leichenblasses Gesicht mit stellenweise hektischen Rötungen. Ihre dunkelbraunen Augen lagen tief in den Höhlen und wirkten glanzlos. Dunkle Augenringe gaben ihr ein krankes und übernächtigtes Aussehen.
Melanie band ihre Haare zusammen und formte einen Nackenknoten. Obwohl sie die gleichen Pflegepräparate wie immer benutzt hatte, wirkten die Haare glanzlos wie ihre Augen. In einer Frauenzeitschrift hatte sie gelesen, dass man an den Augen und Haaren den seelischen Zustand eines Menschen erkennen könne. Den Beweis bot ihr der Spiegel.
Sie legte eine leicht getönte Tagescreme auf und wählte einen Lippenstift mit unauffälligem, bräunlichem Farbton. Die Augenringe milderte sie mit Abdeckstift und beendete das Make Up mit einem transparenten Puder. Es kam ihr weniger darauf an, gut auszusehen, als nicht von jedem darauf angesprochen zu werden, wie elend sie aussähe. Als sie Unterwäsche und schwarze Strumpfhosen anzog, kam es ihr so vor, als ob ihre stets leicht gebräunte Haut jegliche Farbe verloren hätte. Das elegante Kostüm in ihrer Lieblingsfarbe Schwarz erfüllte seine angemessene Pflicht und unterstrich ihre zerbrechlich, leicht gespenstisch, wirkende Gestalt.
In diesem Augenblick war sie heilfroh, dass sie nicht in einem Land lebte, in dem Weiß als Trauerfarbe getragen wurde. Sie hasste diese Farbe aus vollem Herzen. Wo immer sich in der Wohnung eine andere Farbe ermöglichen ließ, hatte sie darauf zurückgegriffen. Sie besaß keine einzige weiße Tischdecke und keine weiße Bettwäsche und Laken. Sie war sich völlig sicher, dass sie darunter Erstickungsanfälle bekommen hätte.
Melanie erwischte sich dabei, sich für diese unpassenden Gedanken zu rügen. Sie sollte sich lieber überlegen, wie sie die unvermeidlichen Kondolenzbezeugungen über sich ergehen lassen könnte. Sie verabscheute dick aufgetragene Gefühle, noch dazu, wenn man sich über deren Echtheit nicht sicher sein konnte. Sie hatte so gut wie keine Einladungen verschickt. An wen auch? Sie war wie ihre Großmutter und Mutter ein Einzelkind. Großvater hatte sie nie kennengelernt und ihre Eltern waren gestorben, als sie zwei Jahre alt gewesen war. Die Verwandtschaft ihres Vaters lebte im süddeutschen Raum und hatte nie von sich hören lassen. Außer den Eltern von Trutz, einigen Nachbarn und fremden Friedhofsgängern war also niemand zu erwarten. Gut so. Selbst Trutz würde nie nachempfinden können, welchen Verlust sie erlitten hatte. Wie sollte sie nur weiterleben können?
Das Schrillen der Türklingel riss sie aus ihren Gedanken. Sie trank hastig den letzten Schluck Kaffee, schlüpfte in ihre Stiefeletten und zog ihren weichen, weiten Wollmantel an. Der schwarze, warme Stoff umhüllte sie wie ein schützendes Zelt, und sie fühlte sich augenblicklich etwas geborgener. Sie nahm ihre Umhängetasche über die Schulter und war froh, sich an etwas festhalten zu können. Nachdem sie die Wohnungstür abgeschlossen hatte, fuhr sie mit dem Lift hinunter und sah durch die Glasscheibe der Haustür die kräftige Gestalt von Trutz. Auf einmal war sie froh, nicht alleine gehen zu müssen.
Trutz nahm Melanie wortlos in den Arm und küsste sie zärtlich auf die Wange. Er versuchte so behutsam wie möglich zu sein, was ihm enorm schwer fiel, da er mit seiner etwas poltrigen Art stets ungestümer wirkte als beabsichtigt. Als Melanie neben ihm im Wagen Platz genommen hatte, stellte er erleichtert fest, dass sie wesentlich besser aussah als er befürchtet hatte. Ihm entging zwar nicht das dezente Make Up, er konnte aber nicht beurteilen, wie viel es abdeckte.
Nach wenigen Minuten erreichten sie den Blumenladen, in dem er nach Melanies Anweisungen den Grabschmuck bestellt hatte. Er parkte in zweiter Spur und schaltete die Warnblinkanlage ein. Melanie schaute gedankenverloren auf einen imaginären Punkt in der Ferne und nahm keine Notiz von dem Geschäft.
Als Trutz zurückkam, saß sie unverändert auf ihrem Platz, mit dem gleichen abwesenden Ausdruck. Er verstaute seinen mittelgroßen Kranz, der mit lachsfarbenen Rosen geschmückt war, und Melanies Gesteck aus Lilien und roten Rosen im Kofferraum. Er hatte sich an ihren Wunsch gehalten und auf jegliche Schleifen verzichtet.
Melanie war der Meinung, dass die schwülstigen Texte auf derlei Schleifen völlig überflüssig waren. Ihre Großmutter konnte sie nicht mehr lesen, und den Spruch für die Augen fremder Leute zu dekorieren, fand Melanie geradezu absurd. Es ging niemand etwas an, wie sehr sie diese wunderbare Frau verehrt hatte. Das Gleiche galt auch für Grabsteine. Für Melanie hatten diese ihre Berechtigung allenfalls, wenn sie als kleines, privates Denkmal dienten. Dazu reichten der Name und die Geburts- und Sterbedaten. Bedeutungsschwangere Worte wie: „Unvergessen“ oder Aussagen wie: „Hier ruht in Frieden …“, fand Melanie geradezu peinlich. Dass ein geliebter Mensch unvergessen bleibt, war eine Selbstverständlichkeit, und ein einziger Satz in Goldbuchstaben konnte niemals der Komplexität eines Menschen gerecht werden.
Des Weiteren trug sie eine unbestimmte Ahnung in sich, dass die friedliche Ruhe mehr einem Wunschdenken entsprach, nur vorübergehend sein würde und sich überhaupt nur auf den Körper beziehen konnte. Der Hülle für ihre Dienste zu danken, sollte Aufgabe der Verstorbenen sein, und dem spirituellen Wesen, das sich dieser Hülle bedient hatte, konnte man sicher überall woanders als ausgerechnet auf dem Friedhof begegnen.
Vera war froh, dass ihre Mutter Doris noch nicht von der Arbeit zurück war, als sie von ihrem Krankenbesuch bei Marie nach Hause kam. So konnte sie noch eine Weile ihren Gedanken nachhängen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter war nicht das beste. Man respektierte sich gegenseitig, doch man pflegte keinen liebevollen Umgang miteinander. Das war nicht immer so gewesen. Vera erinnerte sich an unbeschwerte Kindertage, die von Lachen und heiterer Gelassenheit geprägt waren. Das änderte sich schlagartig, als ihr Vater sich einer anderen Frau zuwandte und die kleine Familie verließ. Fortan neigte Doris zu Depressionen und unbotmäßiger Härte gegenüber Vera. Sie zeigte zwei Gesichter. Nachts hörte Vera sie oft weinen, aber am Tage trug sie eine strenge, undurchschaubare Maske. Wahrscheinlich war Doris der Meinung, Vera den Vater nur dadurch ersetzen zu können, indem sie kaum zärtliche Regungen zeigte, sondern streng und autoritär zu Werke ging. Später beneidete Vera Marie oft um ihre Eltern, die viel lockerer und liebevoller waren.
Ironie des Schicksals war, dass die beiden Freundinnen sich total gegensätzlich entwickelt hatten. Vera, die als Erwachsene zu Unbeherrschtheit und schonungsloser, manchmal verletzender Ehrlichkeit neigte, war das sanfte, stille Kind gewesen. Während die eher introvertierte, sanftmütige Marie ein Problemkind gewesen war, das zu Wutanfällen neigte und grundsätzlich alles verneinte. Die Wörter Mama und Papa hatte sie nie ausgesprochen. Stattdessen behauptete sie standhaft, Cornell und Rolf seien nicht ihre Eltern und dass sie „nach Hause“ wolle. Cornell, eine ehemals quirlige Person, die alles andere als ein auffälliges Kind gewollt hatte, war alsbald überfordert gewesen, zumal der Kunstmaler Rolf, der als Buchillustrator für einen Verlag arbeitete, alles gelassener hinnahm und seine künstlerische Ader ihn toleranter erscheinen ließ. Kleine Kinder lebten nun mal in einer Fantasiewelt, beruhigte er seine Frau und auch sich selbst.
Während Cornell und Rolf nahe daran waren, einen Kinderpsychologen zu Rate zu ziehen, suchte Marie mehr und mehr Halt bei den Großeltern mütterlicherseits. Konrads Ausbildung zum Pädagogen half ihm, sich in die Seele seiner Enkelin einzufühlen, und seine wunderbare Frau Alice brachte nichts so schnell aus der Fassung, denn Cornell war ebenfalls ein schwieriges Kind gewesen.
Marie, die damals noch Minka genannt wurde, warf mit englischen Vokabeln um sich wie eine Erwachsene und zeigte außerdem eine heftige Aversion gegen Wasser. So wie Vera gegen Höhe, wie die beiden Freundinnen später feststellten. Eine weitere Gemeinsamkeit waren ihre schweren Träume. Etwas, was sie zeitlebens verfolgen sollte.
Vera hätte glühend eifersüchtig sein müssen, weil sie keine so wunderbaren Großeltern wie Marie hatte. Doch sie kannte es nicht anders. Ihre Mutter Doris behauptete von sich, kein Familienmensch zu sein, außerdem waren ihre Eltern nach Bayern gezogen und verschwendeten kaum einen Gedanken an Tochter und Enkelin. Insgeheim gaben sie wohl Doris die Schuld am Scheitern der Ehe. Ein Mann, der nichts vermisse, ließe nicht so einfach Frau und Kind im Stich waren sie einhelliger Meinung. Wahrscheinlich hatte ihm Doris mit ihren Launen derart zugesetzt, dass er deshalb die Flucht ergriffen hatte.
Die Eltern von Veras Vater Lothar standen auch nicht zur Verfügung, denn beide waren sehr früh verstorben. Seine neue Freundin reagierte eifersüchtig auf das Kind der Vorgängerin und meinte, alle schlechten Eigenschaften der Ex an dem Kind zu entdecken. So fand Vera in jener Zeit keinen Beistand und machte alles mit sich selbst aus. Sie hing ihren Träumen nach und zog sich innerlich zurück. Das änderte sich erst, als sie Marie in der Schule begegnete. Da hatten sich zwei gefunden. Das wurde sogar Außenstehenden klar. Zwei Mädchen, die wie Pech und Schwefel zusammenhielten und denen erst langsam klar wurde, wie sehr sie sich von anderen unterschieden. Dass beide glaubten, nicht zum ersten Mal auf der Welt zu sein, schweißte sie noch enger zusammen.
»Sei nicht traurig«, hatte Marie einmal zu Vera gesagt, »die Eltern meines Vaters leben zwar noch, aber sie bedeuten mir bei Weitem nicht so viel wie die Eltern meiner Mutter. Das liegt hauptsächlich an Melitta, die nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass sie mit ihrer Schwiegertochter nicht einverstanden war. Du hättest sie hören sollen, wie sie gegeifert hat, dass Cornell und Rolf hinnahmen, dass ich nicht mehr Minka, sondern Cindy genannt werden wollte. Ihr lebenslustiger Mann Uli, ein wahrer Filou und notorischer Fremdgänger, fand die Diskussion überflüssig, gab aber schließlich nach, um seine Ruhe zu haben. Seine notorische Untreue quittiert sie mit einer Maske, hinter der sie alle Gefühle versteckt. Eigentlich könnte Melitta von dieser Eigenart her gut die Schwester deiner Mutter sein. Oh, entschuldige …«
»Du hast ja Recht, zumindest, was die Maske betrifft. Aber ihre Schwester Hannelore ist ganz anders. Sie hat uns nur einmal besucht, mich aber mit warmen Blicken bedacht und keine Hemmungen gehabt, mich zärtlich in den Arm zu nehmen und zu knuddeln. Ich hätte es bestimmt nicht leicht und sei ein erstaunliches Mädchen, hat sie gesagt. Schade, dass sie nicht wiedergekommen ist.«
»Kennst du den Grund für die Feindschaft zwischen deiner Mutter und ihrer Schwester?«, fragte Marie interessiert.
»Nein, Mama spricht nicht darüber und antwortet nur ausweichend auf meine Fragen. Das solle unter Schwestern häufiger vorkommen, ist ihre stereotype Antwort. Sag mal, wie bist du eigentlich auf Cindy gekommen?«, wechselte Vera das Thema.
»Eines Nachmittags habe ich bei Oma und Opa in Charlottenburg den Schlager: „Cindy, oh Cindy. Dein Herz muss traurig sein“ gehört. Der Name hat mich so berührt, wie keiner zuvor. Fortan sagte ich: „Ich heiße Cindy“, wenn jemand meinen Namen erfahren wollte. Um später peinlichen Situationen zu entgehen, einigten meine ohnehin schon überstrapazierten Eltern und ich uns darauf, künftig meinem zweiten Vornamen Marie zu verwenden, den ich immer schon lieber mochte.«
»Und warum glaubtest du, dass Cornell und Rolf nicht deine „richtigen“ Eltern seien?«
»Weil ich in meinen Träumen einen blonden Mann an meinem Bett sitzen sah. Er hatte markante Züge und trug sein Haar kurz geschnitten wie eine Bürste. Wenn er sich in Englisch mit mir unterhielt, konnte ich ihm mühelos folgen, und er strahlte Liebe und Geborgenheit aus, wenn er mich streichelte.«
Das kenne ich nur zu gut, hatte Vera damals gedacht. Doch sie hielt den Augenblick noch nicht für gekommen, Marie ein Geständnis zu machen.