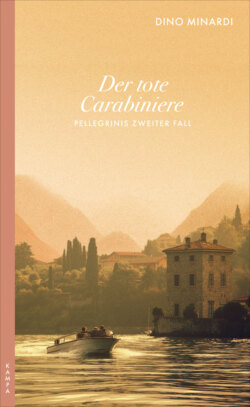Читать книгу Der tote Carabiniere - Dino Minardi - Страница 5
2
ОглавлениеIn der Station wimmelte es von Menschen, Blaulicht flackerte in den Himmel. Vor der Treppe hielt Pellegrini kurz inne. Nach der Stille am Hang waren seine Sinne von dem Lärm und der Hektik einen langen Moment überfordert. Offenbar hatte es sich herumgesprochen, dass es einen Unfall mit einem Toten gab, denn vor der Station, deren Zugänge geschlossen worden waren, drängten sich trotz der frühen Stunde Schaulustige. Auf beiden Bahnsteigen liefen Carabinieri, Männer von der Betreibergesellschaft der Bahn und einige Anzugträger herum. Dazwischen blitzten die roten Jacken der Croce Rossa Italiana auf. Der junge Enrico saß mit einer Decke über den Schultern auf einer Bank und wurde von zwei Sanitätern versorgt. Ispettrice Spagnoli stand vor dem Eingang der Bahnstation, rauchte und beobachtete das Treiben aus einiger Entfernung. Sie trug trotz der Kälte nur einen schwarzen Blazer über einer weißen Bluse und Jeans. Ihre Haare hatte sie zu einem strengen Knoten aufgesteckt. Ihr Anblick tat Pellegrini unterwartet gut, was vielleicht auch daran liegen mochte, dass sie die einzige Frau weit und breit war und ganz unaufgeregt mit einem Mann im Anzug sprach, während alle anderen um sie herum fruchtbar beschäftigt und wichtig taten. Wenn Pellegrini sich nicht täuschte, war ihr Gesprächspartner der Fremde, mit dem er zuvor die Bar verlassen hatte.
Er warf einen letzten Blick zurück auf die Gleise, die bergab im Nebel verschwanden. Wie war Bianchi dorthin gelangt? Es war möglich, aber ziemlich aufwendig, von der Seite an die Trasse zu klettern. Der einfachste Weg wäre von der Bahnstation aus, aber dort wären außerhalb der Betriebszeiten Gittertore und Metallzäune zu überwinden. War es nicht viel wahrscheinlicher, dass er von der Brücke gestürzt oder sogar gestoßen worden war? Pellegrini wandte sich wieder zur Treppe und stieg hinauf. Es war müßig, darüber zu spekulieren, das Team von der Spurensicherung würde sicherlich eine Antwort finden.
Er kam gerade mal zwei Schritte von der Metalltreppe weg.
»Halt! Wo kommen Sie her? Was machen Sie hier?«
Er fuhr herum und starrte wütend auf die Hand, die sich fest auf seine Schulter gelegt hatte. Sein Gegenüber dachte nicht daran, ihn loszulassen. Pellegrini begegnete einem strengen Blick unter dichten Brauen und schielte auf die Schulterklappe. Ein Sottotenente der Carabinieri. So einer hatte ihm gar nichts zu sagen.
Rüde schob er die Hand weg und rückte seinen Mantel zurecht. »Commissario Pellegrini. Die beiden Männer der funicolare haben mich gebeten, nach unten zu gehen. Dort liegt ein toter Mann.«
»Ein Carabiniere.«
»So ist es.« Pellegrini stockte. »Salvatore Bianchi aus Brunate.« Wie seltsam, da hatte er Bianchi Tausende Male in Uniform gesehen, konnte sich jedoch nicht an seinen Dienstgrad erinnern. Vielmehr sah er in Gedanken den gewaltigen Schnurrbart und das gutmütige Lächeln.
Der Sottotenente verschränkte die Arme vor der Brust. »Was fällt Ihnen ein, da einfach runterzugehen? Das ist ein Tatort! Hat man Ihnen denn gar nichts beigebracht?«
»Ein Tatort? Dann gab es Fremdverschulden? Vielleicht eine Amok laufende Bergbahn?«
»Sind Sie noch ganz bei Trost?«
»Nicht weniger als Sie. Ich verstehe nicht, warum Sie von einem Tatort sprechen. Bisher ist es der Fundort einer Leiche.«
Der Sottotenente griff sich an den Schirm seiner Mütze und rückte sie zurecht. »Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen Auskünfte zu erteilen. Ich hoffe für Sie, dass Sie da unten nichts angestellt haben, was unsere Arbeit behindern könnte. Und jetzt machen Sie, dass Sie wegkommen, Sie haben hier nichts zu suchen. Falls wir Fragen haben, melden wir uns.« Er wedelte mit der Hand, als wollte er eine lästige Fliege verscheuchen.
Pellegrini klappte den Mund auf und wieder zu. Alles in ihm strebte danach zu widersprechen, obwohl er wusste, dass sein Gegenüber recht hatte. Die Spurensicherung stand vor einer beachtlichen Herausforderung, und er hatte ihnen die Arbeit nicht gerade leichter gemacht. Außerdem hatte ihn niemand gerufen, er war nur zufällig vor Ort gewesen, hatte keinen Ermittlungsauftrag. Wenn er es ganz genau nahm, hätte er – Aufforderung des Bahnbediensteten hin oder her – besser nicht sofort nachgesehen, sondern erst einmal Fragen gestellt. Dann hätte er festgestellt, dass keine Gefahr in Verzug gewesen war, niemand in Not. Es wäre klüger gewesen, auf die Kollegen zu warten.
Aber für solche Bedenken war es zu spät. Er erlaubte sich ein letztes boshaftes Grinsen. »Soll ich Ihnen meine Personalien geben?«
»Ich habe mir Ihren Namen gemerkt, Commissario Pellegrini.« Der Sottotenente betonte den Rang wie ein Schimpfwort und ließ ihn ohne ein weiteres Wort stehen. Es war offensichtlich, dass ihm ganz andere Dinge auf der Zunge lagen, allein Pellegrinis Dienstgrad hielt ihn davon ab, sie auszusprechen. Dieses Machtsystem funktionierte zum Glück auch über die verschiedenen Polizeiinstanzen hinweg.
Er sah zu Spagnoli, ihre Blicke trafen sich durch die Menschenmenge. Er nickte und bedeutete ihr mit einer Geste, dass er zu ihr kommen würde. Sie beendete ihr Gespräch und zeigte in Richtung Straße, wo sie vermutlich geparkt hatte. Pellegrini holte seinen Trolley. Ein Carabiniere ließ ihn das Tor passieren und riegelte hinter ihm ab. Das metallene Schnappen des Schlosses gab der gesamten Situation etwas Endgültiges. Man hatte sie wortwörtlich ausgeschlossen.
»Wir sind raus«, knurrte Pellegrini ungehalten. »Der Tod eines Carabiniere ist Sache der Carabinieri.«
Spagnoli verzog kurz den Mund. »Zunächst einmal: Buongiorno, Commissario. Das ist ein Stück weit nachvollziehbar, oder?«
Pellegrini blieb stehen. Sie standen auf dem Vorplatz der Bergstation, in dessen Mitte einige alte Umlenkrollen der funicolare ausgestellt waren. Hier zwischen den Gebäuden war der Nebel nicht so dicht, sodass sie den Platz überblicken konnten, über den nach wie vor Blaulicht flackerte. Auf jedem freien Zentimeter standen Autos; Metallkisten und eine Fotoausrüstung wurden aus einem Fiat Ducato ausgeladen. Ein Team der Spurensicherung rückte an. Pellegrini glaubte, in der Ferne Dottor El Gatos Wagen zu erkennen. Der Rechtsmediziner war Frühaufsteher, es durfte nicht viel Mühe gekostet haben, ihn zu erreichen.
Mit einem unzufriedenen Brummen wischte Pellegrini sich eine nebelfeuchte Haarsträhne aus der Stirn.
»Ich kannte den Toten, es ist Salvatore Bianchi, ein Carabiniere aus Brunate.«
Spagnoli stieß einen Fluch aus und legte ihm kurz die Hand auf den Arm. »Tut mir leid, das ist übel. Und was machen wir jetzt?«
Dankbar für die zurückhaltende Geste, mit der sie ihr Mitgefühl ausdrückte, nickte er und straffte die Schultern. »Was wohl? Wenn wir um zehn auf dem Kongress in Bergamo sein wollen, müssen wir uns ranhalten.«
»Wenn du meinst.« Spagnoli schnippte die Zigarettenkippe weg und ging zu einem schwarzen Alfa Romeo 159. Fragend hielt sie den Schlüssel in die Luft, und Pellegrini streckte die Hand aus. »Ich kenne mich hier besser aus als du.«
»Es gibt Navigationssysteme.«
Pellegrini lachte gutmütig. »Mit denen du dich im Hinterland zwischen Como und Lecco garantiert in einer viel zu schmalen Gasse festfährst. Glaub mir, meine Ortskenntnis ist unschlagbar.«
»Meinetwegen.« Sie warf ihm einen Blick zu, den er nicht deuten konnte, und stieg auf der Beifahrerseite ein.
Schweigend fuhren sie los. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie die kleinen Ortschaften hinter sich gelassen und sich auf der SP342 in eine endlose Fahrzeugschlange eingereiht hatten.
»Diese Geschwindigkeit ist atemberaubend.« Genervt ließ Spagnoli ihr telefonino von einer Hand in die andere wandern und starrte aus dem Fenster. Je weiter sie sich vom See entfernt hatten, desto mehr hatte sich der Nebel gelichtet, und die Dunkelheit wich allmählich trübem Tageslicht.
»Wenn wir wie geplant aufgebrochen wären, hätte ich die Autobahn genommen, das geht normalerweise schneller, obwohl die Strecke ein gutes Stück länger ist. Aber jetzt staut sich der Berufsverkehr Richtung Mailand, sodass wir hier vermutlich besser vorankommen.«
Spagnoli brummte eine Antwort, die er nicht verstand. Wieder schwiegen sie eine Weile.
»Es ärgert dich, dass du nicht ermitteln darfst, oder?«, fragte sie plötzlich.
Pellegrini stockte. Er wollte widersprechen, aber wozu? »Ich kannte ihn, und er lag praktisch vor meiner Haustür. Natürlich interessiert mich, was passiert ist. Aber die Carabinieri werden das schon hinkriegen.«
»Soweit ich mich erinnere, traust du Maggiore Visconti nicht viel zu.«
Das war diplomatisch ausgedrückt. Pellegrini hielt den Kommandanten der Kaserne in Como für einen ausgemachten Trottel.
»Hilft ja nichts«, murmelte er und bremste, weil die Blechkarawane vor einem Kreisverkehr zum Stehen kam.
Wäre Salvatore Bianchis Leiche auf dem Stadtgebiet von Como gefunden worden, hätte Pellegrini die Ermittlungen vielleicht mit etwas Geschick an sich reißen können. Aber in Brunate waren wie in den meisten ländlicheren Gemeinden eher Carabinieri vertreten, sie waren schneller vor Ort und damit zuständig. Normalerweise störte Pellegrini sich nicht daran, dass es zwei Polizeiorgane gab, deren Zuständigkeiten sich in vielen Bereichen überschnitten. Das konnte niemand so recht erklären. Manche Dinge waren über die Jahrhunderte gewachsen und hatten manch seltsame Blüte getrieben, doch es war besser, sie nicht zu hinterfragen. Die Republik Italien hatte andere Probleme, wobei die Lombardei eine Region war, die dankenswerterweise weniger davon spürte.
Dieses Mal ärgerte Pellegrini sich allerdings. Er fand, dass er den Tod aufklären dürfen müsste. Auf eine merkwürdige Weise, die er selbst nicht erklären konnte, fühlte er sich zu Unrecht von den Ermittlungen ausgeschlossen.
»Pass auf!«
Spagnoli schrie auf, gleichzeitig trat er die Bremse durch. Dann erst wurde ihm bewusst, dass der Blick aus der Windschutzscheibe komplett von einer dreckigen Lkw-Stoßstange ausgefüllt war.
»Ich war in Gedanken.« Pellegrini hatte den Motor abgewürgt und startete neu.
»Soll ich fahren?«
»Nein, nicht nötig.«
Sie quälten sich weiter durch den Berufsverkehr, der immer schlimmer zu werden schien.
»Ich bin gespannt, was mich gleich erwartet«, durchbrach Spagnoli die Stille.
Pellegrini begriff, dass sie ihn ablenken wollte, und nahm das Angebot dankbar an. »Die Hominis et Tigris ist eine lose zusammenhängende Gruppe von Ermittlern aus ganz Europa. Die meisten sind im aktiven Polizeidienst, aber es sind zum Beispiel auch Rechtsmediziner dabei. Wir tauschen uns schlicht gesagt über unsere Arbeit aus. Es ist nichts Offizielles, reines Privatvergnügen.«
»Warum kann es nicht als Weiterbildung anerkannt werden?« Spagnoli verschränkte die Arme. »Ich würde nämlich behaupten, dass dir dieser Blick über den beruflichen Tellerrand bisher nicht geschadet hat. Allein was deine Sprachkenntnisse anbelangt. Ich dagegen hoffe, dass mein Englisch fürs Erste ausreicht.«
Pellegrini nickte ihr aufmunternd zu. »Ich bin ein schlechter Maßstab, wirklich. Du bist schon viel besser geworden, besonders seit deiner Sprachreise im Sommer.«
»Du übertreibst.«
»Nein, ich meine das ernst.« Pellegrini sah über ihr verlegenes Lächeln hinweg und tat, als müsse er sich auf den Verkehr konzentrieren. »Du wirst sehen«, fuhr er fort. »Es sind lange nicht alle so gut, und die meisten sind trotz unseres internationalen Anspruchs Italiener.«
»Wieso eigentlich? Und wieso ausgerechnet Bergamo?«
»Weil einer der Gründer dort an der Uni Jura lehrt. Professor Ferro hat Kontakte zur Biblioteca Civica Angelo Mai, in der der Kongress stattfindet.« Er grinste. »Außerdem ist Bergamo eine traumhafte Kulisse, das musst du zugeben.«
»Und warum Hominis et Tigris – Menschen und Tiger?«
»Das ist eine Anspielung auf eine Comicstripserie, in der die Welt aus der Sicht eines kleinen Jungen namens Calvin erklärt wird, dessen Begleiter ein Stofftiger namens Hobbes ist. Ich interessiere mich eigentlich nicht für Comics, aber diese sind sehr philosophisch. Hobbes ist nicht nur ein Stofftier, sondern auch ein imaginärer Freund und natürlich viel klüger als die Menschen. Ferro sagt gern, dass wir manchmal Menschen und manchmal Tiger sind. Und dass wir die Welt häufiger aus der Sicht dieses klugen Tigers betrachten sollten.«
»Eine hübsche Weltsicht, aber ich verstehe das nicht.«
»Es ist auch nicht einfach. Es bezieht sich darauf, dass die Sicht von Calvin und Hobbes eigentlich ein und dieselbe ist, da Hobbes nicht wirklich existiert. Seine Ansichten sind eine Projektion des kleinen Jungen auf sein Stofftier. Und dennoch ist es eine neue Perspektive, die des Tigers.«
»Na gut, okay.« Spagnoli dehnte das letzte Wort und machte deutlich, dass sie es immer noch nicht begriffen hatte.
Pellegrini lächelte. »Du wirst es nach der Tagung besser verstehen. Es geht darum, den Standpunkt zu wechseln, den Blickwinkel zu verändern. Das, was du auch bei einer Ermittlung allerspätestens dann tun solltest, wenn du nicht weiterkommst.«
Spagnoli lachte. »Also gut, ich bin gespannt auf den Blickwinkel des Tigers. Danke, dass du mich mitnimmst.«
Tatsächlich hatte Pellegrini sehr lange überlegt, ob er sie einladen sollte. Er galt zwar als umgänglicher Chef, doch er legte keinen Wert auf ein engeres Verhältnis zu seinen Untergebenen. Spagnoli wusste das. Doch letzten Endes war er davon überzeugt, sie könne eine Bereicherung für die Vereinigung sein, und so nahm er in Kauf, ihr einen Teil seines Lebens zu zeigen, der mehr privat als beruflich war. Mit manch einem der Mitglieder der HeT verband ihn eine jahrelange Freundschaft, länger, als er bei der Questura arbeitete. In Pellegrinis Leben hatte es einen tiefen Einschnitt gegeben. Der Unfalltod seines besten Freundes Luca Camerone teilte Freunde und Bekannte in ein Davor und ein Danach. Er hatte sich damals komplett zurückgezogen und mit den meisten vollständig gebrochen, da er weder ihre Anteilnahme noch die sicherlich gut gemeinten Ratschläge ertragen konnte, wie er mit der Erkenntnis zurechtzukommen hätte, dass sein bester Freund ein Drogenschmuggler gewesen war. Die meisten Leute in der Vereinigung hatte er zwar auch vorher schon gekannt, doch als er nach einigen Jahren Pause wieder an den Treffen teilnahm, war genug Zeit vergangen, dass kaum jemand nachfragte. Außerdem hatte Pellegrini da bereits wieder zu sich gefunden und an die alten Freundschaften anknüpfen können – sie waren die Einzigen, bei denen ihm das gelungen war, und gerade das machte die Gruppe so wertvoll und besonders.
Nach einer gefühlten Ewigkeit befanden sie sich endlich auf der zweispurig ausgebauten SS671, und es ging schneller voran. Dann spürte Pellegrini das Vibrieren seines telefonino in seiner Manteltasche. Mit der linken Hand angelte er es heraus. Spagnolis vorwurfsvoller Blick war ihm nicht entgangen, und so reichte er es an sie weiter, als er sah, wer der Anrufer war.
»Questura. Mit denen kannst du genauso gut reden. Sag ihnen, dass du neben mir sitzt.«
Spagnoli meldete sich und hörte zu. Dann stieß sie einen merkwürdigen Laut aus, der irgendwo zwischen Verblüffung und Entsetzen lag.
»Was ist?«, fragte Pellegrini.
Sie schaute auf die Uhr und ignorierte ihn. »Gerade eben, sagst du? Sie müsste einen Moment auf uns warten – sofern er einverstanden ist.«
»Womit soll ich einverstanden sein? Mit wem sprichst du?«
Spagnoli machte eine abwehrende Handbewegung und lauschte weiter.
»Sie ist vermutlich völlig durcheinander. Hast du einen Arzt gerufen?«, fragte sie ins Handy.
»Wer?«, rief Pellegrini. Er trommelte auf das Lenkrad und spürte, wie ihn die Gelassenheit, die sich während ihres Gesprächs eingestellt hatte, wieder verließ. Hatten sich denn heute Morgen alle gegen ihn verschworen?
»Moment.« Spagnoli unterbrach das Gespräch und wandte sich ihm zu. »Eine Signora Stefania Bianchi ist in der Questura und will mit dir sprechen. Sie weigert sich, den Grund zu nennen.«
Pellegrini stieß einen saftigen Fluch aus und bremste, weil ein Motorradfahrer kurz vor ihm einscherte und ihn schnitt.
»Du hättest wirklich besser mich fahren lassen sollen«, fauchte Spagnoli. »Du bist völlig unkonzentriert!«
Er warf einen bösen Blick auf das telefonino.
Sie verdrehte die Augen. »Keine Sorge, ich habe das Mikrofon ausgestellt, das hat niemand gehört. Aber was soll ich denen sagen?«
»Was wohl? Dass wir auf dem Weg und in einer Stunde da sind.« Er setzte den Blinker, um an der nächsten Ausfahrt abzufahren. »Stefania und Salvatore Bianchi sind seit Anbeginn der Zeiten verheiratet. Sie sind aus Brunate nicht wegzudenken. Ich kann sie nicht auf Montag vertrösten, wenn sie mit mir sprechen will.«
»Gut.« Spagnoli gab die Information weiter und beendete das Gespräch. »Dann tauschen wir aber. Ich fahre.«
»Das ist wirklich nicht …«
»Oh doch!« Spagnoli schrie auf, weil ihr Gurt sich bei der nächsten Vollbremsung straffte, und deutete auf einen jungen Mann, den Pellegrini beinahe angefahren hätte und der ihnen den Mittelfinger zeigte, nachdem er sich auf die andere Straßenseite gerettet hatte. »Du bist nicht nur unkonzentriert, jetzt benimmst du dich auch noch wie ein bockiges Kind! Das sieht dir überhaupt nicht ähnlich!«
Pellegrini hielt mit einem Ruck am Straßenrand und starrte sie wütend an.
»Wie bitte?« Er spürte das Blut in seinen Schläfen pochen. Zugleich ärgerte er sich über sich selbst. Zum Teil hatte er sich Spagnolis Ausbruch selbst zuzuschreiben, er hatte einen zu vertraulichen Umgangston zugelassen. Es ging ja nicht nur darum, dass er zu enge persönliche Kontakte vermeiden wollte, es ging auch um das erforderliche Maß an Respekt und Disziplin. Sie konnte eine noch so gute Kollegin sein, aber sie hatte kein Recht, ihn derart anzugehen. Er war immer noch ihr Chef. In diesen Dingen war er konservativ, und dazu stand er.
Spagnoli war feuerrot geworden. Sie biss sich auf die Unterlippe und senkte den Kopf. »Entschuldigung, Signor Commissario.«
Pellegrini stellte den Motor ab und öffnete die Fahrertür. »Entschuldigung angenommen, Ispettrice«, erklärte er beim Aussteigen.
Er ging um den Wagen herum, und weil Spagnoli sich nicht rührte, öffnete er die Beifahrertür.
»Es ist in Ordnung, wenn du mich kritisierst. Einen solchen Ton verbitte ich mir allerdings.« Er versuchte, streng zu klingen, aber im Grunde wusste er, dass sie ihren Platz in der Hierarchie genau kannte und es unnötig war, sie daran zu erinnern. Und wenn er ehrlich war, hatte ihm der Anranzer gutgetan. Ihre harschen Worte schienen das erste Authentische an diesem Tag zu sein, der ihm immer noch vorkam wie ein schlechter Traum, durch den er wie ein Schlafwandler geschlichen war, um die Ereignisse nicht an sich heranzulassen. Und so konnte er sich ein heimliches Grinsen nicht verkneifen, während Spagnoli sichtlich beschämt auf die Fahrerseite wechselte.