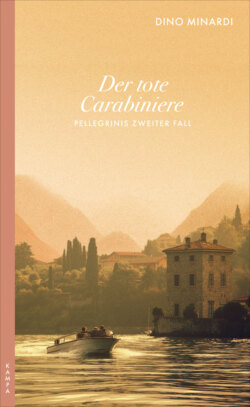Читать книгу Der tote Carabiniere - Dino Minardi - Страница 6
3
ОглавлениеDie mollige, vollkommen in Schwarz gekleidete ältere Frau sprang auf, kaum dass sie die Questura betreten hatten.
»Marco, wie gut, dass du kommst! Ich meine …« Sie zog ihre Handtasche eng an die Brust und warf einen verlegenen Blick in die Runde. »Commissario Pellegrini, du bist, Sie sind …« Ihre Stimme verlor sich, und sie schlug hastig ein Kreuz.
Pellegrini ging auf sie zu und legte ihr einen Arm um die Schultern. Ihm wurde bewusst, dass er über einen Kopf größer war als sie, und er fragte sich, ob sie im Alter geschrumpft war. So klein hatte er sie gar nicht in Erinnerung.
»Kommen Sie, Signora Bianchi. Ich bringe Sie an meinen Platz, und dann erzählen Sie mir, was Sie auf dem Herzen haben. Es ist eine schreckliche Sache, mein tiefempfundenes Beileid.«
Sie nickte tapfer und ließ sich von ihm in Richtung Treppe und hinaufführen. Sie durchquerten das Großraumbüro, in dem am späten Vormittag nur wenige Plätze besetzt waren, und betraten einen mit Glaswänden abgeteilten Bereich, der keinerlei Privatsphäre bot, weshalb Pellegrini sich weigerte, ihn als sein Büro zu bezeichnen. Spagnoli wollte sich zurückziehen, doch Pellegrini signalisierte ihr zu bleiben. Er platzierte Signora Bianchi auf den Besucherstuhl gegenüber seinem Schreibtisch. Ohne weitere Aufforderung holte die Ispettrice eine Flasche Wasser und stellte Signora Bianchi einen Plastikbecher hin, den sie dankbar lächelnd annahm und dann durstig trank. Kaum hatte sie den Becher wieder abgestellt, fing sie an zu weinen.
Pellegrini zog seinen Mantel aus und blieb neben ihr stehen. Geduldig wartete er, bis sie sich wieder beruhigte. Er wusste im Moment ohnehin nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte. Natürlich hatte er Mitleid, aber er stand Stefania Bianchi nicht sehr nahe. Zwar kannte er sie, seit er ein kleiner Junge war, wusste aber so gut wie nichts über sie. Daher hatte er auch keine Mühe, professionelle Distanz zu wahren.
Spagnoli hatte sich hinter sie in eine Ecke gesetzt. Sie behielt ihren Blazer an, denn es war lausig kalt im Büro. Weder im Sommer noch im Winter funktionierte die Klimaanlage, wie sie sollte.
»Es geht schon, Marco. Ich meine, Signor Commissario, danke.«
»Nennen Sie mich gerne weiterhin Marco, Signora.«
»Es ist alles so schrecklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.« Sie schniefte mehrmals, und ihr beachtlicher Busen hob und senkte sich bei jedem Atemzug.
»Sie wollten mit mir sprechen. Um was geht es?«
»Ja, das stimmt.« Sie hatte ihre Handtasche in den Schoß gelegt. Statt weiterzusprechen, nestelte sie ein Stofftaschentuch aus dem Inneren und tupfte sich das Gesicht ab.
Pellegrini lehnte sich an die Schreibtischkante und sah sie an. Er fühlte sich zunehmend unwohl, da er befürchtete, es könnte privater werden, als ihm lieb war. Dazu machte Stefania Bianchis Trauer den Todesfall realer als der Anblick der Leiche am Morgen. Der Nebel, die Gleise, dieser unerträgliche Sottotenente, der ihn des Bahnsteigs verwiesen hatte – das war alles in gewisser Weise Routine gewesen, der Teil seiner Tätigkeit, der das Gegenteil von angenehm war, jedoch unabdingbar dazugehörte. Sie alle lernten früher oder später, damit umzugehen, das Unerträgliche auszublenden und in die hinteren Winkel der Erinnerungen zu verbannen. Sie lernten es – oder sie wechselten den Beruf. Zu erleben, wie die Witwe eines Bekannten vor einem saß, der auf grässliche Weise zu Tode gekommen war, war dagegen beklemmend.
Pellegrini räusperte sich. »Wussten Sie, Signora Bianchi, dass Ihr Mann der Grund war, weshalb ich zur Polizei gegangen bin? Schon als Junge habe ich ihn bewundert, er war immer fair zu uns, auch wenn wir etwas angestellt hatten. Und als ich älter wurde, hat er mal zu mir gesagt, ich könne gut zuhören, hätte einen guten Blick für Zusammenhänge. Das wäre wichtig, hat er gemeint.«
»Oh ja, das weiß ich.« Sie schnäuzte sich verhalten und blickte ihn dann aus feuchten Augen an. »Er war von der Idee ganz besessen, nachdem du dich mit deinem Vater überworfen hattest. Weil du so gut mit Menschen umgehen kannst, hat er immer gesagt. Das hättest du ja auch müssen, wenn du im Albergo geblieben wärst. Salvatore war so stolz, als du bei der Polstrada angefangen hast, als wärst du sein eigener Sohn.«
Pellegrini biss die Zähne zusammen. Er hatte nur das Eis brechen wollen, stattdessen hatte er eine entschieden zu private Antwort provoziert. Er bereute kurz, Spagnoli hinzugebeten zu haben. Diese Geschichten waren oben in Brunate kein großes Geheimnis, aber sie mussten nicht in der Questura herumgetratscht werden.
»Noch lieber wäre es ihm natürlich gewesen, du wärst ein Carabiniere geworden«, ergänzte die Signora mit einem traurigen Lächeln.
Pellegrini hätte selbst nicht so genau erklären können, warum er sich damals so entschieden hatte. Vielleicht, weil er mit dem zivilen Studium, das der polizeilichen Laufbahn vorangegangen war, Zeit gewinnen wollte, falls sein Vater es sich doch noch anders überlegte und ihm einen Platz im Familienbetrieb einräumte. Vielleicht, weil sein Wehrdienst bei den Alpini ihm diese Art von militärischer Befehlsstruktur verleidet und er gehofft hatte, bei der Polizia di Stato ginge es mit weniger Drill, Gehorsam und dergleichen zu – was nicht grundsätzlich richtig war, aber seine damalige Sichtweise.
»Ich bin hier, um ein Geständnis abzulegen.« Stefania Bianchis Blick blieb an der offen stehenden Glastür hängen, die Pellegrinis Bereich vom Rest des Großraumbüros trennte.
Spagnoli schloss die Tür und blieb stehen. Die Ungeduld stand ihr ins Gesicht geschrieben. Ihr schien nicht klar, worauf das hinauslaufen sollte, und damit erging es ihr nicht anders als Pellegrini. Er beugte sich wortlos vor und nickte aufmunternd.
»Ich habe meinen Mann umgebracht.«
Schweigen.
Spagnoli zog fröstelnd die Schultern hoch und legte eine Hand auf die Türklinke.
Stefania Bianchi schaute auf. Dunkle riesengroße Augen blickten Pellegrini flehend an. Er musste an eine Kuh denken und verbannte diese Vorstellung sofort wieder.
»Komme ich ins Gefängnis?« Sie schien wieder kurz davor zu sein, in Tränen auszubrechen.
Pellegrini schüttelte hastig den Kopf und rieb sich mit Daumen und Zeigefinger über die Nasenwurzel. Warum war er an diesem völlig verdrehten Tag überhaupt aufgestanden?
»Nicht so schnell, Signora Bianchi. Bitte. Ganz ruhig und der Reihe nach. Wir gehen jetzt gemeinsam durch, was passiert ist, und falls nötig, machen Sie eine offizielle Aussage, einverstanden? Ispettrice, wir brauchen einen starken caffè. Danke!«
Spagnoli nickte und schien froh zu sein, einen Grund zu haben, den Raum zu verlassen.
Pellegrini wandte sich wieder Stefania Bianchi zu. »Bitte erzählen Sie. Wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen, wie haben Sie ihn«, er stockte kurz, zu absurd diese Vorstellung, »umgebracht?«
»Nun, es gibt nicht sehr viel zu erzählen. Gestern am späten Vormittag ist Salvatore zum Dienst gegangen. Er kam um vierzehn Uhr zum Mittagessen und ist dann gegen fünfzehn Uhr wieder zur Arbeit. Es gab Polenta mit Maronen, frischen Steinpilzen und fettem Südtiroler Speck in Sahnesoße. Es scheint ihm geschmeckt zu haben, aber er hat kein Wort gesagt.«
»Inwiefern ist das bemerkenswert?«
»Nun, du kennst ihn. Er ist ein lauter Mensch, redet ständig ungefragt und viel.«
Pellegrini wartete, dass sie fortfuhr.
Sie hatte unbewusst begonnen, mit dem Riemen ihrer Handtasche zu spielen. Sie wickelte ihn so fest um ihre Hand, dass er einen weißen Streifen hinterließ. »Wir hatten Streit.« Sie senkte ihre Stimme zu einem Flüstern. »Nein, das ist nicht ganz zutreffend. Vielmehr reden wir seit zwei Wochen kein vernünftiges Wort mehr miteinander.« Sie hielt ein weiteres Mal inne, rutschte auf dem Stuhl herum. Dann sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus: »Morgen wäre sein letzter Arbeitstag gewesen. Er war über vierundvierzig Jahre Carabiniere in Brunate. Nächsten Monat wäre er dreiundsechzig geworden. Er hätte nach vierzig Dienstjahren aufhören können, das weißt du, oder? Er hat freiwillig noch all die Jahre drangehängt, und vielleicht hätte er noch länger Dienst geschoben, aber sie haben ihn nicht gelassen. Dieser Visconti hat es ihm persönlich erklärt, hat ihn in die Kaserne nach Como zitiert und ihm gesagt, dass jetzt Schluss ist. Das war Anfang des Jahres. Es hat ihn verändert.«
Sie stierte an Pellegrini vorbei aus dem schlecht geputzten Fenster. »Er hat so getan, als würde er sich freuen, in Wahrheit war es eine Katastrophe. Er war abserviert, dabei war er mit Leib und Seele Carabiniere. Er hat versucht, sich etwas Neues zu suchen. Einen Tag wollte er sich einen Hund anschaffen, einen anderen Bienen züchten. Dann einen Wohnwagen kaufen und nach Norwegen fahren. Norwegen! Wir haben in unserem ganzen Leben nicht einmal über Skandinavien gesprochen. Er hat an manchen Abenden zu viel getrunken, einmal hat er Marihuana geraucht. Danach war er zwei Tage krank.« Sie schnatterte weiter und weiter.
Pellegrini versuchte, die letzten Sätze zu verdauen. Salvatore Bianchi soll gekifft haben? Weder das noch ein Besäufnis passte zu dem Bild, das er von dem Mann hatte, der zeit seines Lebens eine moralische Instanz in Brunate gewesen war, ob er dem zehnjährigen Marco und seinen Freunden das Fußballspielen auf dem Kirchplatz verbot, bei Gemeindefesten nach Taschendieben Ausschau hielt, entlaufene Katzen heimbrachte oder den Verkehr regelte. Eine Messerstecherei zwischen betrunkenen Jugendlichen musste das Aufregendste gewesen sein, das Bianchi während seiner Dienstzeit erlebt hatte, soweit Pellegrini das beurteilen konnte. Como war nicht gerade der Nabel der kriminellen Welt und Brunate – nun, Brunate war klein, übersichtlich und beschaulich.
»Wegen der Katzen habe ich dann gedacht, ich bringe ihn um.«
Pellegrini fuhr unwillkürlich zusammen, versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass er ihr nicht mehr zugehört hatte.
»Was meinen Sie, Signora?«
Sie senkte verlegen den Kopf. »Seit klar war, dass der Herrgott uns keine Kinder schenkt, hatte ich immer mindestens zwei Katzen. Als kleines käufliches Glück, verstehst du?«
»Tut mir leid, nein. Was hat das mit dem Tod Ihres Mannes zu tun?«
»Na, stell dir vor, Salvatore würde wirklich einen Hund anschaffen, was soll dann aus unseren Katzen werden? Salvatore tut gerade so, als würden ihm unsere Katzen nichts bedeuten. Dabei sind sie wie Kinder für mich, da unser gütiger Herrgott mir ein Söhnchen oder Töchterchen versagt hat.« Sie bekam wieder diesen kuhäugigen Blick.
Pellegrini musste sich zusammenreißen, um nicht die Augen zu verdrehen. Kinder, Enkel – Frauen dieser Generation schienen keine anderen Gesprächsthemen zu haben. Er wollte lieber nicht weiter darüber nachdenken, wie seine Mutter Stefania Bianchi jeden Sonntag nach dem Kirchgang vorjammerte, dass ihr Sohn noch nicht einmal eine feste Freundin hatte, da er sich mit ihrer Wunschkandidatin überworfen hatte, geschweige denn an die Zeugung eines Enkels dachte.
»Also gut, Sie dachten also, wenn Salvatore wirklich einen Hund anschafft«, zwang er seine Konzentration zurück auf dieses verrückte Gespräch, »dann bringen Sie ihn um.«
»Das war das erste Mal.« Sie nickte energisch, das kräftige Kinn leicht vorgereckt.
»Wann ungefähr?«
»Vorletzte Woche Sonntag. Als unser Streit begann. Und seitdem immer wieder.« Sie stockte, knetete ihre Handtasche. »Ich schäme mich.«
»Sie haben also seit ungefähr zwei Wochen Mordgelüste gegenüber Ihrem Mann, weil Sie sich vor der Zeit fürchten, wenn er im Ruhestand ist.«
»Ja«, hauchte sie.
Pellegrini lehnte sich ein wenig zurück. Er war vollkommen ratlos, was er von diesem Gerede halten sollte. Stefania Bianchis Aussagen ließen ihn merkwürdig kalt. Vielleicht, weil das alles nicht nur zu banal, sondern vor allem völlig absurd war? Er unterdrückte ein Frösteln. Es war wirklich kalt. Wo blieb Spagnoli mit dem caffè?
Er legte die Handflächen aufeinander und streckte den Rücken durch. »Sie haben Ihrem Mann Schlechtes gewünscht, das habe ich verstanden. Aber was, meine liebe Signora Bianchi, haben Sie getan?«
Sie murmelte etwas vor sich hin.
Pellegrini wiederholte seine Frage.
»Ich habe gebeichtet. Don Volpe hat mir aufgetragen, die Kuchenspenden für den Weihnachtsbasar zu organisieren.«
Vergebung der Sünden für das Engagement in der Gemeinde, dachte Pellegrini amüsiert. So funktionierte moderner Ablasshandel. Doch einer Antwort auf die Frage, was Salvatore Bianchi zugestoßen war, brachte es ihn kein bisschen näher.
»Als ob ich das nicht schon seit Jahrzehnten mache!« Sie klang jetzt empört. »Das ist doch keine Strafe. Ich weiß wirklich nicht, was Don Volpe sich dabei gedacht hat. Außerdem hat es nicht aufgehört. Ich habe gestern Abend erst noch … Und dann ist es ja sogar passiert!« Sie verstummte und schlug eine Hand vor den Mund, sichtlich bemüht, nicht wieder in Tränen auszubrechen. Pellegrini wandte verlegen den Blick ab.
Die Tür ging auf, und Spagnoli trat mit zwei großen To-go-Bechern in der Hand ein. Sie neigte mit entschuldigender Miene den Kopf. Pellegrini nahm die Becher entgegen und reichte einen an Stefania Bianchi weiter, die ihre Handtasche losließ und stattdessen den Becher umklammerte.
»Was haben Sie gestern Abend gemacht, Signora Bianchi?«, fragte er freundlich. »Alles der Reihe nach.«
Sie atmete tief durch und streckte sich ein wenig. »Er ging nach dem Mittagessen, also gegen drei. Normalerweise ist er dann spätestens gegen acht Uhr wieder zurück. Dann essen wir zu Abend, ich hatte alles vorbereitet. Eine Minestrone mit Ciabatta, der Arzt hat gesagt, er soll abends nicht mehr so schwer und fettig essen. Aber er kam nicht.« Sie machte eine Pause.
Pellegrini wechselte einen stummen Blick mit Spagnoli, die sich wieder hingesetzt hatte und offensichtlich vergeblich zu verstehen versuchte, was hier gerade passierte. Aber warum sollte es ihr auch besser ergehen als ihm? Dieses ganze Gespräch führte zu nichts. Die Witwe war verstört, aber mit dem Tod ihres Mannes hatte sie nichts zu tun.
»Ich wurde wütend. Sehr wütend.« Sie öffnete ihre Handtasche. »Normalerweise, also früher, ist Salvatore kurz nach Hause gekommen und hat Bescheid gegeben, wenn er sich noch mit jemandem treffen wollte. Er hat nie angerufen, er kam immer vorbei. Immer!«
»Und dieses Mal nicht?« Pellegrini wurde nachdenklich. Vielleicht hatte er es nicht gekonnt, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits tot war? Das würde bedeuten, dass jemand seinen Leichnam später am Abend auf die Schienen der funicolare gelegt oder von der Brücke gestoßen hatte.
»Nein, dieses Mal nicht«, wiederholte sie und griff in ihre Handtasche. »Deswegen habe ich ihn umgebracht. So!«
Mit einem aggressiven Ruck zog sie die Hand wieder aus der Tasche und richtete sie auf Pellegrini.
Spagnoli sprang auf und wollte nach der alten Frau greifen. Pellegrini zuckte instinktiv zurück und wusste im selben Moment, dass sie keine Chance hätten, eine Attacke abzuwehren. Doch zum Vorschein kam kein Messer, keine Schusswaffe, nur ein triumphierender Ausdruck in großen Kuhaugen und …
»Eine Puppe?«
Pellegrini gab Spagnoli einen Wink, und sie entspannte sich, blieb jedoch stehen, wofür er ihr insgeheim dankbar war. Predigte er seinen Mitarbeitern nicht immer und immer wieder, dass sie niemandem ansehen konnten, ob er oder sie zu einem Verbrechen oder gar Mord imstande war? Es widerstrebte ihm, Stefania Bianchi zu verdächtigen, doch allein die Tatsache, dass sie eine respektable Angehörige der Gemeinde Brunates und Ehefrau eines Carabiniere war, schloss nicht aus, dass hinter der Fassade Abgründe lauerten. Er war unvorsichtig gewesen, und zu seinem Glück war er dafür nicht bestraft worden. Das sollte ihm eine Lektion sein. Er atmete tief durch, während sein Herzschlag sich allmählich wieder beruhigte, und versuchte, seine Schultern zu lockern. Ihm war gar nicht bewusst gewesen, wie angespannt er war.
Stefania Bianchi schnaufte entrüstet. »Nicht einfach eine Puppe. Hier, schau sie dir an!«
Vorsichtig nahm Pellegrini die Puppe entgegen. Sie war gut zwanzig Zentimeter groß, ein Männchen mit silbrigen Wollfäden als Haare und angezogen mit einer erstaunlich detaillierten Uniform eines Carabiniere. Der Puppe fehlte ein Arm, ansonsten war sie unversehrt.
Pellegrini schüttelte den Kopf. »Was soll das sein, Signora Bianchi? Eine Voodoo-Puppe?«
»Genau.«
Er starrte sie an, suchte in ihrem Gesicht nach Anzeichen, dass sie ihre Antwort – genau wie er seine Frage – als Scherz gemeint hatte.
Spagnoli schlug die Hand vor den Mund und gluckste.
Pellegrini drehte die Puppe in seiner Hand hin und her. »Signora Bianchi, ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Bitte wiederholen Sie noch einmal, was genau Sie gestern Abend getan haben.«
»Ich habe mit dem Abendessen gewartet, bis die Minestrone kalt war. Ich war wütend, schrecklich wütend. Ich habe die Puppe vor gut einer Woche gehäkelt, aber noch nie benutzt, aber gestern … Es kam einfach über mich. Ich habe einen Loa angerufen, der meinen Mann bestrafen sollte. Dann habe ich die Puppe genommen und ihr den Arm abgerissen.« Sie senkte den Kopf und sprach leiser. »Später habe ich mich geschämt, hätte es am liebsten rückgängig gemacht. Danach habe ich zu unserem Herrgott gebetet und mir gewünscht, dass Salvatore nach Hause käme, unversehrt. Ich wollte ihn nicht töten, das war ein Unfall. Aber so ein Loa ist wohl stärker, es hat nichts genutzt. Ich habe die halbe Nacht gewartet, irgendwann bin ich auf dem Sofa eingeschlafen. Bis heute Morgen … einer seiner Kollegen kam und gesagt hat, dass er … nie wieder … nach Hause kommen wird.« Die letzten Worte stammelte sie nur noch, bis sie atemlos innehielt.
»Was ist ein Loa?«
»Ein böser Geist. Ich bin davor gewarnt worden, Loa anzurufen. Wenn ich geahnt hätte, wie mächtig und rachsüchtig sie sind, dann …« Sie schniefte leise.
Spagnoli lehnte sich an die Wand und tippte sich mit einem Finger an die Stirn.
Auch Pellegrini hatte bei allem Verständnis endgültig genug. Er hielt die Puppe in die Höhe.
»Warum sind Sie damit zu mir gekommen? Es tut mir aufrichtig leid, Signora Bianchi, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Die Ermittlungen liegen in den Händen der Kollegen Ihres Mannes.«
Sie schnaubte abfällig. »Ich werde Maggiore Visconti kein Wort darüber sagen! Er würde mich doch nur auslachen.« Sie blickte zaghaft auf. »Aber du glaubst mir, oder?«
Er wollte ihr nichts vormachen und wählte seine Worte mit Bedacht. »Ich glaube, dass Sie und Ihr Mann vor einer großen Herausforderung gestanden haben. Aber dass Sie ihn umgebracht haben, indem Sie ihm einen bösen Geist auf den Hals gehetzt haben? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, sein Tod hat eine andere Ursache, vielleicht war es auch nur ein schrecklicher Unfall. Ich lasse Sie nach Hause bringen, und Sie ruhen sich ein bisschen aus.« Kurz überlegte er, ob er sie davon überzeugen sollte, Visconti von der Puppe zu erzählen, doch er sah keinen Sinn darin.
Sie schien noch nicht überzeugt. »Aber ich habe es mir so sehr gewünscht, das ist doch nicht richtig?«
Pellegrini legte die Puppe auf den Schreibtisch und griff nach dem Telefonhörer. »Signora, ich bitte Sie! Die Gedanken sind frei! Stellen Sie sich vor, wir müssten jeden Menschen bestrafen, der in einem schwachen Moment einem anderen die Pest an den Hals wünscht. Es heißt nicht umsonst Straftat. Es sind die Handlungen, die einen Kriminellen ausmachen, nicht seine Gedanken.«
Dieses Mal widersprach sie ihm nicht. Wenige Minuten später ließ sie sich von Sergente Torriani aus dem Büro führen.
Kaum war sie verschwunden, griff Spagnoli nach der Puppe und betrachtete sie eingehend. »Sie ist toll gemacht, das muss ich zugeben. Die Uniformhose hat sogar einen roten Streifen, sie sieht richtig echt aus.«
Pellegrini zog seinen Mantel an. »Signora Bianchi hat in ihrem Leben sicherlich Dutzende, wenn nicht gar Hunderte solcher Figuren gemacht, Menschen wie Tiere. Sie werden auf den Gemeindefesten verkauft und sind ein Renner bei den kleinen Kindern.«
»Sie glaubt das wirklich, oder? Diesen Quatsch mit dem bösen Geist.«
»Darf ich dir eine private Frage stellen?«
»Nur zu.« Spagnoli grinste. »Du bist derjenige, der ungern über Privates spricht.«
»Glaubst du an Gott?«
»Gute Frage.« Sie betrachtete die Puppe. »Ich bin natürlich katholisch getauft, aber ich gehe nur in die Kirche, wenn ich muss. Das letzte Mal zu Pfingsten. Du kennst das vielleicht.«
»Nur zu gut.«
»Es ist eher eine Pflichtübung und aus Respekt meiner Mutter gegenüber, nicht aus Überzeugung. Ich kann mich nicht einmal an die Predigt erinnern.«
»Ist bei mir nicht anders. Ich frage mich nur häufig, wer dieses ›richtig‹ und ›falsch‹ in Sachen Glauben definiert. Warum soll es einen christlich definierten Gott geben, aber keine bösen Geister oder Loa? Warum nicht mehrere Götter? Das eine ist so wahrscheinlich wie das andere – beziehungsweise unwahrscheinlich, wenn du mich fragst.«
»Unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen?«
»Sozusagen.«
Spagnoli hob spöttisch die Augenbrauen. »Also der klassische Agnostiker. Du glaubst eigentlich an keine Form von Spiritualismus, lässt dir aber eine Hintertür offen, denn man kann nie wissen, ob da nicht doch ein Gott hockt, der es einem übel nimmt.«
Pellegrini ärgerte sich bereits, zu viel gesagt zu haben. »Was mich trotz aller Skepsis etwas gruselt«, erklärte er rasch, »ist der abgerissene Arm. Dem Leichnam war ebenfalls der Arm abgetrennt.«
»Ernsthaft?«
»Ja. Und in beiden Fällen ist es der linke.«
»Meinst du, der Täter hat von der Puppe gewusst?«
»Wenn es einen Täter gibt.« Pellegrini nickte grimmig. »Wir gehen schon davon aus, aber es kann auch ein Unfall gewesen sein.«
»Was glaubst du?«
»Wir ermitteln nicht«, brummte Pellegrini ausweichend, und auf Spagnolis scharfen Blick hin fügte er hinzu: »Aber ich vermute, dass es Fremdeinwirkung gab.«
»Und der Täter hat davon gewusst, dass es diese Puppe und den abgerissenen Arm gab?«
»Das klingt wenig wahrscheinlich, findest du nicht? Es muss ein dummer Zufall sein. Die funicolare hätte genauso gut ein Bein abtrennen können.«
»Dummer Zufall oder doch ein böser Geist.«
»Reiß dich mal zusammen, Claudia.«
»Entschuldigung. Worauf willst du denn jetzt hinaus?«
Das wusste er selbst nicht so genau. Außerdem fiel ihm auf, dass er diesen Voodoo-Zauber viel zu selbstverständlich hingenommen hatte. Wie kam eine biedere norditalienische Katholikin auf so eine Idee? Er nahm sich vor, sie bei nächster Gelegenheit danach zu fragen. Sicherlich hatte es nichts mit dem Tod von Salvatore Bianchi zu tun, aber diese tiefe Religiosität Stefania Bianchis war ihm nicht ganz geheuer.
»Worauf ich hinauswill«, sagte er stattdessen, »ist, dass Signora Bianchi sehr gläubig ist, dazu eine Säule der Gemeinde. Ja, ich denke, sie zieht die Existenz böser Geister genauso in Betracht wie die eines Gottes. Sie glaubt daran, was immer das in dieser Sache für Konsequenzen hatte. Die Grenze zwischen Glaube und Aberglaube ist fließend, zudem willkürlich und dem Zeitgeist unterworfen.«
»Amen.« Spagnoli legte die Puppe ab. »Was machen wir jetzt?«
»Was hältst du von einem Mittagessen in der Stadt? Wir haben ja eigentlich frei.«
»Einverstanden.«
Pellegrinis telefonino vibrierte in seiner Jackentasche. Das Display zeigte eine Nachricht seines Freundes Tito Matteoti aus Rom: Wo bleibt ihr? Dazu ein Foto von fünf Personen, die um einen Tisch voller Pizza und Pasta sitzen und in die Kamera prosten.
Er hielt es Spagnoli hin. »Schau mal. Sie vermissen uns. Lass uns Mittag essen, und dann fahren wir nach Bergamo. Hier können wir nichts mehr zu tun.«
»Und Signora Bianchi?«
»Ich werde unterwegs meine Mutter anrufen und sie bitten, sich um sie zu kümmern. Vermutlich stehen oben in Brunate ohnehin längst alle bereit, sie werden sie nicht allein lassen.«