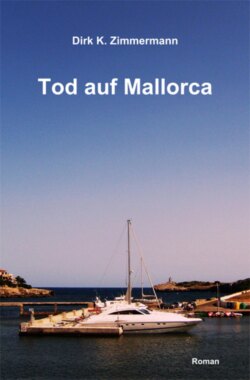Читать книгу Tod auf Mallorca - Dirk K. Zimmermann - Страница 5
Оглавление1
Kann man sich einen guten Zufall verdienen? Man sollte wohl nicht darauf hoffen. Aber würde man danach leben, wenn man wüsste, irgendwann, wenn man ihn bräuchte, dann würde er kommen? Dieser gute Zufall. Der rettende Zufall.
Daran glauben wollte ich nicht. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Vielmehr hatte ich die Überzeugung gewonnen, zumindest, was die letzten zwölf Jahre meines Lebens betraf, dass die schlimmen Ereignisse in meinem Leben wiederkehrten. Schonungslos. Brachial. Voller Schmerz.
Ich war in einer üblen Verfassung, seit Juni des vergangenen Jahres. Ich hatte gerade meine Tabletten abgesetzt. Die Antidepressiva. Anita hatte mich verlassen. Mia, meine Tochter, lebte bei ihr. Ich nahm neben meinem literweisen Whiskykonsum dreimal täglich diese Pillen. Betäubung. Verdrängung. Selbstmitleid. Bis vor kurzem.
Meine erste Frau Ellen und meine Kinder Katrin und Hanna waren vor Jahren gestorben. Die Kinder waren Opfer eines Autounfalls geworden, meine Frau hatte sich das Leben genommen. Der Tod meiner Kinder war ein „Hätte-Wäre-Fall“ gewesen. Hätte ich die Kinder pünktlich von der Sporthalle abgeholt, hätte der Sportlehrer sie nicht in seinem Wagen mitgenommen. Dann wären sie nicht verunglückt. Meine Frau wäre nicht depressiv geworden. Sie wäre nicht am Wehr ertrunken.
Ich war am Leben geblieben. Allein mit diesem Gefühl der Schuld, der Einsamkeit, dem Schmerz. Doch mit einem Mal, Jahre später, war da ein anderes Gefühl gewesen. Das Gefühl, nochmal eine Chance bekommen zu haben. Anita war in mein Leben getreten, diese junge Studentin, die mich als Lebensgefährten ausgewählt hatte, diesen viel älteren Hochschullehrer für Psychologie, der eigentlich ein seelisches Wrack war. Und den sie vor etwas mehr als zwölf Monaten, nach über acht Jahren Ehe, wieder verlassen hatte. Unsere Tochter hatte sie gleich mitgenommen. Papa-Wochenenden gab es. Hier und da Absprachen für die Schulferien. Es fühlte sich an wie ein kleiner Tod. Vielleicht auch ein größerer.
Ich habe es analysiert. Mich analysiert. Ich wusste, ich hatte es nicht überwunden. Dieses Trauma. Wer will es Anita verdenken, dass sie mich verließ. Das Scheitern meines zweiten Lebens schrieb ich der Tatsache zu, dass ich mich nicht hatte ändern können. Dass da plötzlich H-J war, so nannte sie ihn, gleichsam für Hans-Jürgen, ein Fitnesstrainer, der im Musischen Zentrum an meiner, an unserer Hochschule unterrichtete, und der seine Trainingsstunden ausgerechnet genau dann gab, bevor Anita ihren Ballettunterricht abhielt. Die große Liebe. Ein neuer Lebensentwurf für sie. Das Zusammensein mit mir, einem inzwischen einundfünfzigjährigen ausgebrannten Seelenklempner, das konnte man beim besten Willen nicht mehr Lebensentwurf nennen.
Ich hatte meine Professur niedergelegt. Hatte meinen sicheren Job aufgegeben! (Aber: Was ist schon sicher?) Ich begnügte mich mit den Klienten meiner Praxis. Eigentlich waren auch die schon zu viel. Meine Forschungsarbeiten hatte ich ausgesetzt. Die Traumstudien waren trügerisch gewesen, hatten mich an die Vergangenheit gekettet. Ich wollte und musste sie loswerden, wenn ich ein drittes Leben beginnen wollte.
Anita, sie war mit ihm, diesem muskulösen Blondschopf H-J, Hals über Kopf nach Kanada durchgebrannt. Nach Vancouver. Und meine liebste Tochter Mia, sie war jetzt sieben, genoss dort auf einer Privatschule eine zweisprachige Ausbildung. Schön für sie! Wie schön! Ich hätte mich doch beruhigen dürfen, nicht wahr. Sie war gut aufgehoben, erhielt eine exzellente Ausbildung, ihr ging es gut. Und sie wuchs nicht ohne Vater auf. Da war ja dieser H-J.
Ich hatte mir immer wieder klarmachen müssen, dass ich meinen Komplex loswerden musste. Mein Trauma. Die Verlustangst. Die Angst davor zu versagen. Die Angst, dass dieser H-J einmal von meiner Tochter Papa genannt werden würde. Die Angst davor, dass meine Unachtsamkeit – wie das Übersehen eines Zettels auf dem Küchentisch, auf dem stand, dass ich die Kinder vom Sport abholen sollte –, so fatale Folgen wie den Unfalltod meiner Töchter Hanna und Katrin nach sich ziehen konnte.
Angst, war das eigentlich ein Gift, eine Geißel des Lebens? Welche Ausformungen und Begriffsunterschiede es gab, war mir durchaus bewusst, aber es erging mir wie vielen Fachleuten, die bei Konflikten in ihrem eigenen Leben hilflos umhertaumelten wie Zombies. Ich zog in der Krise alle Register menschlichen Seins. Fast alle. Ich stellte mich manchmal tot, manchmal flüchtete ich, Angriff jedoch, diese Strategie ließ ich aus.
Angst erhöht die Aufmerksamkeit. Sie soll unser Überleben sichern. Die Pupillen weiten sich, die Wahrnehmung ist geschärft. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt. Die Atmung ist flacher und galoppierend. Je nach Erregungszustand beginnt man zu schwitzen, zu zittern, man bekommt Schwindelanfälle. Die Angst bemächtigt sich deiner Organtätigkeiten. Häufigere Blasenentleerung, erhöhte Darmtätigkeit, Magenreizungen. Verstärkte Transpiration. Man kann die Angst riechen. Man kann sie sehen. Im Gesicht ablesen. In den Augen.
Gelassenheit war mein liebstes Fremdwort. Ich war ein Nervenbündel. Stoische Ruhe hätte ich gebraucht. Aber unerschütterlich zu sein, davon war ich weit entfernt. Angst, Furcht, Phobie, Thrill, Zwang, Unsicherheit, Panik bis hin zur Psychose. Das Feld der Torheiten im Reich der Angst war groß. Es drohte auf mich einzustürzen. Und die Welt bot keinen Halt. Die Liebe war eine Illusion (Ich meine die Liebe zwischen Mann und Frau.), und die Arbeit war geprägt von Erfolgszwängen, den Fallen Manipulation, Eitelkeit und Vergötterung. Konnten mir wenigstens logische Prinzipien und ethische Vorstellungen Halt bieten?
Ich hatte mir ein kleines Notizbuch angeschafft, in das ich allerlei unglaubliche Zufälle notierte und war zu dem Schluss gekommen, dass ich genug Beweise in der Hand hielt, die Absurdität des Weltgeschehens, des Lebens, nachweisen zu können.
Beispielsweise, so hatte ich notiert, versinkt am 5. Dezember 1664 ein Segelschiff vor der walisischen Küste. Ein Überlebender der einundachtzig Menschen an Bord heißt Hugh Williams. An einem weiteren 5. Dezember, nur, über einhundert Jahre später, sinkt erneut ein Schiff mit sechzig Passagieren. Einer der Geretteten heißt ebenfalls Hugh Williams. 1860 geht wieder ein Schiff unter, diesmal mit fünfundzwanzig Passagieren an Bord. Der einzige Überlebende heißt Hugh Williams.
Oder: In einer Würzburger Klinik gebären zwei ledige Mütter am selben Tag Zwillinge. Man legt sie in dasselbe Zimmer. Im Verlauf ihrer Gespräche stellt sich heraus: Alle vier Kinder haben den gleichen Vater.
Schließlich: Eine Mutter bringt in Straßburg einen Film ins Fotolabor, um ihn entwickeln zu lassen. Sie hat darauf ihren vierjährigen Sohn abgelichtet. Durch widrige Umstände während des Ersten Weltkriegs kann sie den Film nicht abholen. Zwei Jahre später kauft sie in Frankfurt einen neuen Film, um ihre inzwischen geborene Tochter aufzunehmen. Als sie diesen Film nach erfolgter Aufnahme entwickeln lässt, erhält sie vom Labor die Nachricht, der Streifen sei doppelt belichtet. Er zeigte ihre Tochter und ihren Sohn im Alter von vier Jahren.
Halt, so war mir klar, konnte aus einer solchen Welt zweifelsfrei nicht gewonnen werden.
Zurück zu meiner körperlichen Verfassung: Wie kam es dazu, dass ich die Tabletten absetzte? Einer, der eher der Paranoia entgegendriftete – wohlgemerkt ein Psychologieprofessor –, statt sich wieder in geordneten Lebensbahnen zu bewegen. Ich hatte in der Auseinandersetzung mit meinen Ängsten einen kleinen wissenschaftlichen Aufsatz verfasst, der in der Mai-Ausgabe einer Psychologiezeitschrift veröffentlicht worden war. Daraufhin hatte sich überraschender Weise eine Pharmaagentur, Global Sensual Maxx, bei mir gemeldet. Ihre Referentin für Unternehmenskommunikation, Mandy Conchita Williams (man beachte diesen Nachnamen angesichts meiner Notizbucheinträge) lud mich zu einem Gastvortrag für den Ende Juni erstmals auf Mallorca stattfindenden Angor-Kongress ein. Sie erklärte mir am Telefon in ihrem gebrochenen Deutsch mit spanisch-amerikanischem Akzent, ich müsse unbedingt teilnehmen. Sie hatte versucht mir zu schmeicheln; sie hatte mir Komplimente gemacht und mir ihr großes Bedauern darüber mitgeteilt, dass ich die Forschungsarbeit nicht weiter vorantrieb. Sie hatte ihre Worte verlacht, um der Aussage die Schwere zu nehmen, nachdem ich nichts darauf geantwortet hatte und dann hatte sie dazu übergeleitet, dass dieses Unglück ja ein Glück sei, denn sonst hätte ich nicht diesen vortrefflichen Artikel zur Angor-Thematik veröffentlicht.
Ehrlich gesagt, fühlte ich mich keineswegs gebauchpinselt, sondern eher überrascht. Warum lädt man einen Neuling auf diesem Fachgebiet ein? Sicher, ich war nicht der einzige Redner in einem vollgepackten Tagesprogramm, aber ein einziger kleiner – und meines Erachtens recht unbedeutender –, Artikel hatte ausgereicht, um mich zu verpflichten. Es musste mehr dahinterstecken.
Ich hatte darüber nachgedacht, während Mandy Conchita mir am Telefon mit attraktiven Programmpunkten das Kommen schmackhaft machte. Keine Reisekosten, Aufenthalt in einem Luxushotel, ein Ausflug auf einer Jacht, Cocktails und Fischen inklusive, und ein Gala-Dinner vom Feinsten. Hinzu kam ein Redner-Honorar von fünftausend Euro. – Das Angebot war zu gut, um es nicht anzunehmen. Also tat ich es. Ein wenig verunsichert war ich jedoch. Es war fraglich, inwieweit dieses Symposium den Pharmamarkt beeinflussen sollte. Ich kannte das aus Erfahrungsberichten einiger Professoren-Kollegen. Man traf sich mit Pharmareferenten, Vertretern der Wissenschaft und von Arzneimittelbehörden, mit namhaften Medizinern, Psychologen, Journalisten, um gemeinsam neue Marktbewegungen und Trends zu besprechen. Mir war in diesem Zusammenhang die Behandlung von Depressionen in Erinnerung geblieben. Beispielsweise das seit 1998 auftauchende Sissi-Syndrom, eine spezielle Form der Depression, an der besonders aktive Menschen leiden sollten. Rastlosigkeit bis hin zur körperlichen Hyperaktivität. Wiederkehrende Hungerkuren, massive Selbstwertprobleme und viele gescheiterte Behandlungsversuche sollten zum Krankheitsbild gehören. Bis 2003 rätselte die Fachwelt über das Sissi-Syndrom, das die Gesellschaft zu packen schien, häufig Frauen befiel, bis ein unabhängiges Forscherteam die sich wie ein Lauffeuer ausbreitende unheilvolle Nachricht prüfte, vermeintlich Erkrankte testete und dann zu dem Schluss kam, dass es sich um keine eigenständige Erkrankung im wissenschaftlichen Sinne handelte. Es gab damals einige Journalisten, die von einer erfundenen Krankheit sprachen.
Angst ist sicher keine Erfindung. Eigentlich hat sie eine Schutzfunktion, um die Menschen den lauernden Gefahren der Welt gerüstet entgegentreten zu lassen. Ängste gehören zu unserem Leben dazu. Auch die Auswüchse ihrer bis hin zu krankhaften Erscheinungen wie Psychosen, Phobien, Zwängen sind nicht wegzudiskutieren. Jeder Siebte, so wusste ich, entwickelt eine krankhafte Angst. Ich hatte es vor kurzem in einem Fachmagazin gelesen. So belegen es auch neueste Studien, wie ich nachgeschlagen hatte. (Belegen sie es wirklich?) Dennoch – für die Pharmaindustrie hatte das Gefühl der Angst in den Sechziger- und Siebzigerjahren eine große Bedeutung gehabt. Wiederholte sich auch hier alles? (Wie das Leid in meinem Leben.) Wurde ich mit meinem Auftritt beim Angor-Kongress vor einen Karren gespannt, den ich gar nicht ziehen wollte? Albert Wallmann, Psychologe, ehemaliger Leiter des Lehrstuhls für Psychologie einer angesehenen Universität, degeneriert zum Grüß-August von Global Sensual Maxx? Was hieß hier degeneriert? – In meinem eigenen ethischen Verständnis vielleicht oder dem einer imaginären Ethik-Kommission?
Allerdings gab es da ein Problem mit meinem Vortrag, welches für Mandy Conchita gar keins war. Ich hatte – wie erwähnt –, noch am Telefon zugesagt. Und sie hatte erklärt, dass sie den Hin- und Rückflug Düsseldorf - Palma gleich buchen würde, mir die Flugdaten per E-Mail zustellen wolle, sobald sie bestätigt waren. Aber ich musste intervenieren. Dass ich (bereits seit über zehn Jahren) große Flugangst hatte, kam mir nur schwer über die Lippen (man bedenke, welche Reisestrapazen auf mich zukamen, wenn ich nach Vancouver reisen wollte, um mit Mia mal einen Urlaub in Kanada zu verbringen). Es war mir einfach peinlich. Aber Mandy Conchita flötete alle Probleme aus meinen zaghaften Geständnisversuchen einfach weg.
„Machen wir keine große Sache daraus, Herr Wallmann. Nehmen Sie doch die Fähre! Aber ich darf Sie beruhigen, statistisch betrachtet, ist ein Flug eine sehr sichere Sache. Was aber nicht heißt, dass Sie sich bei einer Fährenüberfahrt sorgen müssten. Wenn Sie von Barcelona aus die acht Stündchen auf dem Schiff verbringen, wird es Ihnen wie ein kleiner Urlaub vorkommen. Diese Mallorca-Fähren sind ja nicht die Titanic, die Lamma IV, die SanktThomas von Aquin, die Sewol, die Estonia oder die Costa Concordia, nicht wahr!“
Sie kicherte über ihren makabren Witz. „Entschuldigen Sie“, säuselte Mandy Conchita, „es ist nur so, Ihre Angst – das wissen Sie vielleicht auch –, ist völlig unbegründet. Wenn man neben den Passagier- und Frachtmaschinen auch die Segelflieger und Sportflugzeuge hinzunimmt, dann kommt man im Jahr auf fünfhundertfünfzig Millionen Flüge weltweit. Pro Jahr fallen aber nur vier Flugzeuge vom Himmel. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit mit einem Flugzeug abzustürzen, liegt bei Null Komma Null irgendwas.“
Sie verwirrte mich. Diese Frau Williams.
„Gestatten Sie mir die etwas persönliche Frage“, druckste ich herum, „sind Sie zufällig mit einem gewissen Hugh Williams verwandt?“
Rauschen in der Leitung, dann lachte Mandy Conchita wieder. Glucksend. „Nicht, dass ich wüsste. Aber sind wir alle nicht irgendwie miteinander verwandt, ob man Williams heißt oder Wallmann?“
Ich beließ es dabei. Sie fragte nach, ob ich allein reisen werde, ob ich das Auto mitnehmen wolle. Ich bejahte beides. Daraufhin buchte sie mir eine komfortable Vier-Bett-Kabine mit Bad und den PKW-Transfer auf der Fortuny. – Ich hoffte, der Name des Fährschiffes war Programm.
Mandy Conchita bat mich noch, das Manuskript meines Vortrags zu übersenden, meine Vita, ein Porträtfoto, die üblichen Dinge halt, und erklärte, meine Kontaktperson in allen Angelegenheiten zu sein. Vierzig Minuten nachdem wir das Telefongespräch beendet hatten, erhielt ich bereits die Reiseunterlagen. Fürs Erste war alles erledigt gewesen. Aber damit stand ich unter Druck. Erheblichem Druck.
Ich, der Fünfziger mit Problemzone Bauch, vollgepumpt mit Tabletten und Whisky. Die Haut weiß wie Eimer voll Kalk. Das Haar lang, hing strähnig herab. Der Bart reichte mir bis fast zur Halsbeuge. Ich musste etwas tun, denn so konnte ich nicht aufs Podium treten. Ich ließ mir also beim Friseur den Bart stutzen und die Haarspitzen abschneiden. Das Haar ließ ich sogar kastanienbraun färben, um das stellenweise silbrige Grau zu überdecken. Als ich mich im Spiegel ansah, hatte ich ziemlich viel von einem amerikanischen Dude, einem Lebowski-Verschnitt. Nur die lange Strickjacke fehlte mir zur täuschend ähnlichen Kopie der Filmfigur.
Ich spülte (mein Therapeut Walter, der übrigens mal mein Doktorvater gewesen war, wusste natürlich nichts davon) das komplette Päckchen Tabletten die Toilette hinunter und zog für die nächsten drei Wochen mein tägliches Sportprogramm durch. Eineinhalb Stunden Jogging im Stadtpark, hundertfünfzig Liegestütze, hundertfünfzig Situps, hundertfünfzig Crunches, zwanzig Minuten Seilspringen, dreißig Minuten Radfahren. Auf dem Speiseplan standen Salate, Rindersteak, Magerquark. Traumhaft. Dazu Wasser. Orangensaft. Karottensaft. Sauerkrautsaft. Großartig. Ich spürte wie Suchtgedanken mich einzukreisen versuchten, wie Versagensängste aufstiegen, die ich mit aller Kraft zurückzudrängen versuchte. Es gelang. Der Körper entgiftete, ich hatte Halluzinationen, Schüttelfrost, Schmerzen. Von allem nicht gerade wenig. Ich lag im Bett. Schrie und weinte. Manchmal taumelte ich mehr durch den Stadtgarten als denn ich lief. Und dann, am einundzwanzigsten Tag war es so gut wie überstanden. Ich fühlte mich besser. Zumindest ein bisschen. So gut, dass ich das Vortragsmanuskript in den Händen halten und es auf einem Podium ablegen konnte, ohne dass meine Hände auch nur dabei zitterten. Na, ein bisschen vielleicht.
Am Abreisetag schaute ich nochmals prüfend in den Spiegel, nachdem ich meine Wechselwäsche und die Hygieneartikel in den Trolley geworfen hatte, nicht zu vergessen, das Vortragsmanuskript, die Shorts, die Sandalen, die Poloshirts und die Schwimmbrille. Den Schwimmoverall.
Ein Typ Anfang fünfzig, noch immer mit Bauchansatz, starrte mich da an. Über die Krise konnte nichts hinwegtäuschen, aber der sandfarbene Cordanzug war okay, das schwarze Shirt darunter auch, die schwarzen Socken ebenso.
An Mallorca habe ich so gut wie keinerlei Erinnerungen. Im Kindesalter, ich dürfte damals acht Jahre alt gewesen sein, hatte ich den Sommerurlaub mit meinen Eltern dort verbracht. Mein Vater fuhr lieber im Sommer nach Griechenland, meine Mutter wollte eher nach Österreich. Also hatte es uns nur ein einziges Mal auf diese Insel verschlagen, die wohl zweite Heimat der Deutschen, das sogenannte siebzehnte Bundesland. Ballermann, das hatte ich im Heranwachsenden-Alter gekonnt ausgelassen. Später, mit Ellen und den Kindern, bin ich zumeist in die Karibik geflogen oder nach Frankreich gereist. An die Küste. Auch Anita hatte ich für Südfrankreich begeistern können. Sie selbst hatte Sylt favorisiert und so hatten wir die Ferien wechselweise an der Côte d’Azur und auf Sylt verbracht. Niemals ist es uns dabei langweilig geworden.
Wenn ich also bilanzierte, wenn ich mir vor Augen führte, dass ich als Einundfünfzigjähriger schon einiges hinter mich gebracht hatte (und auch einiges nicht, wie ich beschrieb), so musste ich mir eingestehen, dass ich absonderlich war, ein Mensch im mittleren Alter, ein Mann, der nicht daran dachte, eine Motorradtour durch Australien zu machen, sich eine dreiundzwanzigjährige vollbusige Schönheit anzulachen, einen Weinberg im Badischen zu kaufen oder für den Triathlon auf Hawaii zu trainieren. Ich musste nicht.
Ich spürte, als ich die Reiseunterlagen in den Händen hielt, dass der Weg nach Mallorca irgendwie ein unerfüllter Wunsch von mir war. Vielleicht verbunden mit einer Sehnsucht nach Geborgenheit. Ein Wunsch, der mir durch den zweitägigen Aufenthalt in Palma einen Anschub dafür lieferte, mich vielleicht eine längere Zeit auf Mallorca aufzuhalten und die Vorzüge dieser Insel fernab des Touristentrubels zu genießen. Also gab ich, bevor ich mich in meinen alten Volvo setzte, die zweiten Hausschlüssel bei meiner Nachbarin Herta ab und bat sie die Post zu sammeln und die Pflanzen zu gießen. Ich wisse noch nicht, wie lange mich Mallorca in seinen Bann ziehen würde, hatte ich ihr zum Abschied gesagt. Herta hatte mich intensiv angeblickt und man sah in ihren Augen die aufglimmende Hoffnung, dass ich mich aufgemacht hatte, ein neues Leben zu beginnen.
Ich muss gestehen, nicht viel von der Autofahrt mitbekommen zu haben. Frankreich durchquerte ich beinahe wie in Trance. Metz, Nancy, Dijon, Lyon, Montpellier. All das zog an mir vorbei wie im Traum. Die Mautstellen, daran fehlt jegliche Erinnerung. Ich schlief zweimal für jeweils drei Stunden an irgendwelchen Raststätten. Es war einfach ein schmerzlicher, weil zu ähnlicher Weg, blickte man auf unsere Urlaube zurück. Ich hatte große Mühe nicht daran zu denken. Ich lenkte mich ab, dachte über die unterschiedlichsten Formen von Ängsten nach. Achluophobie. Angst vor Dunkelheit. Acrophobie. Die Angst vor Höhe. Aquaphobie. Die Angst vor Wasser. Alektorophobie. Die Angst vor Hühnern. Dann versuchte ich mir die Sehenswürdigkeiten Mallorcas ins Gedächtnis zu rufen. Ich hatte sie einem Reiseführer vor Fahrtbeginn entnommen. Die Kathedrale von Palma. Das Kloster Lluc. Die Gärten Alfabias. Die Halbinsel Cap Formentor. Die enge Schlucht Torrent de Pareis, die nach Sa Calobra führt. Oder das romantisch anmutende Bergdorf Valldemossa, das etwa siebzehn Kilometer von Palma entfernt lag. All das wollte ich mir anschauen, dieser Vorsatz war in mir gereift. Ich wollte hier meine Seele baumeln lassen, in den wenigen Tagen, die ich mir nach diesem Vortrag gönnen würde. Aber in diesen Gedanken, so muss ich gestehen, war ich doch ziemlich überanstrengt. Erst bei Perpignon, nahe der spanischen Grenze, wurde es mir leichter. Girona, dann war Barcelona nicht mehr weit.
Über tausendzweihundert Kilometer lang hatte mein inzwischen siebzehn Jahre alter Volvo Kombi geschnurrt wie ein Kätzchen, aber nachdem ich Barcelonas City auf der B10 durchfahren hatte und in die Straße zum Terminal – die Ronda del Litoral –, einbog, da begann er plötzlich zu husten, zu röcheln. Er ruckelte ein paar Mal, dann gab der Motor keinen Mucks mehr von sich und ging einfach aus. Kein Anzeichen eines Defekts. Keine Überhitzung. Es war, als wäre mein Volvo einen plötzlichen Herztod gestorben. Dabei hatte ich ihn immer pfleglich behandelt und war maximal mit hundertdreißig Stundenkilometern über die Autobahn gezockelt. Alte Leute jagt man auch nicht die Treppe hoch. Ich schaute frustriert auf den Tachometer, auf dem genau vierhundertzwölftausend Kilometer angezeigt wurden. Dann schaute ich auf die Uhr. Ich hatte mir die Fahrt gut eingeteilt, es war kurz nach einundzwanzig Uhr und die Fähre legte um dreiundzwanzig Uhr ab. Aber, was tun? Den abgeschleppten Volvo mit auf die Fähre nehmen? Auf Mallorca reparieren lassen? Ihn hier auf einem Dauerparkplatz abstellen? Letzteres schien mir die beste Lösung zu sein. Ich suchte also mit Hilfe meines Handys nach einem Abschleppdienst, während eine ganze Reihe von voll beladenen 40-Tonnern und urlaubswütigen Touristen-PKWs an mir vorbeirauschten. Hin und wieder hupend, schimpfend oder beides. Obwohl ich die „Unfallstelle“ ordnungsgemäß mit Warndreieck und eingeschalteter Blinkanlage abgesichert hatte.
Den Abschleppdienst zu kontaktieren wurde zur nervenaufreibenden Angelegenheit. Es liefen automatische Ansagen, mit – für mich zu schnell gesprochenem – spanischem Kauderwelsch. Nahm mal jemand ab, verstand man mein Englisch nicht, bat Spanisch mit mir zu sprechen und legte angesichts meines Gestammels irgendwann einfach auf. Nach acht erfolglosen Versuchen verließ mich der Mut. Sechshundert Meter vom Terminal entfernt würde ich meinen treuen Gefährten wohl zurücklassen müssen. Wollte ich die Fähre nach Palma nicht verpassen. Ich war schon dabei, den Volvo abzuschließen, meinen Trolley hatte ich bereits aus dem Kofferraum geholt, als ein Truck neben mir hielt, der Fahrer die Scheibe heruntersurren ließ und mich kaugummikauend ansprach.
„Charly. Aus Aachen. Rollrasen und jede Menge Bier hab ich drauf.“
Er malmte zweimal kräftig auf seinem Kaugummi.
„Hat dein Hobel schlapp gemacht? Der alte Schwede ...“
Ich taxierte ihn. Verschwitztes Gesicht. Langes, dunkles Haar, zum Zopf gebunden. Muskelshirt. Kräftige Oberarme.
„Ich nehme eigentlich gleich die Fähre nach Palma. Aber ich weiß nicht wohin mit dem Auto.“
Charly kaute wieder, dann grinste er.
„Bin spät dran. Du bist spät dran. Passt. Bist du auf der Fortuny?“
Ich nickte.
„Ich auch. Also, zieh ich deine Karre bis vorn zum Terminal und dann kannst du mit denen was aushandeln.“
Es war klar, dass ich ein solches Angebot nicht ablehnen konnte. Charly war schneller als schnell. Er hatte binnen zwei Minuten das Abschleppseil angebracht und fünf Minuten später stand ich mit meinem Volvo am Terminal.
Es regelte sich tatsächlich alles. Na ja, nahezu alles. Zuerst wollte der Terminalmitarbeiter meinen Volvo kaufen. Aber das kam nicht in Frage. Dann ließ er gegen eine Gebühr von hundertfünfzig Euro meinen Volvo von zwei Einweisern in eine kleine Garage schieben, die neben zwei Blechcontainern stand. Was sie sonst darin lagerten oder parkten war mir nicht klar, denn jetzt stand sie leer. Aber dort würde mein Volvo bleiben, bis ich ihn abholte.
Dieser Luis, ein Mitarbeiter der Fährgesellschaft, der mit mir die Abmachung traf, fragte abschließend, wann ich den Wagen abholen würde. Da ich ihm keinen genauen Tag nennen konnte, zeigte er mir schelmisch grinsend seine großen gelben Zähne und erklärte, er werde den Volvo für genau vierzehn Tage hier stehen lassen. Danach würde er in eine Parkgarage verbracht. Dann kämen weitere Kosten auf mich zu. Würde ich den Wagen nicht nach drei Monaten auslösen, so ließe er das Fahrzeug kostenpflichtig entsorgen. Das waren gute Bedingungen. Ich dankte ihm sehr, nahm meinen Trolley und machte mich auf, die Fähre Fortuny zu besteigen, die am Pier vertäut lag. Die ersten Vehikel fuhren bereits über eine Rampe in den Schiffsbauch hinein. Ich suchte in der Fahrzeugschlange nach Charlys LKW. Besonders bei ihm wollte ich mich für seine tatkräftige Hilfe bedanken. Nachdem er meinen Wagen am Terminal abgekoppelt hatte, war er eilig weiter zum Ticketschalter gegangen, um seine Papiere abzuholen und ich hatte ihn aus den Augen verloren.
Ich entdeckte ihn in der Schlange wartender Fahrer schon von weitem. Er schrie und tobte. Vor Charly stand ein Einweiser der Fährgesellschaft. Er ließ sich von dem Trucker überhaupt nicht beeindrucken, schaute nur auf sein Klemmbrett und wippte sachte mit seinen Füßen von den Fersen zu den Zehenspitzen.
Ich ging zu Charly hin, unterbrach ihn in seinem Redeschwall und wollte wissen was los ist.
Charly konnte sich gar nicht beruhigen.
„Die sind doch verrückt! Ich hab so gerade noch einen Platz gekriegt, obwohl einer fest gebucht war von unserer Disposition. Aber die haben keine Kabine mehr für mich. Alles belegt. Angeblich.“
„Und jetzt?“
„Jetzt kann ich auf einem Stuhl im Fährenrestaurant pennen. Im Führerhaus darf man ja nicht. Die Bandscheibe wird sich freuen.“
Es war ein Reflex, selbstverständlich. Ich schaute ihn an, er war gepflegt, hatte Manieren und einen guten Kern. Er hatte geholfen, obwohl er unter Druck stand. Ich war von seiner Anständigkeit überzeugt und so sagte ich ihm, dass er, wenn es ihm nichts ausmache, in meiner Kabine übernachten könne. Ich hätte eine Vierer-Kabine bekommen, reise aber allein, sodass genügend Platz vorhanden sei.
Charly schaute mich zwei Sekunden lang an und ich sah in seinen Augen was er dachte. Dann nickte er.
„Okay“, quetschte er hervor, „vielleicht komm ich drauf zurück.“
Ich sagte ihm meine Kabinennummer, dann ließ ich ihn stehen. Er schien besänftigt, ich hörte noch, wie er ein wenig in sich hinein grummelte, den Einweiser davonziehen ließ, wieder in seinen Truck stieg und kurz darauf ein Stück weiter Richtung Auffahrrampe fuhr. Dann war er aus meinem Blickfeld verschwunden.
Ich hatte im Bordrestaurant fürstlich gespeist. So kam es mir jedenfalls nach Wochen der Askese vor. Ich nahm als Vorspeise eine Zarzuela, für meinen Geschmack war die Fischsuppe allerdings ein bisschen zu stark mit Chili gewürzt. Dann, als Hauptgericht, entschied ich mich für Kotelett vom Iberico-Schwein mit Kartoffel-Oliven-Stampf und zum Dessert wählte ich vom Buffett eine Crème brûlée. Köstlich. Ich gönnte mir ein kaltes Bier und genoss. Es war laut im Restaurant. Deutsche, Franzosen, Engländer, Spanier und andere Nationalitäten hielten ihre Tischgespräche. Manche fotografierten sich selbst, die Tischnachbarn und das Essen, wohl um den weltbewegenden Moment gleich mit anderen via Internet zu teilen.
Mich störte all das nicht. Der Trubel zeigte mir vielmehr, in welcher Abgeschiedenheit ich doch die letzten Monate verbracht hatte.
An der Reling des Oberdecks lehnte ich. Der kräftige Abendwind blies mir ins Gesicht. Ich kniff die Augen zu schmalen Schlitzen und sah, wie die glitzernden Lichter von Barcelona langsam am Horizont verschwanden. Sah, wie die starken Motoren des Schiffs das Wasser unter mir aufwühlten und es brodeln ließen. Mein Blick glitt über das schwarze Wasser, das nur vom beinahe vollen Mond beschienen wurde und dessen sanften Wogen hin und wieder aufblitzten.
Was würde mir diese Reise bringen? Ich sah mich im Geiste schon auf einem Mountain-Bike strampelnd die Insel erkunden. Einen kleinen Rucksack mit Wasser und Proviant auf den Rücken geschnallt. Ich musste bei diesem Gedanken unwillkürlich lächeln. Von der Schnapsdrossel zur Sportskanone.
Eine Weile hatte ich sinniert, hatte die verliebten Paare beobachtet, die miteinander turtelten, die aufgekratzten Familien, die ebenso an Deck gekommen waren, um sich vor der Bettruhe ein wenig die Beine zu vertreten.
Die Geschäftsleute telefonierten noch. Einige von ihnen versuchten zu rauchen. Kurz dachte ich noch darüber nach, ob jemand von den Kongress-Besuchern wohl ebenfalls mit einer Fähre nach Palma unterwegs war, als Charly neben mich trat. Er hatte sich eine Fleece-Jacke übergezogen und trug eine grüne Wollmütze auf dem Kopf. Er nickte mir zu.
„Kriege leicht Mittelohrentzündung.“
Ich schaute ihn verständnislos an.
„Ich mein, wegen der Mütze.“
Ich nickte. „Kenne ich. Meine jüngste Tochter, die war auch so empfindlich an den Ohren.“
Charly schaute mich an. Er wollte etwas sagen, blieb aber dann doch stumm.
Er brauchte eine Weile.
„Ist schon komisch, was, lange Fahrt, man ist hundemüde, aber man kommt nicht runter.“
„Vielleicht tut es ein Absacker“, sagte ich.
Wir tranken jeder zwei Ramazotti, zwei Fernet Branca und zwei Dosen Corona Bier. Danach war ich ziemlich geschafft. Charly nahm seinen Rucksack und folgte mir in die Kabine. Ich bot ihm an zu duschen, aber er legte sich in voller Montur aufs Bett und starrte zur Decke.
Ich aber wollte auf eine Dusche nicht verzichten. Sie war eine Wohltat. Als ich mich dann im Doppelstockbett, das seinem gegenüber lag, verkrochen hatte, kam endlich ein richtiges Gespräch zustande. Charly erzählte von seiner Frau, von der er getrennt lebte, nachdem er sie mit einem Liebhaber erwischt hatte. Von seiner Schwäche für dunkelhaarige Frauen, besonders, wenn sie gelbe Shirts tragen. Die er sich aber niemals traut anzusprechen. Seinem Hobby Hochseefischen, bei dem er mal einen dreieinhalb Meter langen Hai zur Strecke gebracht hatte. Davon, deutschen Finca-Besitzern kiloweise Sauerkraut mit Eisbein zu liefern und seinen LKW immer auf einem Parkplatz nahe des Aquariums in Palma abzustellen, wenn er rastet. Er berichtete, er fahre die Mallorca-Touren schon seit sechs Jahren und betonte, es sei eine besonders gute Arbeit. Dieser Mallorca-Trip. Für einen Fernfahrer. Er wollte wissen, warum ich auf die Insel ginge, ich sähe nicht aus wie ein typischer Tourist. Ich klärte ihn mit wenigen Worten auf.
Ein Kongress? Er wurde neugierig und fragte, ob ich ein Unternehmer oder Ingenieur sei. „Golfen, Saufen, Rumhuren“, sagte er. „Und das Ganze auf Firmenkosten.“
„Ich bin Psychologe. Es ist ein Seminar zum Thema Angst. Ich halte dort einen kleinen Vortrag.“
Charly lachte dröhnend. „Sachen gibt’s“, sagte er. „Ich kann dir auch ne ganze Menge über Angst erzählen. Zum Beispiel, als ich nachts mal in meinem LKW überfallen worden bin. Die Kerle haben einfach die Fahrertür aufgehebelt und mich mit einem Messer bedroht.“
„Und dann?“
Charly grinste. „Haben sie nicht damit gerechnet, dass ich immer mit einer Walther unterm Kopfkissen schlafe. Die waren schneller wieder weg als ich gucken konnte.“
Ich sah ihn zweifelnd an. Ich mochte auf den ersten Blick wie ein Lebowski wirken, aber Charly machte keineswegs den Eindruck ein Rambo zu sein. Oder hatte ich mich so sehr in ihm getäuscht?
Charly legte nach. „Ich hab ein paar Jahre im Knast gesessen. Wegen schwerer Körperverletzung. Ich dachte, ich wär ein harter Bursche, aber da konnte man mal so ein paar richtige Granitbrocken kennenlernen. In der Dusche hast du Angst gekriegt, die Seife fallen zu lassen. Hat einer mal versucht, mich anzufassen, aber dem hab ich ganz schön eins zwischen die Rippen gegeben. Dabei hatte ich eine Scheißangst, dass ich mir fast in die Hosen gemacht hätte. Also, ich meine, wenn ich denn welche angehabt hätte.“
Ich sog scharf die Luft ein.
„Es soll darum gehen, wie man Ängste therapiert und ich finde es eine gute Sache, wenn man das Problem offen angeht.“
Charly schmatzte auf seinem Kaugummi herum.
„Hat meine Susi auch gemacht. Ich meine, als sie noch meine Susi war. Sie hatte Angst vor Spinnen. Sie hat das ganze Haus zusammengeschrien. Unglaublich. Gut, dass ich so selten zu Hause war. Ein klitzekleiner Schneider, weißt du, das Viech mit den ganz dünnen Beinchen und sie war gleich dem Herztod nahe. Ich musste die Tierchen immer töten, man durfte sie nie am Bein fassen und dann raustragen. Das reichte ihr nicht. Sie mussten tot sein.“
„Hast du es nicht mal versucht, ihr zu zeigen, dass man vor Spinnen keine Angst haben muss?“
Charly schüttelte sich.
„Du wirst es nicht glauben, aber ich habe wirklich eine Desensibilisierung versucht. So nennt man das doch. Ich bin in eine Zoohandlung. Hab mal was für die transportiert, da kannte ich den Händler. Ich habe eine wunderschöne Vogelspinne übers Wochenende ausgeliehen. Sie war lieb und überhaupt nicht gefährlich. Sie hatte sogar selbst Angst ohne Ende und haarte, als ich sie auf die Hand nahm. Ich wollte, dass Susi die Spinne mal berührt, dass sie das Tier auf die Hand nimmt, dass sie sich ins Bett legt und die Spinne über die Decke krabbeln lässt. Aber was macht Susi? Sie rennt schreiend aus dem Haus und lässt von Nachbarn den Kämmerer holen.“
Ich schaute ihn mitleidig an. „Vielleicht war es gar nicht die Angst vor der Gefahr, vielleicht war es ein Ekelgefühl...“
Charly wälzte sich auf dem Bett hin und her. „Die hatte einfach einen Lattenschuss. Das fing mit den Spinnen an und ging dann immer weiter. Sie hatte später Angst vor Mäusen, Ratten, Schlangen, Katzen, Hunden. Sogar vor Vögeln. Dabei hatte ich alles Wochen zuvor verkauft. Die Terrarien und auch die Volieren. Alles ihr zuliebe.“
Ich antwortete, dass es mir leid für ihn täte. Dann schwiegen wir eine Weile. Bevor wir einschliefen, sagte Charly noch, dass er es super finde, dass er hier nächtigen dürfe und dass ich davon ausgehen könne, dass er seine Walther wieder unter dem Kopfkissen hätte. Und dann bin ich in einen unruhigen Schlaf verfallen, in dem ich von meinem Volvo träumte. Ich war auf der Flucht vor jemandem, sprang in meinen Volvo hinein und drehte den Zündschlüssel. Er sprang beim dritten Startversuch an und ich entkam. Als ich am nächsten Morgen erwachte, es war kurz nach sechs, da war Charly bereits verschwunden. Ich fand auf seinem Kopfkissen einen Zettel. Danke. Viel Erfolg. Wenig Angst.