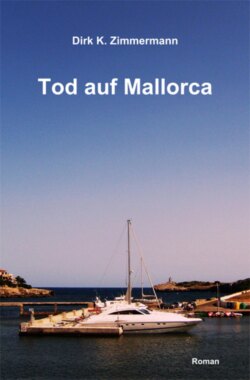Читать книгу Tod auf Mallorca - Dirk K. Zimmermann - Страница 6
Оглавление2
Ich war von einem Taxifahrer in Empfang genommen worden. Er hieß Miguel Cordoba, wie ich später an seiner Lizenzkarte im Auto feststellte. Als ich ihm begegnete, hielt er am Pier einen Karton mit der Aufschrift Global Sensual Maxx empor, begrüsste mich freundlich in fließendem Deutsch und hofierte mich nach allen Regeln der Kunst, bis ich neben ihm auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. Mit seinem salzverkrusteten, cremefarbenen Van kutschierte er mich zielsicher aus Palma heraus. Er sprach wenig mit mir, erklärte aber kurz nach Fahrtbeginn, dass er den Auftrag habe, wie ich sicher wisse, mich zunächst zum Hotel zu bringen. Nach dem Einchecken werde sich Mandy um mich kümmern.
Nach Peguera waren es gute vierundzwanzig Kilometer von Palma. Und ich hatte bereits im Internet über das Luxushotel Five White Stripes Deluxe gelesen. Nur hundertfünfzig Meter vom Strand entfernt gelegen. Ein Wellnesstempel. High Class. Eine Oase der Ruhe und Reinheit.
Da wir die nächsten zehn Minuten keinen Smalltalk miteinander hielten, konnte ich ungefiltert die ersten Eindrücke dieser Insel in mich aufsaugen. Ohne Vorbehalte, ein äußerst angenehm wirkender Ort, Palma.
Das, was mich am meisten inspirierte, als wir in zügigem Tempo über die Stadtautobahn MA-1 Richtung Südwesten fuhren, war eine riesige Werbetafel mit der Aufschrift: El Mallorca, que todos queremos! – Das Mallorca, das wir alle wollen.
Aber, was wollten denn alle? Vor allem die Insulaner? Ich fühlte mich zu ein wenig mehr Konversation berufen und erkundigte mich danach, was Mallorca momentan prägt und bewegt.
Der Taxifahrer setzte sich seine Sonnenbrille auf und überlegte einen Moment. „Wir warten auf die ‚Königin der Nacht’.“
Ich dachte, es handele sich um eine berühmte Schauspielerin, Tänzerin oder Sängerin, die den Weg nach Mallorca finden und das Jetset-Leben bereichern würde.
„Bin nicht so der Tänzer“, sagte ich, „und mit Prominenten kenne ich mich erst recht nicht so aus. Wer ist das?“
Der Fahrer grinste breit.
„Die Königin der Nacht, das ist eine Kaktusart, die nur eine Nacht im Jahr blüht. Und im Juni ist es soweit. Das Highlight der Saison ist das.“
Er lachte aufgesetzt angesichts der Banalität dieser pflanzlichen Attraktion und wurde dann schnell wieder ernst.
„Was geht so ... nicht viel. Wenig Arbeit. Kann ja nicht jeder im Tourismus beschäftigt sein. Ein Denkmal soll abgerissen werden, wegen Kriegsverherrlichung. Es geht um den Untergang eines Kriegsschiffs. Die Stadtobersten streiten sich drum. Aber ein anderes wurde dafür aufgebaut. Ein Gedenkstein über den Bruderkrieg von 1522.“
Ich schaute ihn neugierig an. Er spürte wohl mein Interesse und feuerte voller Überzeugung eine schnelle Wortsalve ab.
„Die verarmte Inselbevölkerung hat sich gegen die mächtigen Adligen, reichen Landbesitzer und Kaufleute aufgelehnt. Dabei starben tausend Bruderschaftler auf dem Feld von Son Fornari. Sie haben für die Rechte des Volkes und das Allgemeinwohl der Mallorquiner gekämpft.“
Ich erwiderte nichts darauf, aber meine Gedanken kreisten. Warum erzählte er mir von Tod und Gewalt? Wo er doch wusste, dass ich einen Kongress besuchte, der Ängste thematisierte. Er schien wohl meine Gedanken zu ahnen, denn er schob rasch einen Satz nach.
„Die einen fürchten um ihr Ansehen, die anderen haben Angst davor, dass man die Gräueltaten vergessen könnte.“
Wir schwiegen, bis wir das Hotel erreichten. Ich stieg aus, dankte ihm, gab ihm ein Trinkgeld und er reichte mir meinen Trolley. Dann schob er die Sonnenbrille hoch. Seine braunen Augen blitzten. „Wird schon schiefgehen“, sagte er, tippte sich zum Gruß an die Stirn. „Denken Sie immer daran, Gott ist mit Ihnen.“ Als ich die Eingangshalle des Hotels passierte und meinen Namen an der Rezeption nannte, war Miguel Cordoba bereits verschwunden.
Ich nahm das Zimmer in Augenschein. Stilvoll, keine zu Tierfiguren gefalteten Handtücher auf dem Bett. Mediterran und gleichzeitig von geschmackvoller Zurückhaltung. Vielleicht einen Hauch zu steril, zu glatt, zu sauber.
Ich hatte den Trolley gar nicht ausgepackt, war schnell wieder nach unten gegangen und hatte einen von diesen grünen Fruchtcocktails in der Lounge getrunken. Er schmeckte nach Mango, Guave, Limette und Kiwi, trug aber einen eigentümlichen, beinahe medizinisch anmutenden, leicht bitteren Nachgeschmack mit sich. Mandy Conchita Williams entpuppte sich als dunkelhaarige Schönheit, gekleidet in ein zitronengelbes Partykleid. Sie war einfach zuckersüß, perfekt geschminkt und sah aus, als sei sie soeben einer Model-Sedcard entsprungen. Die Lady roch bezaubernd und verströmte ihre Aura mit jedem Schritt im ganzen Raum. Sie hob ein Glas Sekt und sprach ein paar Worte zur Begrüßung an die vielleicht ein Dutzend Anwesenden. Sie wies mit ihren leuchtend rot lackierten langen Nägeln auf die Flipchart, wo in großen Lettern der Slogan der Veranstaltung stand: Gegen die Angst.
„Um die Berührungsängste abzubauen“, sagte sie, „das Eis zu brechen, an einem Ort, der voller Wärme und natürlicher Schönheit ist, wie Sie bereits sicher feststellen durften, möchte ich Sie nun bitten, sich einander nur mit Ihren Vornamen vorzustellen. Ich denke, in dieser erlesenen überschaubaren Gruppe sollte dies kein Problem darstellen. Wir befinden uns an einem Ort, wo häufig das Gefühl aufkommt, als Deutscher unter Deutschen zu sein. Und da wir ja eine große Familie sind, so ist es doch selbstverständlich sich zu duzen.“
Manche blieben ernst, andere lächelten, als ob es sich um ein naives Spielchen handelte, aber alle Anwesenden folgten Mandys Aufforderung. Sogar die Gesundheitsministerin, die dem Kongress ihre Aufwartung machte, schüttelte brav den übrigen Gästen die Hand und stellte sich mit „Angenehm, Helga“, ziemlich spröde vor.
Mit Helga wurde ich unerwartet schnell warm. Sie sprach von eisernen Banden und der Etikette, die sie gefangen halte, während sie mein langes Haar betrachtete und selbst mit den Fingerspitzen an ihrer grauen Kurzhaarfrisur herumzupfte. Als ich ihr von meiner Flugangst erzählte, beichtete sie mir, dass sie sich bereits seit einigen Jahren in psychotherapeutischer Behandlung befände. Parasitophobie. „Ich habe unheimliche Angst vor Zecken“, gestand sie. „Diese elenden Blutsauger. Das sind Biester. Die Viecher werden immer mehr, sie sind hartnäckig und unheimlich zäh.“ Helga rollte mit den Augen und ich war froh, dass sie in meiner Gegenwart nicht gleich zu hyperventilieren begann.
Ich versuchte die Zeckengefahr herunterzuspielen, wies auf die gut erforschten und bekannten Behandlungsmethoden hin und die sehr guten Heilungschancen, falls man einmal tatsächlich an Borreliose erkrankte. Aber sie hörte mir gar nicht zu. Sie öffnete ihr Handtäschchen, griff hinein und zeigte mir ihre Zeckenzange und das mitgeführte Antibiotikum. „Ich überlasse nichts dem Zufall“, flüsterte sie mir ins Ohr. „Ich habe in allen Krisengebieten Zeckenwarnschilder aufstellen lassen. Die Lyme ist schrecklich. Sie befällt alle Organe. Und das Rückfallfieber, ich mag gar nicht daran denken.“ Ihre Hand zitterte leicht. Sie fuhr sich mit den Fingern über ihre Stupsnase und kratzte sich dann hinter dem linken Ohr. Helga war von der Notwendigkeit des Kongresses überzeugt, so viel stand fest. Oder vielleicht besser: Sie war ein dankbares Opfer. (Kurz befiel mich der Gedanke, ob Global Sensual Maxx von meiner Flugangst wusste, von meiner Furcht zu versagen, ehe sie mich anriefen, aber diesen Gedanken verdrängte ich schnell wieder.)
Außer Helga lernte ich Georg kennen, einen Mediziner von der Universität Göttingen. Ich machte Bekanntschaft mit Carl-Maria, Chefentwickler eines Pharmaunternehmens und Vorsitzender einer Kommission der Gesundheitswirtschaft, begrüßte den Marketingspezialisten einer führenden Handelskette mit Namen Dennis und den Agentursprecher Tilman, kurz Til, der sich trotz der Hitze in einem schwarzen Designeranzug präsentierte und sich ständig mit einem weißen Taschentuch die Stirn abtupfte.
Wir stellten uns im Kreis zusammen, sprachen darüber, wie empfindlich die Deutschen doch auf Gefahren reagieren. Dennis’ Stichwort hierzu war Dampfkessel. 1830 sei bei uns die Dromosiderophobie ausgebrochen, wusste er zu berichten; die Angst davor, dass Dampfkessel explodieren. Helga war gut präpariert. Sie entgegnete, dass derzeit über zwanzig Prozent der Bevölkerung an Angststörungen erkrankten, und dass man alles tun müsse, um diese Quote zurückzudrängen. Das war Wasser auf die Mühlen der übrigen Anwesenden. Ich wendete ein, man dürfe die Angst als Urinstinkt nicht verteufeln, aber davon wollte niemand etwas hören. Der Tenor war, es gehe darum, die Ängste auszuschließen, gelassener zu werden. Hysterie, Schwarzmalerei und Untergangsstimmung im Ansatz zu ersticken, um gesellschaftlich stark zu sein. Wachstumsziele zu erreichen. – Ich fühlte mich plötzlich unwohl. Was meinten sie mit „den Ängsten“? Die erlernten Ängste, die überhandnahmen, die krankhaften Entwicklungen, die aus der Konfrontation mit einer komplizierten industriellen Welt erwuchsen?
Meine Aufgabe lag während der Veranstaltung nur darin, zum Thema hinzuführen, aber machte ich mir einen Reim auf die Rednerliste, so würde den Journalisten (die vermutlich allesamt Hofberichterstatter waren, wahrscheinlich in einem anderen Hotel untergebracht wurden und sich die Zeit bis zum Kongressbeginn möglicherweise am Strand oder am Pool vertrieben) in wenigen Stunden ein solides Gerüst aus Forschungsergebnissen und innovativen Behandlungsmethoden vorgeführt. Alle Pressevertreter veröffentlichten diese Informationen dann, verbreiteten sie an die Bürger, die, selbst weiter verunsichert, sich aufgefordert fühlten, ihre Ängste offensiv anzugehen, oder sie überhaupt erst an sich zu entdecken. Und dann war man bereits in die Falle getappt. Ein Teufelskreislauf. Und die Gesundheitsindustrie, meine Wenigkeit eingeschlossen, denn ich würde ja eine Menge Angstpatienten in meinen Sitzungen therapieren dürfen, rieb sich die Hände.
Das Unwohlsein angesichts dieser Perspektiven war bei mir so stark, dass ich mich, unter dem Vorwand, dringend telefonieren zu müssen, auf mein Zimmer begab. Die Redner bemerkten nichts von meiner Unpässlichkeit, so hatte ich den Eindruck. Sie sprachen übers Golfen, rissen kurz das Thema Alzheimer an, dann war ich auch schon aus der Lounge hinaus und hatte mich davongemacht. Mandy war mir hinterhergekommen. Am Fahrstuhl holte sie mich ein. Sie erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Ich bejahte und sagte ihr, wie sehr ich mich doch freue, Teil dieses Kongresses zu sein. Das hatte sie keinen Verdacht schöpfen lassen und ich war ihr entkommen. Es war für mich wie eine Befreiung, als ich die Hotelzimmertür hinter mir schloss. Ich wollte mich aufs Bett legen und entspannen. Aber soweit kam ich gar nicht. Auf dem Sekretär entdeckte ich eine – wohl von der Agentur hinterlegte – edle schwarze Ledermappe. Beim ersten Hineinkommen hatte ich sie anscheinend übersehen oder man hatte sie später – nach meinem Hinausgehen – dort platziert. Ich nahm die Ledermappe hoch, besah sie von allen Seiten. Es war echtes, gutes, teures Leder. Ich öffnete den goldenen Reißverschluss an der Längsseite und klappte die Mappe auf. Der Inhalt versetzte mich in Staunen.
Ein schwerer Füllfederhalter, ein kleiner Notizblock, ein Druckbleistift. Das war, trotz der Exklusivität, noch recht normal für eine Veranstaltung dieser Kategorie. Aber im Visitenkartenfach steckten zwei in Aluminiumfolie eingeschweißte Pillensorten. Jede Folie enthielt drei Pillen. In der ersten Folie waren die Pillen recht groß und von roter Farbe. In der zweiten Folie waren die Pillen kleiner und von grüner Farbe.
Zwischen ihnen beiden steckte ein kleiner Zettel: Überzeugen Sie sich von unseren exzellenten Medikationen mit Retardwirkung. Nehmen Sie eine rote Pille alle 24 Stunden, wenn Sie unter Depressionen leiden. Nehmen Sie die grüne Pille alle 24 Stunden, wenn Sie unter Ängsten leiden. Sind Sie depressiv und leiden gleichsam unter Ängsten, nehmen Sie beide Pillen auf einmal. Sie beeinträchtigen sich nicht in ihrer Wirkung und schädigen nicht ihre Gesundheit.
Ich hielt es für einen Werbegag. Man kennt das. Die als Medikamentenschachteln getarnten Süßigkeiten, die man dann zu bestimmten Anlässen, zumeist Geburtstagen oder Jubiläen verschenkte. Ich legte die Mappe neben mich aufs Bett und versuchte zu entspannen. Es gelang mir nicht. Wirrwarr und Tumult im Kopf. Konnte es sein, dass sie uns tatsächlich einen ernstgemeinten Selbstversuch angeboten hatten? Wollten sie, dass wir – alle fünf Redner – diese Pillen schluckten? Hatte ich nur zu wenig Informationen und würde spätestens in zwei oder drei Stunden wissen, ob sie diesen Kongress nur ins Leben gerufen hatten, um ein neues Produkt, vielleicht sogar zwei neue Produkte am Markt zu etablieren?
Ich nahm die Folien mit den Pillen zur Hand, drehte sie zwischen den Fingern. Keine Haltbarkeitsdaten, keine Produktions-Kontrollnummern. Keine Umverpackung. Kein Beipackzettel. Das war doch hanebüchen. Wie sollten der Hersteller – wer immer es auch war – und die Agentur davon ausgehen, dass man wirklich diese Tabletten nahm? (Jetzt gleich oder irgendwann später.)
Ich war versucht, Mandy Conchita Williams anzurufen und sie danach zu fragen, aber ich ließ es dann doch. Ich wollte die Stimmung nicht verderben und wenn es sich tatsächlich nur um einen Reklamegag handelte, war ich bloßgestellt. Also blieb ich. Während des Kongresses würde es sehr schnell herauszufinden sein, ob dieses Zusammentreffen eine reine Werbeveranstaltung für neue Produkte zur Angsttherapie war.
Der Hörsaal im Gemeindezentrum Casal de Peguera fasste ungefähr dreihundert Personen und war bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein Gruppen-Stelldichein für Journalisten, Fotografen, Apotheker, Mediziner, Soziologen, Psychologen, Ergotherapeuten, Industrielle aus der Pharmabranche. Aus ganz Europa. Nein, weltweit. Mandy Conchita Williams hatte alles im Griff. Sie wies mit zwei Hostessen den Gästen die Plätze zu, verteilte Ausweise und Flyer und machte rundum einen bezaubernden Eindruck.
Und ich, als erster Redner nach der Begrüßungsansprache von Til an der Reihe, geriet ziemlich ins Schwitzen. Zumindest anfangs, denn ich hatte längere Zeit nicht mehr vor Publikum gesprochen, meine Stimme war plötzlich rau. Rau war gelinde gesagt. Sie war weg. Ich musste mehrfach Wasser trinken und mich räuspern. Sie wieder zurückholen. Aber dann, als lege sich ein Schalter um, war das Lampenfieber wie fortgeblasen, die spürbare Röte auf meinen Wangen nahm ab und meine Hände wurden trockener. Das Herzklopfen, das sich bis in die Schläfenfasern wie ein pochender Wurmfortsatz breitgemacht hatte, nahm ab. Vielleicht lag es an den freundlichen Worten meines Vorredners, dass er mich als Koryphäe auf dem Gebiet der Traumforschung bezeichnet hatte, dass er es danach als Glücksfall bezeichnete, dass ich heute Zeit gefunden hatte, um die Einführungsrede zum Thema Angst zu halten.
Ich holperte nicht in meiner Rede, ich hatte keinen Blackout und ich zog mein Programm auch nicht nur durch. Nach geschlagenen zwanzig Minuten Vortrag kam ich zum Ende und ein starker Applaus brandete auf. Ich hatte dem Treffen einen guten Einstieg verliehen, da durfte ich mir sicher sein.
Aber wie sah es mit der Unbescholtenheit des Symposiums aus? Gebannt folgte ich, in der ersten Reihe sitzend, ausnahmslos jedem Vortrag. Meine Befürchtungen waren grundlos gewesen. Niemand sprach im Detail über neue Medikamente, die gegen Depressionen oder Ängste eingesetzt werden sollten. Man referierte darüber, dass die Angst sich in der Hirnrinde speichere, dass man durch diese Erkenntnis überzeugt sein dürfe, dass Ängste kontrollierbar seien und nicht vom Patienten vergessen, aber doch unterdrückt werden könnten. Dass Ängste behandelbar seien, dass man mit einer engmaschig verzahnten Therapie nahezu angstfrei werden könne, insbesondere in diesem Zusammenhang wurden die Rufe nach einer unterstützenden Medikation laut. Einer Medikation, die eine gewisse Basis schaffe, eine Gelassenheit, um in der Welt zu sein. Diese Forderung stellten Carl-Maria, Dennis und Georg, jeder aus seiner Sicht interpretierend, und ernteten dafür einhellig Beifall.
In der Pause – vor Helgas Rede als krönendem Abschluss -, Sicherheitsleute machten auf dem Gelände bereits die Runde und ich knabberte an einem kleinen Lachshäppchen mit Meerrettichsahne, wurden meine Ko-Redner fleißig zu Interviews gebeten. Mich hingegen wollte niemand sprechen. Mir war es sehr recht so, denn, was hätte ich auch sagen sollen. Ich teilte die Ansicht meiner Kollegen nicht. Warum sollten Ängste durch Medikamente, die eine gewisse Gelassenheit auslösten, unterstützend bekämpft werden? (Schließlich hatte auch ich nur nach Betteln meines Therapeuten Walter Medikamente gegen die Depressionen geschluckt, aber keineswegs welche gegen die Ängste. Walter wäre auch nicht auf die Idee gekommen, mir welche zu verordnen.) Warum mochte man es nicht stattdessen mit Meditationen oder Entspannungsübungen versuchen, die, im Übrigen, nebenwirkungsfrei daher kamen?
Ich hörte ein bisschen bei den Smalltalks zu, verstand Gesprächsfetzen, die von Paragliding, Kite-Surfing, Tennis und Caving handelten, drängelte mich dann zu Mandy Conchita vor, die eigentlich gerade alle Hände voll zu tun hatte, den Hostessen Pakete mit Handzetteln zu übergeben. Ich fand, es war genau an der Zeit, sie mit meiner Frage zu überrumpeln.
„Mandy“, schnurrte ich, „ein toller Tag, ein wichtiger Tag. Aber ich habe vergessen mich zu bedanken.“
„Keine Ursache“, sagte Mandy Conchita mechanisch. „Aber es ist doch noch nicht vorbei, Herr Wallmann. Wir gehen doch nachher aufs Partyboot. Es gibt Gambas und Caipirinha. Oder auch viele andere schöne Sachen, falls Sie etwas anderes bevorzugen. Zum Beispiel einen Sailor Moon Cocktail. Ich liebe Caipirinha.“ Ihre Augen glänzten und sie lächelte gewinnend. Sie war einfach professionell. Ich lächelte zurück und schaute ihr kerzengerade in die Augen.
„Ja, das sind tolle Aussichten“, stimmte ich zu. „Darüber hinaus, ich muss Ihnen mein Kompliment aussprechen, die elegante Ledermappe mit den Pröbchen ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen gewesen.“
Mandy Conchita wies wortlos aber gestenreich die Assistentinnen an, die mit den Flyern ausschwirrten. In ihrem Gehirn arbeitete es, dann runzelte sie die Stirn.
„Was meinen Sie?“
„Na, Ihr Präsent. Die Ledermappe mit den Medikamenten.“
„Mit den Medikamenten?“
„Ja, die grünen Pillen und die roten Pillen. Ein toller Einfall, den Süßkram auf diese Weise zu verschenken. Sehr amüsant.“
Mandy Conchita zog mich näher zu sich heran.
„Herr Wallmann, Sie scherzen. Ich weiß beim besten Willen nicht, was Sie meinen. Wir haben Ihnen den seidenen Bademantel und die Flipflops als Präsent bereitgelegt, die sind für Sie, aber eine Ledermappe, das ist mir neu.“
Sie lächelte. Ich war irritiert. Und sie kam noch näher an mich heran und flüsterte beschwörend. „Herr Wallmann, ich darf Sie bitten, sich über einen solchen Fauxpas nicht mit anderen auszutauschen. Das könnte mich die Stellung kosten, das verstehen Sie doch?“
Ich schaute sie durchdringend an. Jetzt war es meine Stirn, die sich in Falten legte.
„Die Ledermappe ist definitiv nicht von Ihnen?“
In Mandys Augen blitzte es gefährlich. „Ich muss weitermachen, Sie entschuldigen. Und ich gebe Ihnen einen Tipp. Wenn Sie wirklich eine Ledermappe auf Ihrem Zimmer haben, und Sie wünschen diese nicht, warum schmeißen Sie das Ding nicht einfach in den Papierkorb.“ Sie schaute mich keck an, dann machte sie eine wirbelnde Handbewegung und ließ mich stehen.
Die Ledermappe war nicht von Global Sensual Maxx. Wer hatte sie hinterlegt? Ich wollte Mandy keine Schwierigkeiten machen, aber ich würde vor dieser Partyboot-Feier Nachforschungen dazu anstellen müssen. Eine ganze Weile grübelte ich darüber, bis mich ein anderes Ereignis aus meinen Gedanken riss. Die Gäste strömten bereits zum Einlass, da bemerkte ich, wie vom Weg her, der zur Eingangshalle führte, eine Frau, sie mochte etwa fünfzig sein, sich den Weg durch die Sicherheitskräfte zu bahnen versuchte. Ich sah es sofort, sie gehörte hier nicht her. Ihre Füße steckten in halb zerfetzten Espandrillos, dazu trug sie kurze, ausgefranste Bluejeans und eine verblichene orangefarbene Bluse. Ihr mittellanges, rotes Haar hatte sie sich zum Zopf gebunden. Sie war ungeschminkt und wirkte abgekämpft von Sonne und Hitze. Sie mochte einmal schön gewesen sein. Jetzt wirkte sie mager und ausgezehrt. Irgendwie verbissen.
„Lassen Sie mich durch, ich muss da durch“, keifte sie in akzentfreiem Deutsch. Zwei Sicherheitsleute packten sie und führten sie weg. Außer mir waren auch ein paar Gäste auf die Frau aufmerksam geworden, doch sie schüttelten nur lächelnd den Kopf und vertieften sich wieder in ihre Gespräche. Mein Blick aber folgte der Frau, ich sah, sie begehrte auf, sie wollte sich losreißen, ich hörte ihr Gekreische: „Lassen Sie mich los. Ich bin ein freier Mensch, Finger weg, verdammt noch mal. Sind Sie ganz bei Trost? Hände weg.“
Dann verlor ich sie hinter den Büschen aus den Augen und mit einem Mal war es mächtig still. Ich hörte, so sehr ich auch horchte, nur noch das wabernde Gemurmel der Menschen, die mich umgaben.
Was hatte diese Frau gewollt? War sie geistig verwirrt und durch Zufall auf das Kongressgelände geraten? Oder hatte sie jemanden sprechen wollen und wurde nicht vorgelassen? Der Gedanke beschäftigte mich, er bohrte sich tief in mein Innerstes. Ich verließ den Vorplatz der Eingangshalle und eilte den Weg entlang. Dorthin, wo die Frau aus meinem Blickfeld verschwunden war. Ich kam nur dreißig Meter weit. Ein Sicherheitsmann stellte sich mir in den Weg. Er wies in Richtung Halle. „Wollen Sie nicht hineingehen? Die Gesundheitsministerin ist bestimmt schon auf dem Podium ...“
Ich kratzte mich am Kinn. „Die Frau, diese rothaarige Frau, die da gerade so herumkrakeelt hat. Wo ist sie?“
Der Sicherheitsmann zuckte die Achseln. „Keine Ahnung. Auf ihrem Weg. Auf dem rechten Weg.“ Er grinste. „Manchen bekommt die Sonne einfach nicht.“
Er war wie eine Wand. Er blieb solange vor mir stehen, bis ich nach einigen Sekunden aufgab und zurückging. Ich schaute mich nochmals um, ehe ich die Halle wieder betrat. Der Sicherheitsmann war mir nachgekommen, hatte mich fest im Blick. Er versicherte sich, dass ich wirklich hineinging. Spätestens jetzt ahnte ich, dass Mallorca mehr zu bieten hatte als herrliche Natur und Urlaubsfeeling.
Zurück im Hotel musste ich mir allerdings eingestehen, wegen der Pillen hatte ich mir grundlos Sorgen gemacht. Ich sprach mit der Empfangsdame. Die Ledermappe rührte anscheinend noch von einer anderen Veranstaltung her. Deren Gast hatte sie wohl unangetastet im Zimmer liegen lassen oder sie schlichtweg vergessen. Die Empfangsdame entschuldigte sich und erklärte, die Mappe werde vom Zimmerservice gleich entfernt, aber ich schlug vor selbst hinaufzugehen und die Mappe am Empfang zu hinterlegen. Sie willigte ein. Ich weiß nicht, welcher Instinkt mich dazu verleitete, als ich die Ledermappe aus meinem Zimmer holte. Ehe ich sie zurückgab, nahm ich die Folien mit den Pillen einfach heraus und steckte sie mit dem Begleitzettel in die Tasche meiner Jacke. Meine scheinheilige Frage danach, welche Veranstaltung der Gast vor mir besucht hatte, etwa eine Messe oder ebenfalls eine Tagung, konnte mir die Rezeptionistin nicht beantworten. Sie lächelte mich freundlich an und sagte, es sei indiskret, solche Informationen herauszugeben. Ich entgegnete, mir gehe es um die Veranstaltung, nicht um den Namen des Gastes. Aber das wollte sie nicht gelten lassen. Sie sagte, ich könne sehr schnell selbst herausfinden, welche Veranstaltung es sei und zeigte auf die Internetecke im Foyer.
Mein Ehrgeiz war geweckt. Während Georg, Til, Rainer-Maria und Konsorten sich wahrscheinlich schon auf den Zimmern für die Bootparty in frische Kleider hüllten, saß ich in der Lobby am Rechner und forschte im weltweiten elektronischen Netz. Aber so sehr ich auch stöberte, ich fand keine Veranstaltung, die in den letzten Tagen auf der Insel stattgefunden hatte und gleichsam zum Thema Angst und Depression passte. Das kleine Rätsel konnte also nicht entschlüsselt werden, es sei denn, ich bestach den Nachtportier, um den Namen des Gastes zu erfahren, der die Ledermappe hätte eigentlich erhalten sollen. Aber das war mir dann doch des Guten ein wenig zu viel. Kurz war ich geneigt, an ein geheimes Treffen unter Eingeweihten zu denken, aber dann erschien mir der Gedanke zu kurios und abwegig.
Mein Cordanzug war ein wenig verknittert, ein frisches blaues Poloshirt zog ich noch an, frisierte mein Haar neu, band es mit dem schwarzen Gummi ordentlich im Nacken zusammen und gab ein paar Spritzer Eau de Parfum auf die Halsbeuge. Es war die Marke, die Anita mir geschenkt hatte, die sie an mir so liebte (besser: geliebt hatte) und ich benutzte es sehr sparsam, da das Duftwasser, so viel ich wusste, nicht mehr hergestellt wurde und schwer zu bekommen war. Ich brauchte Mut auf der Bootparty, viel Mut und so genehmigte ich mir ein paar Kurze aus der Zimmerbar, ehe ich zum abfahrbereiten Shuttlebus hinunterging. Was machte es schon? Ich hatte mich fit gemacht für den Vortrag, er war vorüber, ich nahm keine Medikamente, wer wollte da einem das Schlückchen Alkohol verwehren.
Ziemlich beschwipst bestieg ich das Partyboot und hatte dort Mühe, die Übersicht zu behalten. Es wimmelte nur so von gutaussehenden Hostessen, leicht bekleideten, beinahe ausschließlich weiblichen Bedienungen des Caterings, die Begrüßungsgetränke und Snacks reichten. Mittendrin natürlich die Redner (abgesehen von Helga) und jede Menge Industrielle. Die Reise führte von Palma zum Hafen von Andratx und wieder zurück – so hatte ich dem Flyer entnommen – erst in den frühen Morgenstunden würden wir wieder in Palma anlegen und dann das Hotel aufsuchen.
Ich stand eine Weile etwas verloren an der Reling, hielt mich an meinem Cocktailglas fest und genoss die Aussicht, als Carl-Maria, der Pharmareferent, und Marketingspezialist Dennis mir ein wenig Gesellschaft leisteten.
Sie sprachen davon, dass man bei Port des Canonge gut Polo spielen könne. Sie fragten mich, ob ich Interesse daran hätte, es zu versuchen. Ich lehnte dankend ab. Ich könne nicht reiten und mir zudem nicht vorstellen, im Sattel sitzend einem kleinen Ball nachzujagen.
Dennis klopfte mir auf die Schulter. „Albert“, sagte er, „warum so zugeknöpft, der Appetit kommt beim Essen. Vielleicht bist du der geborene Reiter und hast es nicht versucht.“
Carl-Maria lächelte sanft und wissend. „Keine Angst. Ich habe auch vor vielen Dingen ungeheuren Respekt gehabt. Aber ich habe es probiert und bin so zu einem kleinen Adrenalin-Junkie geworden. Speedclimbing, Wasserski, Rafting, Wingsuit Base Jumping – das ist einfach überwältigend.“
Ich war mehr als überrascht. Carl-Maria sah mir nicht gerade aus wie ein Athlet. Er war sicher Mitte vierzig. Kahlrasierter Schädel, Drei-Tage-Bart, Brille. Schlaksig. Eins neunzig groß. Aber man kann sich irren. Ich wusste nichts zu antworten angesichts der mitreißenden, packenden Angstlust, die er mir vorschlug. Ich fühlte mich vielmehr an den Philosophen Martin Heidegger erinnert. Das Sein, das zum Tode strebt.
„Ich frage mich“, sagte ich, „inwieweit mich das waghalsige Sporteln zu mir selbst bringen kann. Begreife ich mich selbst dadurch besser?“
„Ach“, sagte Carl-Maria gedehnt, „Du bist mir ein Spielverderber. Grüble nicht. Riskiere mal was.“
Dennis trank schmatzend seinen Aperitif, schaute mich herausfordernd an. „Die Welt ist ein Paradox, Albert, aber es gibt ständig nur Wagnisse. Alles ist immer möglich, aber, müssen wir deshalb ständig Ängste hegen? Wir sind doch frei. Die Freiheit ist unendlich.“
Jetzt lachte er höhnisch, lachte selbstgefällig, lachte immer lauter. Fast teuflisch. Dann stürzte er den Rest seines Aperitifs hinunter. „Ich gehe mal, genehmige mir noch einen und kümmere mich um Lydia“, erklärte er. Er deutete auf die reizende blondhaarige Hostess, die ganz in der Nähe stand und dafür sorgte, dass die Amuse Gueules – knusprige Brotchips mit Sardinenpaste –, unter die Leute kamen. „Sie ist aus Sankt Petersburg“, raunte er und verdrehte die Augen, als würde er von einer auf die andere Sekunde den Verstand verlieren.
Mein Hundertachtzig-Grad-Blick verhieß: Es würde eine wilde Party werden. Vor den Toiletten bildeten sich lange Schlangen. Nicht ausgelöst durch eine plötzlich ausgebrochene globale Inkontinenz, sondern durch Kokainkonsum. Viele rieben sich in den Gesprächen nach Besuch des stillen Örtchens auffällig oft an den Nasenflügeln herum.
Ein Diskjockey blieb anfangs mit cooler Loungemusik unauffällig, sorgte danach mit Techno und Rave für Stimmung, bot im weiteren nur noch Schlager. Mit erhöhtem Alkoholpegel sanken die Hemmschwellen in jeder Hinsicht. Viertelstündlich. Die Gästeschar grölte und tanzte. Man mochte es kaum glauben, aber viele der weiblichen Anwesenden ließen ihre Hüllen fallen. Sie tanzten oben ohne oder knoteten die Blusen über dem Bauchnabel zusammen, nachdem sie sich ihres Büstenhalters entledigt und diesen wirbelnd ins Meer geworfen hatten. Wir waren Port Andratx nah, da schmusten einige gierend auf den gepolsterten Bänken miteinander oder knutschten, andere machten sich, je nach dem, wer dominant war, ungeniert am Hosenschlitz oder unter dem Rock zu schaffen und es kam mir vor, als ob zumindest die Rückfahrt unweigerlich in eine ekstatische Orgie ausarten würde.
In welche Katastrophen konnte so etwas münden? Manche strangulierten sich in der Toilette mit einem Gürtel und wurden dann bewusstlos aufgefunden, andere stürzten einfach von Bord und ertranken jämmerlich, da ihre Sinne von Sex, Drogen und Alkohol wie vernebelt waren.
Auch hierzu gab es Notizen in meinem Heftchen unglaublicher Zufälle.
Es ist wohl nur zu gut verständlich, angesichts dessen ich nach der Trennung von Anita schmerzlich unter der fehlenden Zuneigung litt und mir keineswegs eine schnelle Nummer mit einem der anwesenden Partyluder darüber hinweghelfen konnte (ich hatte im letzten Jahr gar nicht erst versucht, eine Frau kennenzulernen), dass ich es kaum noch auf dem Boot aushielt. Ich musste mir etwas einfallen lassen, um in Port Andratx, wieder zurück an Land, das Weite zu suchen.
Ich kämpfte mich durch das Gedränge der Feierwütigen hindurch und suchte nach Mandy Conchita. Das Boot wurde gerade am Poller der Anlegestelle vertäut und die aufgeheizten Pärchen machten sich bereit für den Landgang, ordneten ihre Kleider, zumindest die, die das Gala Dinner nicht einfach ausließen.
Ich begegnete Mandy Conchita zufällig, als sie aus der Damentoilette kam. Sie war in Begleitung einer blonden Schönheit, die ihr – ich sah es noch in einer winzigen Bewegung der Hand –, unter das Minikleid gefasst und in den knackigen Hintern gekniffen hatte. Mandy Conchita überspielte die schlüpfrige Angelegenheit einfach mit einem Lächeln und warf ihrer Begleiterin einen verliebten Blick zu. Ich redete nicht lange drum herum. „Mandy“, sagte ich, „gut, dass ich Sie treffe. Entschuldigen Sie, aber ich muss mich leider vorzeitig verabschieden.“
Sie blickte mich fragend an. „Albert, es ist doch alles okay mit Ihnen?“
„Ja, natürlich“, versicherte ich. „Tolle Party! Es ist nur so, ich habe einen Anruf erhalten, von einer Freundin, sie ist momentan auf der Insel, ihr Boot liegt hier im Hafen. Und ich möchte meine Freundin gern heute Abend noch besuchen, weil sie morgen Früh schon weiterschippert.“
Mandy Conchita durchschaute meine Ausrede sofort. Zuerst sah sie mich belustigt an, dann aber wurde ihr Blick hart und abweisend. „Sie haben viel erlebt, Herr Wallmann, ich weiß. Aber, dass Sie neben Ihrer Flugangst auch noch eine soziale Phobie haben, das hätte ich nicht erwartet. Trotzdem, das ist kein Problem. Ich sage der Bordmannschaft, dass wir ohne Sie zurückreisen. Weiterhin noch einen angenehmen Aufenthalt auf Mallorca und ich wünsche Ihnen für morgen eine gute Heimreise.“ Sie gab mir förmlich die Hand, dann stöckelte sie auf ihren hohen Hacken an mir vorbei, während die Blondine kaum die Finger von ihr lassen konnte und an Mandy Conchitas Hüfte herumtatschte.
Ich war froh, als die Partygesellschaft in den Gassen von Port Andratx verschwunden war. Am Pier zurückgeblieben, sog ich die frische Abendluft in meine Lungen und dachte darüber nach, was ich wohl jetzt anstellen sollte. Mit dem Taxi nach Peguera zurückfahren konnte ich noch immer. Ich machte mich also auf, ein wenig die Hafenmeile zu erkunden. Die Schönen und Reichen saßen auf den Terrassen der vielen schmucken Gaststätten, aßen zumeist gegrillten oder gebratenen Fisch, tranken Wein und amüsierten sich dabei prächtig, so machte es den Eindruck. Man war unter sich, man war wer, das illustre Urlauber-Völkchen fühlte sich in der Avinguda Mateo Bosch, wie ich auf einem Straßenschild ablesen konnte, sichtlich wohl, egal ob man aß, ein Schwätzchen hielt oder nur flanierte.
Da ich keinen Hunger verspürte, hielt ich nach Kneipen Ausschau und wurde im Übergang zur Avingunda Almirante auf eine Bar namens Peggys Stars On 45 aufmerksam. Es herrschte reger Betrieb.
Bei Peggy handelt es sich um eine vierundfünfzigjährige Deutsche, die ihr Lokal mit viel Herzblut führte und hinter dem Tresen mit flinken Fingern die Bechergläser nur so fliegen ließ. Sie hatte direkt am Eingang eine Jukebox platziert. Die Oldies dudelten. Es roch nach Duftstäbchen und Weihrauch, America sang A Horse With No Name und ich fühlte mich gleich pudelwohl. Nach zwei Bieren und drei Bourbon fühlte ich mich noch viel besser. Bei Joe Cockers Unchain My Heart zuckte ich sogar rhythmisch auf der kleinen Tanzfläche neben dem Billardtisch hin und her.
Die Gäste hatten sich auf ihre Hotelzimmer zurückgezogen, oder lagen bereits schlafend in den Kajüten ihrer Boote, es war so gegen halb drei, da waren Peggy und ich beim Du angelangt. Bei einem Du, das nichts Manipulatives hatte. Peggy hatte die Bar geschlossen, ich hatte ihr meine Geschichte erzählt und davon, dass es mir zuwider war in dieses Five-White-Stripes-Deluxe-Hotel zurückzukehren. Ich wollte nicht mehr eingeladen werden, nicht bestochen, nicht benutzt. Ich wollte nicht Teil einer ausgeklügelten Marketingkampagne sein, denn, ließ ich den Kongress Revue passieren, so gab es doch wohl für niemanden aus der Gruppe ein entrinnen. Hatte man auch nur einige der wichtigsten Personen heimlich bei diesem Boots-Gelage mit dem Fotoapparat abgelichtet, so waren sie erpressbar, denn, wer findet sich gern als verheirateter erfolgreicher Geschäftsmann auf dem Titelblatt einer Illustrierten wieder, das zeigt, wie man gerade mit einer Hostess herummacht. Mitgefangen, mitgehangen. Aber all das war ja nur so ein Gefühl. Es könnte so sein. Es könnte auch alles anders sein.
Peggy hatte mich in meiner Haltung bestärkt. Sie fand es gut und richtig, dass ich meinem Instinkt gefolgt war und mich aus der Situation herausgezogen hatte. Sie stand in ihrem Leben mal vor einer ganz ähnlichen Situation, hatte sie erzählt, als ihr Ex-Mann in große Geldschwierigkeiten gekommen war und ihr einen Versicherungsbetrug vorgeschlagen hatte. Sie hatte abgelehnt, was gleichzeitig das Ende der Beziehung bedeutete. Der Ex-Mann zog die Masche trotzdem mit seiner neuen Geliebten durch, wurde geschnappt und saß – wahrscheinlich noch immer – in irgendeinem Knast seine Gefängnisstrafe ab. Peggy machte dagegen vermutlich alles richtig. Sie hatte ihr Fischrestaurant in Sankt Peter Ording aufgegeben und war nach Mallorca gezogen. Das lag schon einige Zeit zurück; Peggy gehörte inzwischen in Andratx zum Establishment. – Ich mochte sie, ich mochte einfach alles an ihr. Ihre schwarzlackierten kurzen Nägel, ihr kräftiges braunes langes Haar, ihr schwarzes Rippenshirt, ihre Perlenketten, ihre Armreife aus Perlmutt und die braune, schon etwas speckig gewordene Wildlederhose, die sie trug. Sie konnte einigen Alkohol vertragen. Und nachdem ihre Thekenbedienung Maria längst gegangen war, nachdem sie die Spülmaschine angestellt und den Tresen aufgeräumt hatte, da sagte Peggy zu mir, ich könne auf dem Sofa schlafen, ihre Wohnung befinde sich eine Etage höher. Ich könne dann morgen Mittag mit dem Taxi rüberfahren oder im Hotel anrufen und mir meinen Trolley einfach bringen lassen. Ich wusste, dass dies ein großer Vertrauensbeweis war, denn sie war keine, die irgendwelche Urlauber, die ihr gefielen, mit ins Bett nahm (so glaubte und hoffte ich es zumindest). Erst recht keine Lebowski-Lookalikes. Sie musste mich irgendwie mögen und wenn ich ganz ehrlich zu mir war, dann mochte ich Peggy ein bisschen mehr, als ich mir eingestehen wollte. Ich bedankte mich höflich. Kaum hatte ich mich auf der Couch ausgestreckt, da war ich auch schon eingeschlafen. Mich umzuschauen in ihrer kleinen Wohnung, dafür fehlte mir einfach die Kraft.