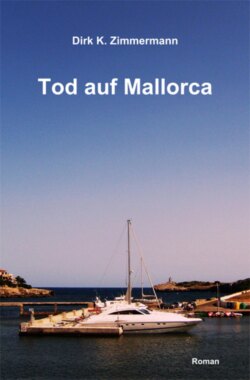Читать книгу Tod auf Mallorca - Dirk K. Zimmermann - Страница 7
Оглавление3
Peggy war ein Schatz. Sie hatte mir Frühstück gemacht (für das ich ordnungsgemäß zahlte, es waren Croissants mit Butter und Rührei mit Schinken, dazu starken Kaffee und Orangensaft), hatte mir ein Hotel empfohlen, falls ich noch auf Mallorca bleiben wollte. Aber irgendwie war ich nicht mehr recht in Stimmung dazu. Die Idee erholsamer Tage auf Mallorca war mit den Erlebnissen des Angor-Symposiums wie ausgelöscht. Ich hatte mich mit einer wirklich zärtlichen Umarmung von Peggy verabschiedet, wir hatten uns auf die Wangen geküsst und dann war ich mit dem Taxi zum Five White StripesDeluxe zurückgefahren, hatte meine Sachen geholt (von der Agenturdelegation oder den Tagungsgästen hatte ich niemanden mehr dort angetroffen) und mich gleich zum Hafen von Palma aufgemacht, um die nächste Fähre zurück nach Barcelona zu nehmen. Ich dachte an die fünftausend Euro, die ich mit diesem kurzen wissenschaftlichen Intermezzo verdient hatte, und deren Löwenanteil ich jetzt in die Gesundung meines todmüden Volvo investieren würde.
Aber es sollte ja alles ganz anders kommen, als ich mir gedacht und vorgenommen hatte. Wie also konnte es geschehen, dass ich doch auf der Insel blieb? Zwei mysteriöse Ereignisse stürzten auf mich ein.
Die Fähre legte nicht ab. Ich konnte sie nicht einmal besteigen. Sie wurde ersatzlos gestrichen. Am Hafenterminal herrschte großer Tumult. Mit rotem Absperrband wurden die Reisenden von einem großen Teilbereich des Hafenbeckens zurückgehalten. Es wimmelte nur so von uniformierter Polizei. Nachdem ich mich durch die Reihen der Gaffer weiter nach vorn gedrängelt hatte, konnte ich alles aus nächster Nähe miterleben. Im grünlich schimmernden Wasser trieb ein aufgedunsener massiger Leichnam. Taucher bargen den Toten, Polizisten bugsierten ihn in einer Plastikwanne auf den Pier. Die Ordnungshüter errichteten einen Sichtschutz für die Schaulustigen und lamentierten lautstark. Direkt neben mir stand ein deutscher Hörfunkjournalist. Er war mein Souffleur, übersetzte simultan alles, was da auf Spanisch gesprochen wurde in sein Handy hinein. Er war schnell wie ein Sportreporter.
„Das ist eine Sensation“, sagte er zu mir. „Seitdem vor Jahren ein Restaurantbesitzer in Porto Christo erschossen aufgefunden wurde, ist das hier die aufregendste Meldung seit langem.“
Wie ich erspähen konnte, handelte es sich bei dem Toten um keinen Spanier und auch keinen Flüchtling. Es war allem Anschein nach ein Deutscher, den man da aus dem Wasser gefischt hatte. Zumindest legte das auf sein weißes T-Shirt aufgedruckte Wort Frieden diese Vermutung nahe. Mein kurzer Blick auf den leblosen Körper reichte aus, um das Alter des Mannes abzuschätzen. Er dürfte etwa sechzig Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war er neben dem weißen T-Shirt mit dunklen Shorts. Was mit ihm angeblich passiert war, erfuhr ich aus erster Hand. Der Reporter hielt einem vorbeikommenden Polizisten dreist sein Handy unter die Nase und versuchte ihm ein Statement zu entlocken. Der Polizist blieb kurz stehen und antwortete zu meiner Überraschung. Er vermutete, es handele sich um einen Jachtbesitzer, der von Bord gestürzt sei und wahrscheinlich einen über den Durst getrunken habe. Nachfragen des Reporters, ob es sich um einen Raubmord gehandelt haben könnte, wobei der oder die Täter die Leiche über Bord geworfen hätten und dann mit der Jacht auf und davon seien, konnte und wollte der Polizist nicht bestätigen. Aber eine weitere denkbare Möglichkeit sei ein Freitod, gab er an.
Eigentlich hatte ich genug gehört, ich sah, wie sie die Plastikwanne mit der Leiche in einen Mannschaftswagen der Polizei hievten, abfuhren und die zurückgebliebenen Kräfte den Tatort weiter auf Spuren prüften. Die Taucher suchten das Becken ab. Anscheinend gab es keinen Anhaltspunkt über die Identität des Toten. Die Mundwinkel des Reporters zuckten. „Die werden das schon rauskriegen, wer er ist, und was ihm zugestoßen ist. Vielleicht ist er wirklich angetrieben worden. Also wenn Sie meine Meinung hören wollen, ist er irgendwo zufällig von Bord gefallen. Fragt sich nur, von welchem Schiff oder Boot.“
Ich hätte mich umdrehen und zum zweiten Kai hinübergehen können. Dort legten die anderen Fähren ab. Ich brauchte nur ein neues Ticket zu lösen und mich dann aus dem Staub zu machen. Aber ich blieb einen Moment länger in der Menge stehen, dachte über die Worte des Radioreporters nach, das war das Fatale, denn kurz darauf spürte ich die schweißfeuchte Hand dieser Frau an meinem Arm. Es war so eng, ich konnte mich kaum zu ihr umdrehen. Sie stand unmittelbar hinter mir, aber ich erkannte sie sofort, als ich meinen Kopf zur Seite drehte und ihr Profil erblickte. Es war die Rothaarige, die ich gestern zeternd am Gemeindezentrum von Peguera gesehen hatte. Kein Zweifel: Sie trug dieselbe orangefarbene Bluse, dazu die kurzen Shorts, ganz genau so wie gestern. Ich spürte, ihre freie Hand klopfte in Hüfthöhe gegen mein Sakko, dann steckte sie mir etwas in die Jackentasche. Die Rothaarige wisperte, ich solle kein Aufsehen erregen. Die würden sie gefangen nehmen und dann wären alle Chancen dahin. Der Mann sei ein Opfer. Er sei nichts anderes als eine Ratte gewesen. Eine Ratte im Käfig. Ich solle helfen, wenn ich ein Gewissen hätte. – Nur diese wenigen Sätze sagte sie und ehe ich sie ansprechen konnte, ehe ich mich in der Menge vollends zu ihr umwenden konnte, hinter ihr herlaufen, da war sie auch schon verschwunden. Sie war gewesen wie ein Geist, ätherisch; sie hatte sich einfach in Luft aufgelöst.
Ich blieb noch eine Weile in der Menge stehen und schaute weiter auf die Aktionen der Polizisten, die angestrengt, aber ziemlich lustlos nach Hinweisen suchten.
Während ich über diese mysteriöse Frau nachdachte, ob sie von einer Wanderlust befallen war, den Verstand verloren hatte und nun auf der Insel herumirrte, ob sie nicht eine feste Bleibe irgendwo hatte, vielleicht in einem Heim lebte oder in einer Finca, griff ich in die Jackentasche hinein und spürte Papier zwischen meinen Fingern. Es fühlte sich an wie ziemlich festes Papier, das mehrmals gefaltet worden war. Ich ließ diesen Zettel dort, wo er war und machte mich auf, aus der Horde Schaulustiger herauszutreten und mir ein ungestörtes Plätzchen zu suchen, wo ich mich in aller Ruhe damit befassen konnte, was diese anscheinend geistesverwirrte Frau mir mitzuteilen hatte.
Einige Straßenzüge vom Hafen entfernt, stellte ich den Trolley neben mir ab und setzte mich auf eine Mauer. Dann holte ich den Zettel hervor und entfaltete ihn. Es war dickes, leicht vergilbtes Papier und es schien sich wohl um die Seite eines Buchs zu handeln, eine, die hastig herausgerissen worden war. Ich betrachtete das Blatt. Mit Bleistift hatte die Rothaarige (oder auch jemand anderes, aber es war zunächst davon auszugehen, dass sie es war) etwas skizziert, das nach einer Siedlung aussah. Sie hatte durch Pfeile einen Weg angedeutet, hatte irgendwo an einem Haus, zumindest einem Gebäude, ein großes Kreuz gemacht und dort eine Ziffer hingeschrieben. Die 8. Es stand kein einziger Satz dort. Nur drei Worte. Atma. Und daneben: Son Gual.
Ich schaute bestürzt auf diese Bleistiftzeichnung. Sie hatte davon gesprochen, dass ich helfen musste. Es schien ihr sehr dringlich zu sein. Und ich hatte geschlossen, dass ihr Anliegen etwas mit dem Toten im Hafenbecken zu tun haben mochte. Ratte im Käfig hatte sie ihn genannt. Es lag wohl auf der Hand, warum sie sich nicht an die Polizei oder karitative Einrichtungen wendete. Wahrscheinlich hielt man sie für verrückt. Vielleicht tat ich es besser auch. Aus meiner Praxis, aus meinen Forschungen wusste ich nur zu gut, dass manche Menschen große Krisen nicht überstehen und ihre verletzten Seelen auf Wanderschaft gehen, um die kaum auszuhaltenden Lebensumstände irgendwie zu verarbeiten.
Allerdings zerknüllte ich diesen Lageplan nicht und warf ihn in den nächsten Papierkorb. Ich faltete ihn sorgfältig und steckte ihn in meine Tasche zurück. Der Impuls dazu lag im Akt der Menschlichkeit. Der Hilfe. Der Not. Und war eng mit meiner Vergangenheit verbunden. Die Schuldgefühle, meine erste Frau Katrin nicht vor dem Selbstmord bewahrt zu haben, meine Töchter nicht rechtzeitig vom Sport abgeholt und damit das Unglück vermieden zu haben, lasteten noch immer zu schwer auf mir. Wenn auch Walter mit mir seit Jahren daran arbeitete, es wollte mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich hatte etwas gutzumachen, es war also, wenn ich es recht überlegte, kein Reflex der Mitmenschlichkeit, sondern vielmehr die Beruhigung des eigenen schlechten Gewissens, die mich auf der Insel hielt.
Auf der Rückfahrt nach Andratx, die ich diesmal mit dem Bus bewältigte, ich wollte Peggy aufsuchen, sie um Rat bitten und ein Zimmer in dem von ihr empfohlenen Sea Beach Harbor beziehen, dachte ich über die Worte nach, die mir die Rothaarige als Hinweis mitgegeben hatte.
Atma, was sollte das bedeuten? Ich kannte es nur als Begriff aus dem indischen Sanskrit, der die Ergründung des Selbst beschrieb und in dieser Bedeutung eng mit einer Form der Meditation verbunden war. Was Son Gual anbetraf, hatte ich zumindest relativ schnell einen vagen Anhaltspunkt. Zwischen Palma und Llucmajor gelegen, gab es einen Golfplatz, umsäumt von mietbaren Luxusvillen. Sollte hier eine Villa mit der Nummer 8 gemeint sein? Und wen würde ich dort antreffen? – Bei allem Respekt, die Rothaarige passte, so wie ich sie kennengelernt hatte, gar nicht in dieses Ambiente.
Peggy freute sich sehr mich wiederzusehen. Sie umarmte mich stürmisch. „Das war die richtige Entscheidung“, sagte sie, als ich ihr berichtet hatte, und setzte sich sofort zu mir an den Tisch, um die Zeichnung der Rothaarigen zu studieren. Auf Atma konnte sie sich auch keinen Reim machen, aber was die Skizze und das Wort Son Gual anbetraf, hatte sie nach einigem Nachdenken eine Idee.
„Das hat nichts mit dem Golfplatz oder irgendwelchen Villen zu tun. Wenn ich mich nicht irre, dann ist hier auch ein bisschen Bucht eingezeichnet und der Golfplatz liegt nun ganz und gar nicht unmittelbar am Meer.“
Sie hielt inne, dann lächelte sie.
„Wenn ich die Personenbeschreibung deiner rothaarigen Bekannten mit einbeziehe, dann bin ich sogar ziemlich sicher, dass ich richtig liege.“
Sie ließ mich ganz schön zappeln. „Was meinst du?“, fragte ich.
„Ich schätze, die Skizze zeigt Terrapolis. Eine Geisterstadt. Über hundert leerstehende Wohnungen, die während des Baubooms entstanden sind. Diese Geisterstadt befindet sich in Sa Marina de Son Gual, das ist bei Manacor, genauer, an der Bucht Estany d’en Mas.“
Meine Gedanken schwirrten. Eine Geisterstadt voller leerstehender Wohnungen? Was sollte der Tote damit zu tun haben? War er ein Baulöwe, der sich bereichert hatte und den man jetzt aus irgendwelchen Gründen ins Jenseits befördert hatte?
Peggy ahnte meine Gedanken.
„Denk nicht kompliziert, denk einfach.“
„Wieso denke ich kompliziert“, sagte ich.
„Du hast immer mit komplizierten Menschen zu tun und du selbst bist ja auch nicht gerade einfach. Da denkt man gern mal kompliziert. Was ja auch gar nichts macht. Aber du solltest die einfachen Gründe dabei nicht übersehen.“
„Wie?“, fragte ich.
„Ich meine, das Naheliegende ist doch, dass die Rothaarige, wie sie selbst sagte, nicht ungestört mit dir reden konnte, aber sie wollte, dass du hilfst, wenn du ein Gewissen hast. Du hast mir beschrieben, dass sie ziemlich heruntergekommen aussah. Eine Frau, die keinen festen Wohnsitz hat, die, sagen wir mal, irgendwie eine Verliererin ist, wo kann die Unterschlupf finden? Sicher, es gibt die deutsche katholische Gemeinde in Palma, es gibt das spanische Rote Kreuz auf der Insel, es gibt Höhlen, es gibt leerstehenden Baracken, es gibt Parkbänke und Strände. Dort könnte man nächtigen. Was ist aber für eine Frau das Sicherste, um Schutz vor Übergriffen zu finden und nicht aufzufallen, falls man sich illegal auf der Insel aufhält oder vielleicht sogar von irgendwem gesucht wird?“
„Sie wohnt da – in einer dieser leerstehenden Wohnungen –, und will sich dort mit mir treffen?“
„Genau. Es ist mir zwar ein Rätsel“, sagte Peggy, „wie sie da unbemerkt hausen will, denn das Areal ist umzäunt und wird, so weit ich weiß, von einem Sicherheitsdienst überwacht, aber, wer weiß.“
„Obdachlos ...“, zweifelte ich.
Peggy schaute mich ernst an. „Warum nicht? Wusstest du nicht, dass es mehr als Hundert Obdachlose auf Mallorca gibt? Einer von ihnen, ein Deutscher, wurde in einem Kanalrohr tot aufgefunden, sein Leib war von Rattenbissen übersät. Hast du nichts davon gehört?“
Ich sagte ihr, dass ich mich noch um meine Bleibe kümmern müsse, ehe ich ihrem Vorschlag nachgehen könne. Peggy war mir eine große Hilfe, sie hatte zwar noch einige Vorbereitungen für den Tapas-Abend zu treffen, aber sie bot mir für die Fahrt zur Terrapolis ihren Jeep an. Das war mehr als großzügig.
Als ich in dem von ihr empfohlenen Hotel, dem Sea Beach Harbor, anrief, erklärte man mir, es sei alles ausgebucht. Peggy griff sofort ein, ließ nicht locker und bequatschte den Portier so lange, bis plötzlich – auf wundersame Weise –, doch noch ein Zimmer dort frei geworden war und neu belegt werden konnte. Als ich Peggy dankte, sagte sie strahlend: „Ja, so bin ich halt.“
Ich fuhr also zur Terrapolis. Der Jeep war alt und rostig, hatte bestimmt so viele Jahre auf dem Buckel wie mein Volvo, aber nicht so viele Wege hinter sich. Der Tacho zeigte 234.196 Kilometer. Peggy hatte mir erzählt, sie habe ihn für kleines Geld mit zweihunderttausend Kilometern auf dem Buckel gekauft und er habe sie bislang nie im Stich gelassen.
Ich erreichte die Geisterstadt nach einiger Sucherei. Das rostige Schild an der Hauptstraße mit der Aufschrift Cala Romantica hatte mich etwas verwirrt. Der malerische Strandabschnitt in der Bucht war nah, doch unmittelbar vorgelagert hatte der kapitalistisch gierende Beton die Natur zermartert, leblos gemacht und gesichtslose Zementmonster geboren, die nunmehr dahinsiechend das Landschaftsbild verödeten. Den Wagen stellte ich vorsichtshalber, man konnte nie wissen, was passieren würde, in einiger Entfernung vom Gelände ab und legte den Rest des Wegs zur Geisterstadt zu Fuß zurück.
Wie Peggy es mir vorausgesagt hatte, so verhielt es sich. Das Areal war mit Maschendraht umzäunt. An einer einzigen Stelle jedoch, der parallel verlaufenden Straße zugewandt, gab es einen Schlagbaum. Ein Pförtnerhäuschen stand davor. Darin hockte, wie ich im Vorbeischlendern sehen konnte, ein Mitarbeiter des beauftragten Wachdienstes. Dem Aussehen nach war er Südländer. Er verteilte gerade Funkgeräte in die Ladestationen.
Ich blieb in einiger Entfernung vom Pförtnerhäuschen stehen, holte meinen Skizzenzettel hervor und studierte die Zeichnung auf meinen derzeitigen Standpunkt hin. Definitiv hatte die Rothaarige mit ihren Pfeilen signalisiert, dass ich einen anderen Weg hinein nehmen sollte, als den offiziellen, der beinhaltete, hier beim Pförtner um Einlass zu bitten. Also ging ich weiter und folgte den Skizzenpfeilen bis ich an einer abseits gelegenen Ecke, nahe eines Abhangs, nahezu verdeckt von Büschen, ein klaffendes Loch im Zaun entdeckte. Das Loch war gerade groß genug, um eine Person hindurchzulassen. Ich schaute nochmals auf meine Skizze, aber es gab keinen Zweifel: Dieser Ort musste gemeint sein. Also zwängte ich mich hindurch, es bereitete mir einige Mühe, aber schließlich gelang es, ohne dass ich mir die wadenlange Cargohose zerfetzte. Auf der anderen Seite des Zauns angekommen, ging ich hinein in diese tote Stadt. Der Wind pfiff und mich beschlich ein mulmiges Gefühl. Aber ich tastete zu meiner seitlich aufgenähten Hosentasche, in der, in weißes Pergamentpapier gewickelt, eine frische Chorizo steckte. Ein Tipp, eine kleine, mitgegebene Lebensversicherung von Peggy, falls die Wachleute mit Hunden unterwegs waren oder das Gelände von freilaufenden, knurrenden und zähnefletschenden Bestien bewacht war.
Ich marschierte durch die verstaubten kleinen Gassen, schaute in die gähnend leeren Eingänge hinein. Niemand war weit und breit zu sehen. Drei Kreuzungen überquerte ich, nahm dann, wie eingezeichnet, die vierte Abbiegung nach links und stand nach einigen zurückgelegten Metern vor einem kleinen Appartement, das den Eindruck machte, fast fertiggebaut worden zu sein.
Ich ging auf die Haustür zu und umso näher ich an das Gebäude, an diese Wohnbaracke heranging, je mehr wusste ich, dass ich am Ziel angekommen war. Jemand hatte provisorisch einen dünnen Draht zu einer Acht gebogen und diese an einen aus der Wand herausstehenden rostigen Pfeiler gehängt. Die Acht schaukelte im Wind und erwirkte – so wie sie dort baumelte –, ein Gefühl von Unendlichkeit.
Ich empfand es als absurd vor dem Eingang zu warten, an die verwitterte Tür zu klopfen (immerhin hatte man hier eine Tür eingehängt) und zu fragen, ob jemand zu Hause sei. Ich tastete mich vor, schob die Tür einen Spalt weit auf, sie knarzte in den Angeln. Ich trat ein und erst als ich die Tür behutsam wieder angelehnt hatte, erhob ich vorsichtig meine Stimme.
„Hallo? Ist jemand zu Hause?“
Meine Augen gewöhnten sich ziemlich schnell an die Dunkelheit im Raum. Ich ließ meinen Blick schweifen und durchschritt den Flur zu einem Wohnraum hin. Vorbei an Mülltüten, Apfelsinenkisten, leeren Weinflaschen und Büchsen Hundefutter, Milchtüten, Zeitungspapier mit verwelkten Salatblättern. Im Wohnraum selbst: Ein paar Kerzen, zwei Matratzen, in verschiedenen Ecken gelagert. Wolldecken, Kopfkissen, vier oder fünf ramponierte Romane. Plastikflaschen mit Mineralwasser. Am Fenster fand ich so etwas wie eine Ecke für die Morgentoilette vor. Eine Plastikschüssel, Zahnbürste, Zahncreme, eine Haarbürste, ein Fläschchen Nagellack, ein Lippenstift lagen da auf dem Mauervorsprung. Am Boden, in einem gelblich durchsichtigen Plastiksack die Wechselwäsche und Handtücher. – Ich war mir sicher, hier hauste die Rothaarige, als mein Blick auf die Haarbürste fiel. Ich rief nach ihr. „Hallo?“
Ich lauschte, ob sich nicht jemand irgendwo in der Baracke versteckte. Nichts. Sie war nicht da. Ich würde wiederkommen müssen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Eilig verließ ich das Gebäude und nahm denselben Weg zurück, wie ich hergefunden hatte. Aber ich kam nur bis zur Biegung. – Dort stand ein schneeweißer Bullterrier. Ein junges, kräftiges Tier. Mit einem Nietenhalsband. Ohne Maulkorb. Er schnüffelte etwa fünfzehn Meter entfernt von mir herum, hob den Kopf, reckte die Nase in den Wind, entdeckte mich, sah mich neugierig an und hatte noch nicht entschieden, so glaubte ich an seiner Haltung ablesen zu können, mich zu zerfleischen oder mich als Gast in seinem Revier zu begrüßen. Letzteres war mir deutlich lieber.
Ich griff in meine Hosentasche und versuchte die Chorizo ganz langsam herauszuziehen. Gleichzeitig redete ich beschwörend auf ihn ein.
„Hallo, mein Bester. Ja, sei schön brav, jetzt gibt’s was Leckeres für dich. Was ganz Leckeres.“
Der Bullterrier hatte den Braten schon gerochen, ehe ich ihn aufgetischt hatte. Er kam, freudig mit seinem kaum vorhandenen Schwanz wedelnd, näher. Ich hatte Mühe, die Chorizo schnell genug aus dem Papier zu wickeln und ihm die Wurst hinzuwerfen, aber es gelang, ehe er mich erreichte. Er roch kurz an ihr und begann sie dann mit seinen kräftigen Kiefern zu zermalmen. Es knackte laut, dann hatte der Terrier mit einem einzigen Biss die Wurst in zwei Teile durchtrennt. Jetzt galt es für mich. „Adieu, Hundchen“, sagte ich und ging zuerst langsam, dann immer schneller von ihm fort. Der Hund folgte nicht, bemerkte ich durch einen Blick zurück; er war fasziniert von dieser Wurst.
Um die nächste Hausecke gebogen, begann ich zu laufen, ich sprintete.
Auf der langen rettenden Geraden zum Loch im Zaun – genau auf der Kreuzung zur letzten Quergasse –, fand meine Flucht ihr jähes Ende. Dort stand sie. Nicht die Rothaarige, sondern eine kleine, stämmige Frau, gekleidet in die hellblaue Uniform des Sicherheitsdienstes. Sie trug ein Pistolenhalfter um ihre breiten Hüften, in den Händen hielt sie einen Kunststoffstab an dessen Ende ein abgewetzter Tennisball steckte.
„Tijuana“, rief sie, „Tijuana, dónde estás? Ven!“
Aber anstatt ihres Diensthundes, sah sie mich vor sich. Wie ich aus vollem Lauf abbremste, dass der Staub nur so aufwirbelte. Sie sah, wie ich stehen blieb. Sie griff zum Halfter und zog ihre Pistole heraus. Ihre Hand zitterte leicht, während ich wie angewurzelt vor ihr stand und sie sich langsam, die Waffe vorhaltend, auf mich zu bewegte.
„Quien eres?“, schrie sie mich an. „Qué quieres? Vete!“
Ich verstand nicht. Und sie sah es.
„No trespassing. Go out!“, versuchte sie es erneut. „Betreten verboten. Gehen Sie!“
Ich hob abwehrend die Hände. Und nickte zum Zeichen, dass ich ihre Anweisung befolgen wollte.
Sie deutete mir mit ihrer Pistole den Weg hinaus. Ich setzte mich in Bewegung, es war beinahe vorbei und ich würde glimpflich davonkommen, doch ihr Bullterrier Tijuana machte mir einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Den Rest meiner Chorizo zwischen den Zähnen, kam er zwischen den Baracken hervor und lief zu mir hin, sprang fordernd an mir hoch. Die Frau schaute von mir zu Tijuana, zu seinem Maul und wieder zurück zu mir.
„Stopp!“, sagte sie kehlig. Ich blieb stehen, was mir mit dem um Wurst bettelnden Tijuana am Bein ziemlich leicht viel.
„Deutsch?“
„Ja“, sagte ich.
„Warum bist du hier?“
„Ich wollte eigentlich zur Bucht, suchte nach einer Abkürzung, und da bin ich hier gelandet.“
„Eine Abkürzung“, sagte die Frau gedehnt und entsicherte ihre Waffe.
„Und du hast dann Wurst mitgebracht, die du meinem Hund gibst.“
„Ja“, stotterte ich, „meine Wegzehrung. Ich liebe Chorizo.“
„Du bist gekommen, um herumzuspionieren. Was wolltest du hier?“
Ich schwieg und suchte nach einer Antwort, während mir Tijuana inzwischen die Hand leckte.
„Tijuana“, brüllte die Frau, „ven!“
Tijuana bellte beleidigt, dann trottete er zu seinem Frauchen zurück und schaute sie an, als wäre ihm gerade eine Laus über die Leber gelaufen. Er legte sich neben ihrem rechten Bein nieder und blickte sie erwartungsvoll an.
„Ich ...“, begann ich.
„Du wolltest zu Atma!“
Die Frau blinzelte mich an. Ich nickte.
„Du wolltest zu Atma ...“, wiederholte sie. „Was wolltest du von ihr?“
Ich war überrascht. Die Frau kannte die Rothaarige (die wohl Atma hieß, was das kleine Rätsel löste) und wusste von ihr. Ich räusperte mich.
„Ja. Ich wollte zu Atma. Sie hat mich um Hilfe gebeten.“
Die Frau schaute mich misstrauisch an.
„Was für Hilfe?“
„Das weiß ich selbst nicht so genau.“
Sie zögerte. Ihr Blick tastete mich ab. Sie nickte, nahm die Waffe herunter.
„Es geht mich nichts an. Ich weiß von nichts. Komm später wieder.“
Ich konnte es kaum glauben. Die Frau duldete die Rothaarige wohl auf dem Gelände. Sie schien meine Gedanken zu erraten.
„Wir sind alle Menschen, nicht wahr. Jetzt verschwinde. Ich habe dich nicht gesehen. Adios!“
Ich ging. Aber ich würde wiederkommen, um mit Atma zu sprechen. Soviel war klar. Wahrscheinlich mit einem ganzen Beutel voll von Chorizo.