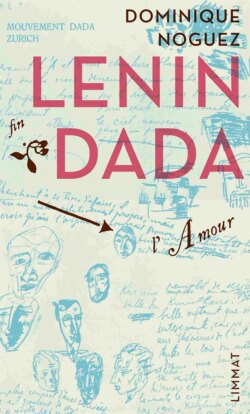Читать книгу Lenin dada - Dominique Noguez - Страница 6
I Eine brisante Offenbarung
ОглавлениеDie aussergewöhnliche Tatsache, dass Lenin und die ersten Dadaisten 1916 in Zürich während mehrerer Monate wie zufällig nebeneinander lebten und wirkten, ist lange Zeit ganz und gar unbeachtet geblieben. Vonseiten Lenins oder seiner Nächsten kein Wort. Nichts in der publizierten Korrespondenz.5 Seine Lebensgefährtin Nadeschda Krupskaja, die in ihren Erinnerungen an Lenin nicht mit präzisen Einzelheiten ihres Wohnortes an der Spiegelgasse und ihrer Umgebung geizt, scheint überhaupt nicht zu wissen, dass in ebendieser «kleinen engen Gasse»,6 nur wenige Meter entfernt, das Cabaret Voltaire untergebracht war. Nichts auch bei den wichtigsten Biografen.7 Wir müssen auf die Studie des Historikers Willi Gautschi (Lenin als Emigrant in der Schweiz) und die romanhafte Rekonstruktion von Alexander Solschenizyn (Lenin in Zürich) warten, um – mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Ereignis – auch nur die schlichte Erwähnung des Cabarets im Zusammenhang mit dem berühmten Mann zu finden:
Etwas weiter entfernt, an der Münstergasse, liegt die «Meierei», wo sich das Cabaret Voltaire befand, in dem Anfang Februar 1916 der Dadaismus seine Geburtsstunde erlebte.8
– und überdies, im zweiten Fall, ohne Dada überhaupt zu erwähnen:
Auf eben dieser Strasse begleitet Willi [Münzenberg] seinen Lehrer [Lenin] in die Richtung, wo das Cabaret «Voltaire» ist, in dem die jungen Bohemiens ihre Nächte durch toben …9
Abb. 1: Münstergasse in Zürich. Rechts die Spiegelgasse mit Eckhaus Nr. 1, wo das Cabaret Voltaire eröffnet wurde (Foto: Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich.
Die Dadaisten sind kaum gesprächiger. Im Tagebuch von Hugo Ball, publiziert 1927, finden wir die früheste Erwähnung dieser Nachbarschaft, allerdings als Eintrag vom 7. Juni 1917, das heisst erst mehrere Monate nach der Abreise Lenins. Der Eintrag liest sich weniger als direktes Zeugnis denn als eine nachträgliche Entdeckung:
Mogadino, 7. VI. [1917]
Seltsame Begebnisse: während wir in Zürich, Spiegelgasse 1, das Kabarett hatten, wohnte uns gegenüber in derselben Spiegelgasse, Nr. 6, wenn ich nicht irre,* Herr Ulianow-Lenin. Er musste jeden Abend unsere Musiken und Tiraden hören, ich weiss nicht, ob mit Lust und Gewinn. Und während wir in der Bahnhofstrasse die Galerie eröffneten, reisten die Russen nach Petersburg, um die Revolution auf die Beine zu stellen.10
* Er irrt sich: Es war die Nr. 14 (siehe folgende die zwei Anmerkungen).
Spiegelgasse Nr. 14, in welchem Lenin wohnte, was auch durch die Schrifttafel zwischen erstem und zweitem Stockwerk angezeigt wird (Foto: Schweizerisches Sozialarchiv Zürich).
Ebenso einfach stellt das Georges Hugnet und später Hans Richter fest. Georges Hugnet, der kein direkter Zeuge war, ist auch der entschiedenste in seinem Urteil:
Das Cabaret befand sich an der Spiegelgasse 1. Lenin wohnte zusammen mit seiner Frau Krupskaja im Haus Nr. 12 derselben Strasse.* Lenin pflegte im Café Terrasse Schach zu spielen, einige Dadaisten ebenfalls. Sie ignorierten sich aufs herzlichste.11
* Auch er irrte sich (siehe folgende Anmerkung).
Lesen wir aber bei Richter nach, so ist dies dennoch ganz ungewiss. Wenn auch er, der Maler, sich in der Adresse von Lenin irrt, so war er damals immerhin in Zürich und hat ihn gesehen:
Das Cabaret Voltaire spielte und radaute in der Spiegelgasse Nr. 1. Schräg gegenüber, in der Spiegelgasse Nr. 12, in demselben Engpasse also, in dem das Kabarett nächtlich seine Gesangs-, Gedichts- und Tanzorgien aufführte wohnte Lenin.* – Radek, Lenin, Sinowjew durften frei herumlaufen. Ich habe Lenin in der Bibliothek mehrmals gesehen und ihn auch einmal in Bern in einer Versammlung sprechen hören. Er sprach gut Deutsch.12
* Tatsächlich wohnte Lenin im Haus Nr. 14. In einem Brief (Brief Nr. 257, Werke Bd. 37) gibt Lenin als Adresse zwar die Spiegelgasse 12 an, doch sehr bald korrigiert er sich: Spiegelgasse 14II (Briefe Nr. 259, 260, 261), später kurz und bündig: Spiegelgasse 14 (Briefe Nr. 262, 263 in Bd. 37). In seinem Lenin als Emigrant in der Schweiz, Tafel XXVIII, zeigt auch Willi Gautschi die Fassade des Hauses «Spiegelgasse 14». Jedenfalls können Neugierige diese Tatsache heute noch verifizieren anhand der Schrifttafel, die die Zürcher Behörden unter dem Fenster des von Lenin und Krupskaja bewohnten Zimmers angebracht haben.
Gewiss, Hans Richter gelangte wahrscheinlich frühestens Ende Juni 1916 in die Schweiz und kam nach eigener Aussage13 erst am 15. September 1916 in Kontakt mit dem, was sich bereits «Dada» nannte. Halten wir aber noch einmal fest, dass Richter in diesem Augenzeugenbericht zugibt, Lenin gekannt und gehört zu haben, und sei es nur von weitem.
Richard Huelsenbeck, der am 26. Februar zum Cabaret Voltaire stösst,* gibt uns 1972 eine kostbare Information, wenn auch in zweifelhafter Form:
* Dies bestätigen sowohl Hugo Ball bereits am 15. Mai 1916 im Vorwort zur Sammlung Cabaret Voltaire (faksimiliert in: Hans Richter, Dada – Kunst und Anti-Kunst, a. a. O., S. 13) als auch Tristan Tzara in seiner «Chronique zurichoise 1915–1919» im Dada Almanach (a. a. O., S. 11). Es wurden jedoch noch zwei weitere Ankunftsdaten vorgeschlagen. Nämlich der 11. Februar 1916, ebenfalls von Ball, aber diesmal in seinem Tagebuch Die Flucht aus der Zeit (a. a. O., S. 72), das erst elf Jahre später publiziert wurde («Huelsenbeck ist angekommen. Er plädiert dafür, dass man den Rhythmus verstärkt …»). Unter «Huelsenbeck» taucht im «Personenregister» am Ende des Bandes Briefe (1911–1927) von Hugo Ball sogar das Datum des 8. Februar auf; möglicherweise verdanken wir dies Annemarie Schütt-Hennings (Einsiedeln, Zürich, Köln, Benziger Verlag, 1957, S. 310): «Kam auf Aufforderung von Hugo Ball am 8. Februar 1916 nach Zürich, kurz nach der Gründung des ‹Cabaret’s [sic] Voltaire› …»
Von Lenin hörten wir sehr wenig – sie sagten, er sei einmal ins Cabaret gekommen –, ich sah ihn nie. Ich weiss nicht einmal, wie er aussieht.14
Diese Information wird vom Kunstkritiker Hans J. Kleinschmidt bestätigt. In seinem Vorwort zu Huelsenbecks Memoirs of a Dada Drummer entschlüpft ihm jedoch noch eine andere Information, deren Bedeutung uns schon bald im umfassenden Sinn klar werden wird:
Arp, Ball und Huelsenbeck sind Lenin nie begegnet, wohingegen Tzara später gegenüber Freunden in Paris erzählte, er habe mit ihm «Ideen ausgetauscht» …15
Der Schweizer Historiker Sergius Golowin unterstreicht 1966 also durchaus zu Recht die Tatsache, dass sich «zumindest rein geografisch» der Dadaismus und der Bolschewismus «berührten».16 Aber es kommt noch besser. Es gibt ein anderes Zeugnis, wie jenes von Richter aus erster Hand, doch darüber hinaus von jemandem, der vor Richter, ja selbst noch vor Huelsenbeck, nämlich seit dem 5. Februar 1916, dem Tag der Eröffnung, im Cabaret Voltaire anwesend war: Es ist jenes des rumänischen Malers Marcel Janco. Wir wundern uns nur, dass es unbemerkt geblieben sein soll, verloren in einem 1957 publizierten Gemeinschaftswerk, und dass noch niemand die ausserordentliche Information, die es in seinem zehnten Paragrafen birgt, enthüllt hat:
[Das Cabaret Voltaire] war der Treffpunkt der Künste. Hier trafen sich Maler, Studenten, Revolutionäre, Touristen, internationale Betrüger, Psychiater, die Halbwelt, Bildhauer und nette Spione auf der Suche nach Informationen. Im dichten Rauch, inmitten von Rezitationen oder Volksliedern erschien plötzlich das eindrucksvolle mongolische Gesicht Lenins, umgeben von seiner Gruppe, oder Laban, der grosse Tänzer mit dem assyrischen Bart.17
Lenin, und umgeben von einer Gruppe! Welch wundervolle Offenbarung mit unabsehbaren Folgen! Also begnügt sich der zukünftige Führer der sowjetischen Revolution nicht damit, Nachbar des Cabaret Voltaire zu sein, er betritt es! Auch gibt er sich nicht damit zufrieden, zu Hause die undeutlichen Geräusche der DadaSoireen zu hören: Es zieht ihn hinein! Mehr noch – und es sei uns die starke Wirkung einer solchen Feststellung verziehen –, er macht mit! Dies wenigstens ist die Schlussfolgerung, die, wie auch wir, alle Gutgläubigen zwingend ziehen müssen, sofern sie bereit sind, das Bündel Tatsachen, das wir im Folgenden zur Sprache bringen werden, mit Geduld und Sachlichkeit zu prüfen.