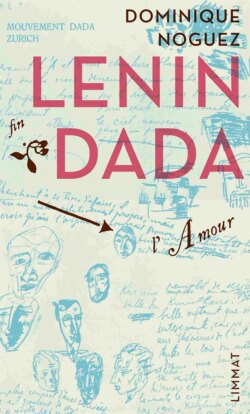Читать книгу Lenin dada - Dominique Noguez - Страница 9
IV Begegnungen und Rätsel
ОглавлениеZwei Fragen sind noch unbeantwortet: Wie sind sich Lenin und die künftigen Dadaisten begegnet? Und warum diese Beharrlichkeit, mit welcher von beiden Seiten eine solche Zusammenkunft verborgen, ja gar bestritten wird?
Auf die erste Frage können wir nur mit Hypothesen antworten. Am plausibelsten ist die einer Begegnung zwischen Ball und Lenin, entweder in Zürich, wo Lenin schon lange vor dem Februar 1916 an Konferenzen teilgenommen hat (beispielsweise Ende Oktober 191562), oder in Bern, wo sich auch Ball eine Zeit lang aufhielt, bevor er nach Zürich kam, um sein Cabaret aus der Taufe zu heben. Denn Ball interessierte sich seit jeher für die russischen Revolutionäre. Huelsenbeck bezeugt es:
Er interessierte sich für Bakunin, und er ging zu einer anarchistischen Gruppe in Zürich – auch ich ging dorthin, obwohl ich regelmässig fast einschlief vor Langeweile –, Ball war daran sehr interessiert.63
Gewiss, von Bakunin zu Lenin ist ein langer Weg, aber für einen Internationalisten wie Ball, zugleich skeptisch64 und ökumenisch,* ist jede Stimme gut genug, gehört zu werden, sind alle Begegnungen wünschenswert. Zweite Hypothese: Die beiden Männer sind sich ganz einfach am Eröffnungsabend, dem 5. Februar 1916, begegnet. Schliesslich erschien ja in der Lokalpresse am 2. Februar ein Communiqué, das die Gründung eines Cabarets ankündet, wo «bei den täglichen Zusammenkünften musikalische und rezitatorische Vorträge stattfinden», und das «die junge Künstlerschaft Zürichs» einlädt, «sich ohne Rücksicht auf eine besondere Richtung» einzufinden. Lenin könnte sehr wohl diese rätselhafte Persönlichkeit sein, die jener «orientalisch» anmutenden Delegation angehörte, die sich, so Ball in seinem Tagebuch, an jenem Abend beim Organisator vorstellte:
* Erwähnen wir jetzt schon die Worte des Aufrufes vom 2. Februar (siehe weiter unten): «… es ergeht an die jüngere Künstlerschaft Zürichs die Einladung, sich ohne Rücksicht auf eine besondere Richtung mit Vorschlägen und Beiträgen einzufinden» (Hervorhebung des Autors) (Zit. nach Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit, a. a. O., S. 71 ; siehe auch Hans Richter, Dada – Kunst und Anti-Kunst, a. a. O., S. 14).
5.11. (…) Gegen sechs Uhr abends (…) erschien eine orientalisch aussehende Deputation von vier Männlein, Mappen und Bilder unter dem Arm; vielmals diskret sich verbeugend. Es stellten sich vor: Marcel Janco, der Maler, Tristan Tzara, Georges Janco und ein vierter Herr, dessen Name mir entging.65
Orientalische Gesichtszüge, kleine Statur:* passt alles zusammen. Diese Hypothese erklärt gewiss nicht, wie Lenin vorher mit den Brüdern Janco und Tzara (oder sie mit ihm) in Kontakt gekommen war, aber sich dies zu erklären, braucht wenig Vorstellungskraft: Alle waren sie im Exil, Slawen, die aus benachbarten Ländern stammen, und alle waren sie am gesellschaftlichen Umsturz interessiert; alles Gründe, die eine Begegnung begünstigen. Ein Ort wie das Café Terrasse in Zürich, wo auch Richter ausgerechnet die drei Rumänen kennenlernte,66 ist im Übrigen einer solchen Begegnung noch förderlich, zumal auch Lenin gern dorthin zum Schachspiel ging.67
* Darüber eine einzige Zeugenaussage – von grosser Statur sozusagen: jene von Joseph Stalin, als er über seine erste Begegnung mit «dem Adler unserer Partei» berichtet, die er im Dezember 1905 anlässlich der Konferenz der Bolschewiki im finnischen Tammerfors hatte. «Ich sah», sagt er, «einen gewöhnlichen Mann von unterdurchschnittlicher Grösse …» (Lénine tel qu’il fut, mit Beiträgen von J. Stalin, W. Molotow, K. Worochilow u. a. Paris, Bureau d’éditions, 1934, S. 21. Hervorhebung des Autors).
Ball ist darüber von Anfang an auf dem Laufenden. Warum aber – und dies ist unsere zweite Frage –, warum aber hat er bis Juni 1917 gewartet, um die Anwesenheit Lenins überhaupt zu erwähnen, und noch dazu, wie wir gesehen haben, in einer so ungenauen Art und Weise?* Wir wären versucht zu antworten: Eben genau weil Lenin zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Zürich ist, sondern unter den bekannt abenteuerlichen Umständen nach Russland zurückgekehrt und deshalb keiner Gefahr mehr ausgesetzt war. Denn für einen politischen Flüchtling wie ihn war es nicht ungefährlich, sich im Cabaret Voltaire öffentlich sehen zu lassen. Alle Zeitzeugen haben die Ironie jener Situation hervorgehoben, in welcher die dadaistischen Spassvögel von der Polizei bespitzelt oder sogar belästigt wurden, während sie jene, die im Begriffe waren, eine der grössten Revolutionen der Geschichte vorzubereiten, glänzend ignorierte.68 Weder Lenin noch die paar Dadaisten, die seine wahre Identität kannten, hatten ein Interesse, daran etwas zu ändern.
* Siehe oben. Das heisst, dass Ball zu durchsichtigen Anspielungen durchaus fähig ist. Siehe unten, Kap. IX, Anm. I.
Doch als Lenin im April 1917 in seine Heimat zurückgekehrt war, hätte die Dadaisten nichts mehr gehindert, zu reden und den wichtigen Anteil, den Lenin in den Anfängen ihrer Bewegung leistete, hervorzuheben. Erstaunlich also ist, wie wir gesehen haben, ihr Schweigen, oder mindestens die Ungenauigkeit ihrer Zeugenaussage. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Merkwürdigkeit ist nicht unbedingt in einer zähen Komplizenschaft mit dem bolschewistischen Führer zu finden, so als ob sein dadaistisches Abenteuer ein schwerer Fehler gewesen wäre, das der Welt für immer hätte verschwiegen werden sollen. Die einleuchtendste Erklärung ist so viel naheliegender: Die meisten Dadaisten haben gar nicht gewusst, dass Lenin in Zürich einer der ihren war. Das war besser so. Denn es existierte nicht nur die äussere Bedrohung durch die Schweizer Polizei: Im Innern selbst des Cabaret Voltaire wimmelte es nur so von seltsamen Typen. Wiederholen wir, welche hauptsächlich vertretenen Gattungen Marcel Janco in seinen Erinnerungen aufzählt:
… Maler, Studenten, Revolutionäre, Touristen, internationale Betrüger, Psychiater, die Halbwelt, Bildhauer und nette Spione auf der Suche nach Informationen.69
Valeriu Marcu bestätigt die Bedeutung dieses letztgenannten Gelichters in Zürich, was in einem neutralen Land zur Zeit des Weltkrieges unschwer erklärt werden kann:
Jede Strassenecke hatte Ohren, Hände schrieben verstohlen in Notizbücher, jeder Laut aus der Fremde wurde aufgenommen und weitergegeben. Das neutrale Land war das einzige Fenster ins feindliche Gebiet. Kein Quadratmillimeter der Öffnung blieb unbesetzt.70
Marcu, wir haben es bereits weiter oben erwähnt, lebte zu dieser Zeit in Zürich und weiss, wovon er spricht; punkto «russischer Emigration» fügt er noch das folgende interessante Detail an: «Alle Fraktionen verfluchten sich in gewohnter Frische …»71
Unter diesen Umständen verstehen wir, dass Lenin keinerlei Wert darauf legte, die Aufmerksamkeit der einen oder anderen dieser liebenswürdigen Bruderschaften oder Klüngel auf sich zu ziehen, ganz zu schweigen von einigen menschewistischen «Genossen» oder Gegnern der Zimmerwalder Konferenz (1915), deren kleinbürgerliche Ansichten er damals gegeisselt hatte und die nun ihrerseits mit Genuss seine nachtschwärmerisch-artistischen Eskapaden dazu verwenden würden, ihm das Kompliment zu erwidern. Ganz abgesehen von einzelnen aufdringlichen Besuchen aus seinem eigenen politischen Lager, wie etwa dieser «Neffe der Genossin Semljatschka», der – wie Krupskaja zu berichten weiss – «so schmutzig und abgerissen» war, «dass die Schweizer Bibliotheken ihm schliesslich den Eintritt verwehrten». Mit seinen regelmässigen Besuchen fiel er Lenin stark auf die Nerven, insbesondere da er «prinzipielle Fragen» mit ihm erörtern wollte.72 Lenin musste also Vorsichtsmassnahmen ergreifen. So wie der Vizekönig in Offenbachs Périchole genoss er die Vorteile seines Inkognitos. Wer die Biografie Lenins auch nur etwas kennt, weiss im Übrigen, dass er nicht abgeneigt war, sich zu verkleiden. «1905 bis 1907 hat er die russische Grenze nur verkleidet passiert», erzählt Ivan V. Pouzyna, indem er sich zum Beispiel als Typograf namens Erwin Weikow ausgewiesen habe und eines Tages sogar «als kirchlicher Vorsänger verkleidet» in Moskau angekommen sei.73 Eine Fotografie in der von der sowjetischen Kommunistischen Partei herausgegebenen Biografie zeigt ihn uns im August 1917 rasiert, geschminkt und mit Perücke (Abb. 3 und 4); wir wissen, dass er sich allein in diesem Monat nacheinander als Arbeiter der Waffenfabrik von Sestrorezk, als Schnitter am Ufer des Rasliw-Sees und als Lokomotivführer zwischen Udelnaja und Finnland ausgegeben hat.74
Abb. 3: Lenin, geschminkt und mit Perücke, August 1917 (Foto: D. Leschtschenko).
Abb. 4: Die Perücke von Lenin (Foto: Roger–Viollet, Paris).
Eine letzte, an sich unwichtige Frage: War Krupskaja auf dem Laufenden oder nicht? Lenin und sie hatten wohl ein Eheleben und teilten nachts das gleiche kleine Zimmer, tagsüber waren sie selten beisammen: Lenin war meist in der Bibliothek,* Krupskaja als Sekretärin im Büro der russischen Emigrantenkasse tätig. Dieses Büro unter der Leitung von Felix Jakowlewitsch machte es sich in Zürich zur Aufgabe, die kranken «Genossen» und Arbeitslosen zu unterstützen.75 Die Kasse des Büros war damals «ziemlich leer», aber an Projekten mangelte es, wie sie selbst sagt, nicht: Ihre Tage waren derart ausgefüllt, dass sie kaum in der Lage war, genau zu wissen, was Wladimir Iljitsch mit den seinen tat. Ein lesenswerter Abschnitt in Das ist Lenin scheint dennoch darauf hinzuweisen, dass sie mehr darüber wusste, als sie gerade zugeben wollte:
* «Er bemühte sich, die Zeit voll auszunutzen, in der die Bibliothek geöffnet war. Morgens ging er Punkt neun Uhr in die Bibliothek und sass bis zwölf Uhr mittags dort (von zwölf bis ein Uhr war die Bibliothek geschlossen); dann ging er nach Hause, wo er genau zehn Minuten nach zwölf Uhr eintraf; nach dem Mittagessen ging er sofort wieder in die Bibliothek und blieb bis sechs Uhr abends, bis sie geschlossen wurde, dort. Zu Hause war es damals nicht sehr günstig zu arbeiten» (Nadeschda Krupskaja, Erinnerungen an Lenin, a. a. O., S. 375).
Er nahm das Leben in all seiner Kompliziertheit und Vielseitigkeit in sich auf. Bei Asketen aber kommt das ja wohl kaum vor.
Am allerwenigsten war Iljitsch – mit seinem Verständnis für das Leben und die Menschen, mit seiner so leidenschaftlichen Einstellung zu allem – jener tugendhafte Spiessbürger, als der er jetzt zuweilen dargestellt wird: ein mustergültiger Hausvater mit seiner Gattin, mit Kindern; Bilder der Angehörigen stehen auf dem Tisch, da ist ein Buch, ein wattegefütterter Hausrock, ein schnurrender Kater sitzt auf seinen Knien (…). Es wäre besser, weniger solche Sachen zu schreiben.76
Interessanterweise zitieren im Oktober 1930 die jungen Redakteure der zweiten Ausgabe von Surréalisme au service de la Révolution das Wichtigste dieser Passage, so als ob sie – scharfsinniger als die Zürcher Dadaisten – erraten hätten, wie nahe der wirkliche Lenin einigen der ersten Avantgarden Europas stand.77
Fügen wir dem noch eine eingeschobene Bemerkung derselben Krupskaja an:
Zwar war unser Zimmer hell, aber seine Fenster gingen auf den Hof hinaus, in dem es fürchterlich roch, weil sich dort eine Wurstfabrik befand. Nur spät nachts konnten wir die Fenster öffnen.78
Natürlich bedeutet dies nichts, aber es klingt in diesem Nichts doch die Möglichkeit an – was sage ich? –, die Glaubwürdigkeit, ja die Wahrscheinlichkeit von abendlichen Besuchen im benachbarten Cabaret Voltaire, und wäre es nur anlässlich der berühmtesten Soireen (am 3. Juni etwa oder am 23. Juni 1916), als es während der heissen Sommernächte in der ärmlichen Wohnung an der Spiegelgasse 14 schwierig wird, ein Auge zu schliessen, gequält von den Dämpfen der Wursterei.