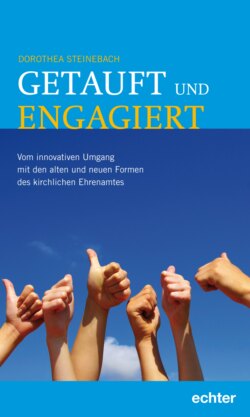Читать книгу Getauft und engagiert - Dorothea Steinebach - Страница 10
2. Alte und neue Formen des kirchlichen Ehrenamtes
ОглавлениеIm Grundmuster der »Hauptberuflichenkirche« ist das Gewinnen ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein zentraler Auftrag aller Hauptberuflichen – nachgeordnet aber auch all derer, die ehrenamtlich Verantwortung tragen. Diesen Auftrag zu erfüllen war in den ersten Jahrzehnten des Berufs der Seelsorgehelferinnen bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil recht unproblematisch. Der Aufbruch mit der Würzburger Synode in den Jahren 1971 bis 1975 bescherte den Pfarrgemeinden die Beteiligung einer großen Zahl von Gläubigen: Wer mitmacht, erlebt Gemeinde! – so hieß ein verbreiteter Slogan.
Als »Multiplikatorinnen« und »Multiplikatoren« ließen sich Ehrenamtliche vom pastoralen Personal für das Mitmachen schulen und bei der Erfüllung übernommener Aufgaben unterstützen und begleiten. Es waren Gemeindemitglieder eines bestimmten Zuschnitts: unermüdliche, pflichtbewusste, kirchen- und pfarrertreue, für den Verwaltungsbereich zumeist männliche, für die pastoralen Anliegen vor allem weibliche Mitglieder einer Pfarrgemeinde. Sie ließen sich gut und gerne und oft über Jahre hinweg einbinden in ein Ehrenamt oder mehrere Ehrenämter. Manche fanden sich in der Vorbereitung der Kinder auf die Erstkommunion ebenso wieder wie als Vorsitzende der Frauengemeinschaft und als Mitglied der Caritaskonferenz. Ganz zu schweigen von den vielen stillen Diensten »hinter den Kulissen«, dem Zubereiten von Kaffee und Kuchen für die Teilnehmer von Tagungen, der Sorge um den Blumenschmuck für die kirchlichen Feste und Feiern und vieles andere mehr.
Und heute? Dazu ein Beispiel aus der Vorbereitung auf die Erstkommunion.
Der Pfarrer hat der Gemeindereferentin diesen »pastoralen Klassiker« übertragen. Sie beginnt, zusammen mit einigen Müttern ein Konzept zu entwickeln, und legt es dem Pfarrer zur Entscheidung vor. Er ist einverstanden – aber: Er wünscht noch, dass den Kindern das Beten des Rosenkranzes beigebracht wird und dass die Kinder das Beten des Rosenkranzes auch regelmäßig einüben. Damit hatte sie nicht gerechnet. Im dörflichen Umfeld und zudem noch in der Nähe der kleinen Wallfahrtskirche hätte sie es sich denken können. Der Rosenkranz hat Tradition. Aber jetzt? Das sprengt ihr Zeitbudget. Wen kann sie jetzt darum bitten? Sie denkt an Frau Maier, die treue Seele, die – solange man im Dorf zurückdenken kann – die Maiandachten vorbereitet und leitet. Und tatsächlich: Frau Maier macht das; sie übernimmt den Rosenkranz mit den Kindern gern. Die Kinder und dieses Gebet liegen ihr am Herzen.
Solche Ehrenamtliche entlasten. Auch heute. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zu ihrer Verlässlichkeit und Treue kommt in der Regel noch die eigene Verwurzelung im christlichen Glauben. Spürbar ist ihre begeisterte Bereitschaft, »jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt« (vgl. 1 Petr 3,15). Dieses Ehrenamt ist und bleibt von unschätzbarem Wert! Es lässt sich etwas sagen und springt ganz einfach ein in Aufgaben, die dem Pfarrer wichtig sind. Seine Autorität gilt ihnen etwas.
Mit ihnen, den heute als Vertreterinnen des »alten« Ehrenamtes bezeichneten Christinnen und Christen, gelang und gelingt das an den Pfarrer in seiner Gesamtverantwortung rückgebundene Mitmachen mit den Hauptberuflichen über viele Jahrzehnte weitgehend gut. Wenn es natürlich auch hier »menschelt« wie in jeder Zusammenarbeit. Die Erfahrungen berichten von Bereicherung und Konkurrenz, von Entlastung und Belastung, von selbstverständlichem Miteinander und mühsamem Konfliktmanagement mit Engagierten. Das Einbindungsprinzip aber ist eindeutig und funktioniert(e): in Abhängigkeit vom Pfarrer und von seiner Kunst, die Menschen für sich und seine Gemeinde zu gewinnen und zum Mitmachen zu begeistern. Gestützt durch das volkskirchliche Milieu in einer volkskirchlichen Kultur und motiviert durch den Aufbruch des Konzils: gemeinsam als pilgerndes Volk Gottes unterwegs zu sein.
Bei aller Freude, dass es noch Restbestände dieses tatkräftigen, selbstverständlichen »alten« Ehrenamtes gibt, kann sein Wegbrechen in vielen Gemeinden nicht übersehen werden. Immer mehr Menschen denken und fühlen anders, orientieren ihr Leben und ihre Sinnfragen anders, folgen anderen Werten als den kirchlichen und sehen im Pfarrer keine Autoritätsperson mehr, die sie akzeptieren.
So wie eine junge Mutter, die völlig irritiert reagierte: »Rosenkranz? Ich glaube, den hat meine Oma abends gebetet, als ich noch klein war. Nein, damit kann ich nichts anfangen. Wozu soll mein Kind das lernen? Nur, weil der Pfarrer das sagt? Das ist doch kein Grund.« Inhalte, die es nur gibt, weil sie der Pfarrer wünscht und weil »man sie immer so gemacht hat«, stehen unter Verdacht. Seine Amtsautorität beeindruckt viele nicht mehr. Was angeboten wird, muss erkennbar etwas mit dem eigenen Leben zu tun haben und mit dem Leben der Kinder. Professionalität, kompetentes Erklären des Sinns und der Bedeutung von Gebeten und Brauchtum – das ist es, was nottut. Das könnte dann vielleicht sogar neugierig machen auf »den Rosenkranz der Oma«.
Wie diese junge Mutter lassen sich viele Menschen von niemandem mehr – ob beruflich oder ehrenamtlich agierend – einbinden in ein System, dessen Sprache, Werte und Lebensmodelle sie nicht mehr verstehen, dessen Ambiente ihnen nicht zusagt und in dessen Aufgaben sie keinen Sinn mehr sehen. Vielfach wird statistisch belegt, dass es immer weniger Katholikinnen und Katholiken gibt, die sich in den traditionsreichen Bahnen des gemeindepastoralen Alltags langfristig zu engagieren bereit sind, auch nicht im so genannten pastoralen »Kerngeschäft«. Sie tauchen hier kaum noch auf.
Nicht wenige, die ein Engagement suchen, wandern ab aus dem kirchlichen Binnenraum in andere gesellschaftliche Engagementbereiche. Oder sie sind von vorneherein nur dort zu finden. Denn was sich unter diesen Menschen abzeichnet, ist ein anderer Typ von Ehrenamt: das so genannte »neue« Ehrenamt. Es taucht auf im bürgerschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen Raum – in der ganzen Bandbreite der Selbsthilfe- und Betroffenengruppen, der Bürgerinitiativen, Kooperationsringe und Tauschbörsen. Es geht zurück auf die Auseinandersetzungen in den sozialen Bewegungen und der Kulturrevolution der 1960er Jahre. Im Allgemeinen wird das »neue Ehrenamt« dadurch charakterisiert, dass es ein selbstorganisiertes, in hohem Maß flexibles, biographisch passgenaues, persönlich sinn- und gewinnbringendes, zeitlich und thematisch fest umgrenztes Engagement wählt. Es liegt ihm ein Interesse an der Bewältigung eigener Problemsituationen und oft auch politischer Veränderungswille zugrunde – in Projekten mit großen Gestaltungsspielräumen.
Während diese neuen Formen von Ehrenamtlichkeit an vielen gesellschaftlichen Orten an Bedeutung gewinnen, ist die Bereitschaft bundesdeutscher Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit in den etablierten Institutionen wie den großen Kirchen rückläufig. Das liegt aber nicht etwa nur einseitig an diesen Menschen und ihrer Abneigung gegenüber solcher Mitarbeit. Auch umgekehrt gibt es Ressentiments in den kirchlichen Kreisen diesen neuen Formen gegenüber. Das gilt nicht nur für viele Hauptberufliche, sondern auch für die weniger werdenden alteingesessenen Ehrenamtlichen, die Vertreter des »alten« Ehrenamtes, die um »ihre Pfründe« fürchten. Sie erleben die Vorlieben »der Neuen« nicht nur als »ungewohnt«. Manche lassen sie auch spüren, wie »fehl am Platz« sie sie finden. Weil sie sich in »ihren« gemeindepastoralen Alltag eben nicht integrieren lassen. Weil sie Anderes, Fremdes, Neues einbringen oder entstehen lassen würden. Neben dem Bestehenden. So scheinen die Kirchengemeinden weitgehend die Festungen des »alten« Ehrenamtes zu bleiben. Eines Ehrenamtes, das in den Strukturen des volkskirchlichen Milieus groß geworden ist und sich in großem Beharrungsvermögen schwer damit tut, das Abbröckeln seiner Resonanz überhaupt in den Blick zu bekommen: weder im Kirchenvolk aller Getauften und erst recht nicht im gesellschaftlichen Raum unter den Menschen von heute.