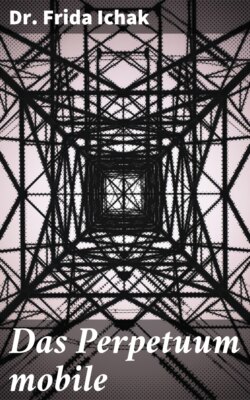Читать книгу Das Perpetuum mobile - Dr. Frida Ichak - Страница 11
Abb. 6.
ОглавлениеAuch diese Perpetuum-mobile-Idee erfuhr eine zeitgenössische Kritik, ähnlich wie das Rad mit den Gewichten von Bischof Wilkins. Jakob Leupold, ein Mechaniker aus dem Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, dessen Luftpumpe, die er für Christian Wolf angefertigt hat, bis jetzt noch eine Sehenswürdigkeit bietet, zeigt die Unhaltbarkeit der Idee auf Grund einer Berechnung. Eine Trommel (Abb. 6) möge durch Bretter in 12 Kammern eingeteilt sein. In jeder Kammer befindet sich eine schwere Kugel. Leupold fällt von jedem Gewichte ein Lot auf die Vertikalachse der Trommel. Addiert man alle diese Lote, in einem beliebigen Maß gemessen, bei a — 44, b — 47, c — 37, d — 18, so ergibt das die Summe 146; und ebenso ist die Summe der Lote auf der linken Seite e — 7, f — 15, g — 35, h — 23, i — 27, k — 24, l — 15 und n — 0 gleich 146! Leupold betrachtet die Lote als Maß für die Kräfte und meint, das Rad müsse im Gleichgewicht verharren, weil die Kräfte auf beiden Seiten gleich seien. Nach unserer Auffassung tritt Gleichgewicht ein, wenn die Momente (Produkt aus Gewicht und Arm) auf beiden Seiten gleich sind. Das Resultat stimmt bei Leupold (ähnlich wie Wilkins, siehe Seite 15) zufällig, denn er setzt voraus, daß alle Gewichte einander gleich sind, so daß an Stelle der Summe der Momente die Summe der Arme gesetzt werden kann.
Das mechanische Perpetuum mobile, wie wir es bis jetzt geschildert haben, geht von einer falschen Auffassung der Gravitation aus. Man sah in der Gravitation, infolge deren die Körper zueinander gezogen werden, eine unerschöpfliche Quelle von Arbeitsfähigkeit. Diese Auf fassung der Gravitation geht besonders deutlich aus dem sogenannten Scheinerschen Gnomon hervor, einer erdachten Konstruktion, die im 17. Jahrhundert und auch später noch eine viel umstrittene Frage der Physik bildete.
Christoph Scheiner, Jesuit und Astronom (1575-1650), ist in der Geschichte der Wissenschaft als der Entdecker der Sonnenflecken bekannt. Bei seiner Beschäftigung mit kosmischen Problemen war er auch der Frage der Gravitation nahegekommen. Der Gnomon Scheinerianus in centro mundi besteht in folgendem.
Man denke sich durch den Mittelpunkt A des Weltalls (Abb. 7), also durch den Mittelpunkt der Gravitation, eine Achse. An diese Achse sei ein Gnomon BC befestigt, dessen äußeres Ende C ein Gewicht trägt. Wiegt das Gewicht über, meint Scheiner, so müßte der Gnomon sich um das Zentrum des Weltalls bewegen und zwar perpetuierlich. Das Ende C kommt infolge des Gewichts nach D, dann der Reihenfolge nach nach E, F, G und wieder nach C; es kann nirgends stehen bleiben, weil nirgends dafür ein Grund vorhanden ist; alle diese Punkte sind vom Gravitationszentrum gleich weit entfernt. Nur wenn man dem Gnomon noch einen Arm BG = BC hinzufügt, gerät er in Ruhe; wird aber dieser Gegenarm weggenommen, so beginnt der Gnomon sich zu drehen und bleibt nirgends stehen.