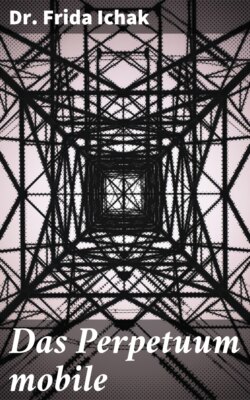Читать книгу Das Perpetuum mobile - Dr. Frida Ichak - Страница 6
3. Ursprung der Idee.
ОглавлениеDa die Idee des Perpetuum mobile etwas durchaus Ungewöhnliches darstellt, so ist man zunächst bewogen zu fragen, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist. Seit wann datiert dieser Gedanke, durch welche wissenschaftlichen oder praktischen Momente wurde er in die Welt gerufen, welcher Notwendigkeit entsprang er?
Schon die lateinische Bezeichnung des Begriffes zeigt, daß der Gedanke alt sein muß und daß er zumindest schon bekannt war zu der Zeit, da die Gelehrtensprache Latein war. Rosenberger verlegt in seiner „Geschichte der Physik“ den Ursprung der Perpetuum-mobile-Idee in jene Zeit, als man eine besondere Vorliebe für Automaten und mechanische Spiele hatte, also etwa in die Zeit zwischen 1690-1750. Dieser Annahme widerspricht aber die einfache Tatsache, daß schon lange vor dieser Zeit Perpetuum-mobile-Projekte existierten. Geht man in der Literatur immer mehr zurück, so findet man schon im 13. Jahrhundert einen Plan zur Herstellung einer fortdauernd sich bewegenden Vorrichtung, und interessant ist, daß der Autor dieses Planes, Vilard de Honnecourt, selbst schon davon spricht, daß man „seit einiger Zeit“ beschäftigt sei, eine solche Vorrichtung zu konstruieren.
In der ältesten Literatur wird vom Perpetuum mobile oft gesprochen, als „von dem großen Geheimnis, an dessen Enthüllung Führer der Philosophie wie Demokritos, Pythagoras und Plato gearbeitet haben, ebenso wie die Gymnosophisten und die indischen Priester“. Aber wie es in der Geschichte jedes Gedankens der Fall ist und in der Geschichte eines so unproduktiven Gedankens wie der des Perpetuum mobile der Fall sein muß, werden oft Ansichten übernommen und weiter verbreitet, die zumindest zweifelhaft sind. So steht es auch mit diesem Zitat. Wir finden es zuerst bei Bischof Wilkins, einem Autor des 17. Jahrhunderts; der Gedanke wird immer weiter übernommen bis in das 19. Jahrhundert. Schließlich gewinnt die Ansicht den Charakter eines Axioms, ohne daß man je ihre Richtigkeit geprüft hat.
In Wirklichkeit kann weder bei Plato noch irgend sonstwo in der klassischen Literatur ein Nachweis dafür gefunden werden, daß die obengenannten Autoren sich mit dem Perpetuum mobile beschäftigt hätten. Bei der großen Rolle, die das Perpetuum mobile im ganzen Mittelalter gespielt hat, ist es nur natürlich, daß die Scholastiker auch in dieser wichtigen Frage das Bedürfnis hatten sich auf die Autorität der Alten zu stützen, und so werden bald Plato, bald Pythagoras angerufen, auch wo man kein Recht dazu hat.
Es fehlt bis jetzt an historischen Daten, die den Zeitpunkt der Entstehung des Perpetuum-mobile-Gedankens angäben. Man hat keine historische Berechtigung, positiv zu behaupten, daß man schon im griechischen Altertum oder gar im alten Indien Versuche zur Verwirklichung dieses Gedankens unternahm. Man kann hier nur Vermutungen aussprechen, Vermutungen, die mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit für sich haben.
Man muß einen Unterschied machen zwischen der Idee der ewigen Bewegung als solcher und den praktischen Versuchen zu ihrer Verwirklichung. Diese letztere Frage ist eine Frage der Technik und physikalischen Anschauungsweise. Der Ursprung des Perpetuum mobile als einer praktischen Angelegenheit muß also zunächst in der Geschichte der Technik gesucht werden.
Die Anfänge der Technik gehen in das hohe Altertum zurück. Es war vor allem das Heben von Lasten (beim Häuserbau und bei der Wasserversorgung), das das Bedürfnis nach der Maschine hervorrief. (Man denke an den Bau der Pyramiden.) Noch in später Zeit, bei Marcus Vitruvius, dem römischen Ingenieur zur Zeit der Geburt Christi wird die Maschine selbst definiert als „hölzerne Vorrichtung, die dazu bestimmt ist, Lasten zu heben“. Mit der Maschine, die Kraft gewinnt auf Kosten der Zeit, scheint ein ungeheurer Arbeitsaufwand gewonnen zu sein. Die Maschine befreit sozusagen den Menschen vom Erbfluch der Arbeit. Je vollkommener die Maschine ist, desto mehr schont sie unsere Kraft und stellt uns die ihrige zur Verfügung. Das Ideal wäre also eine Maschine, die nichts von uns verlangt, keine Kraft zu ihrer Unterhaltung fordert, und immer weiter aus sich heraus Arbeit leistet. In diesem Ideal liegt etwas vom Traum der Menschheit vom goldenen Zeitalter, da man ernten wird ohne zu säen, und der Mensch nicht mehr im Schweiße seines Angesichts Brot essen wird. Es ist also nur zu wahrscheinlich, daß der Wunsch nach einer von selbst arbeitenden Maschine sich im Kopfe des Menschen regte, dem zuerst der Wert und der Nutzen der Maschine überhaupt klar wurde. In diesem Sinne ist die Behauptung bezeichnend, die man schon in der ältesten Literatur findet: „Das Ding, das sich seit Anbeginn der Welt bis auf diesen Tag die großen Philosophen mit andauernden Studien und großer Mühe versucht haben zu bewerkstelligen.“
Ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Perpetuum mobile als technische Aufgabe schon sehr alt, so muß der Gedanke der ewigen Bewegung, als Idee, noch älteren Ursprungs sein. Ihre Wurzel ist nicht allein in den physikalischen Ansichten, sondern in der allgemeinen Kulturgeschichte zu suchen.
Es war das unvergleichliche Verdienst Berthelots zuerst (in den „Ursprüngen der Alchemie“) darauf hingewiesen zu haben, daß der Ursprung und die Langlebigkeit der Alchemie nicht im geringen Maße Momenten religiöser Natur zu verdanken seien. Daß auch bei dem Problem des Perpetuum mobile religiöse und mythologische Momente eine Rolle spielen, unterliegt keinem Zweifel. Man denke daran, welche Rolle in der Symbolik der alten Religionen das Rad spielt, das Rad, in dem die Idee der Bewegung und der in sich wiederkehrenden Wiederholung am besten verkörpert ist. In der Religion der Veda (vgl. Oldenberg), der Urreligion des alten Indiens, ist das Rad das Symbol der Gottheit. Denselben Sinn hat das Rad bei den alten Germanen und den Kelten, viele religiöse Bräuche und Mythen zeugen vom religiösen Ursprung des Symbols des Rades, das sowohl durch seine Form wie seiner Bewegung mit der Sonne am nächsten vergleichbar ist. Durch das Radsymbol erklärt Oldenberg auch die Tatsache, daß an dem Pfahl, an den die Opfertiere angebunden werden, ein Kranz angebracht wurde. Die Wissenschaft, d. h. das kausale Denken, über nimmt in ihren Anfängen unbewußt den religiösen Vorstellungskreis, und Spuren von Ansichten religiöser und okkulter Natur sind hie und da noch zu finden, wenn die Wissenschaft den Stand der Dinge schon weit überholt hat. Nur durch religiöse Einflüsse ist z. B. zu erklären, daß die Theologen des Mittelalters das Perpetuum mobile heiß verfechten, und die Endlichkeit der Bewegung, d. h. die Unmöglichkeit des Perpetuum mobile für unvereinbar mit der göttlichen Wissenschaft halten. Da das Urbild der „ewigen“ Bewegung, die Bewegung der Himmelskörper, einmal in der Natur gegeben war, so erschien es absolut anstrebenswert, eine solche Bewegung auch künstlich hervorzubringen.
In der Mythologie fast aller Völker findet man Berichte von Gegenständen und künstlich erzeugten Vorrichtungen, die ewig währen. Als Gegenstück zum eigentlichen Perpetuum mobile, als Perpetuum mobile besonderer Art ist z. B. die „ewige Lampe“ zu betrachten. Die Legende der ewigen Lampe ist sehr alt. Der heil. Augustinus erwähnt die angebliche ewige Lampe im Tempel der Venus, die von selbst, ohne Ölzufuhr brannte und weder vom Winde noch durch Regen oder Unwetter ausgelöscht werden konnte. Augustinus selbst zweifelt keinen Augenblick an der Möglichkeit solcher Lampen und sieht in ihnen ein Werk des Teufels. Eine Lampe, die anderthalb Jahrtausende gebrannt haben sollte, wollte man 1345 im Grabe der Tullia, der Tochter Ciceros gefunden haben. Es existieren noch zahlreiche andere Erzählungen über solche von selbst brennende Lichtquellen, die, einmal instand gesetzt, unaufhörlich brennen und Licht spenden bis sie zerstört werden.
Die Legende von der ewigen Lampe zeigt, daß der Wunsch der Menschheit nach einer künstlichen Vorrichtung, die ewig funktioniert, uralt ist, vielleicht ebenso alt wie die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Abgesehen von der technischen Seite der Frage, gehört also die Idee der ewigen Bewegung zu den Urfragen der Kultur.