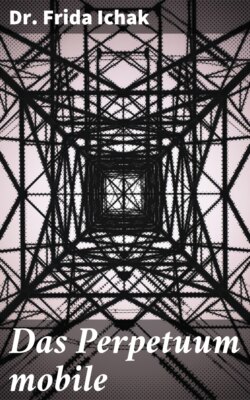Читать книгу Das Perpetuum mobile - Dr. Frida Ichak - Страница 7
Оглавление4. Älteste Dokumente.
Das erste, bis jetzt bekannte authentische Dokument über die Verwirklichung der Perpetuum-mobile-Idee durch äußere Mittel stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sein Autor ist Vilard de Honnecourt, ein gothischer Architekt zur Zeit Ludwigs des Heiligen. Zu den Schöpfungen dieses Architekten gehört unter andern die Karthäuserkirche von Vaucelles bei Honnecourt in Nordfrankreich.
In der Pariser École des Chartes befinden sich die Originale der erhalten gebliebenen Handzeichnungen Honnecourts, wo sich neben Architekturentwürfen und Ornamenten das für uns in Betracht kommende Projekt befindet.
Ein Gerüst (Abb. 1), das aus zwei Balken und einem Querbalken gebildet ist, trägt in seiner Mitte auf einer Achse ein Rad mit 4 Speichen. Auf der Peripherie des Rades hängen 7 Schlegel frei hinunter: 4 davon sind nach der einen, 3 nach der andern Seite gerichtet. Die Zeichnung trägt die Inschrift: „Seit einiger Zeit streiten sich die Meister, wie man ein Rad durch sich selbst sich drehen lassen könnte. Auf folgende Art kann man es durch eine ungerade Anzahl von Schlegeln oder durch Quecksilber erreichen.“
Abb. 1.
Nach dieser Inschrift kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich der Verfasser die Wirkung seiner Vorrichtung gedacht hat. Beim freien Fallen eines Schlegels an der Peripherie wird das Rad mitgerissen und etwas gedreht. Nun sollten die Schlegel einer nach dem andern fallen und das Rad in ununterbrochener Bewegung erhalten.
Das Album des Vilard de Honnecourt ist das einzige Dokument, das von diesem Manne erhalten geblieben ist, und so läßt sich nicht feststellen, ob er selbst der Urheber dieses Projekts war oder den Plan eines andern beschreibt. Vilard de Honnecourt baute Kirchen. Vielleicht gab ihm die Anregung zu dieser Idee die Metalltrommel mit Schlegeln, die in alten Kirchen jetzt noch an Stelle einer Glocke gebraucht wird. Er muß gewiß beobachtet haben, daß die Trommel unter dem Einfluß der Trägheit sich eine Weile noch bewegt, nachdem ihr der letzte Schlag versetzt worden war, und so mag er vielleicht die Idee gefaßt haben, die Trommel könnte sich kontinuierlich bewegen, wenn ihr immer neue Schlegel zu Hilfe kämen.
Man muß annehmen, daß in der auf Vilard de Honnecourt folgenden Zeit die Idee des Perpetuum mobile weiter entwickelt wurde. Zwei Jahrhunderte später finden wir fast dieselbe Form des beschriebenen Perpetuum mobile wieder, und zwar wieder von einem Künstler vertreten. Es ist kein geringerer als Lionardo da Vinci (1452-1519), der sich mit dem Problem des Perpetuum mobile befaßte.
Bekannt ist, daß Lionardo ebenso groß als Techniker und Gelehrter wie als Maler war. Ein tragisches Geschick lastet über dem Lebenswerk Lionardos. Seine Bilder sind zum Teil von der Zeit zerstört, zum Teil verloren gegangen. Ebenso sind seine wissenschaftlichen Werke teils verloren, teils unwirksam geblieben. Aber erwiesen ist, daß viele wichtige wissenschaftliche Ansichten, deren Ursprung man gewöhnlich viel später datiert, bereits Lionardo gehörten. Lionardo hatte, 100 Jahre vor Galilei, richtige Vorstellungen vom freien Fallen der Körper, er kannte die Gesetze der auf den Hebelarm schief wirkenden Kräfte, die Gesetze der Reibung usw. Wie tief Lionardo das Wesen der Mechanik erfaßte, geht aus einer Bemerkung hervor wie: „Die Mechanik ist das Paradies der mathematischen Wissenschaften, denn mit ihr gelangt man zur Frucht des mathematischen Wissens.“
Neben der Mathematik und der reinen Wissenschaft beschäftigten Lionardo Fragen technischer Natur. Zahlreich sind seine Pläne technischer Erfindungen. Von einer Flugmaschine auf Grund des freien Vogelfluges bis auf einen Lampenzylinder gegen das Blaken der Lampe findet man in seinen Skizzen die technischen Projekte der verschiedensten Art. Unter den Originalskizzen Lionardos im Britischen Museum zu London befindet sich ein Blatt, das stark vermuten läßt, daß Lionardo sich mit dem Problem des Perpetuum mobile beschäftigte. Wie man sieht (Abb. 2), erinnern die Zeichnungen sehr an das Perpetuum-mobile-Projekt des Vilard de Honnecourt. Besonders interessant ist Zeichnung 1. Wir sehen darauf ein Rad mit vielen Fächern, die je ein Gewicht führen. Besonders diese Modifikation des Rades, das durch die Schwere angetrieben wird, bildete das Versuchsobjekt der Erfinder der folgenden Jahrhunderte.
Auch an vielen Stellen des Codex Atlanticus, dem Mailänder handschriftlichen Nachlaß Lionardos, findet man Skizzen, die glauben lassen, daß Lionardo die Perpetuum-mobile-Projekte seinerzeit genau bekannt waren. Doch er selbst erkennt mit dem Scharfsinn des Mathematikers und der Überlegenheit des Technikers, daß die Projekte dieser Art unausführbar sind. „O Erforscher der ewigen Bewegung, wie viele eitle Pläne habt ihr bei dergleichen Suchen geschaffen“, bemerkt Lionardo bei Gelegenheit eines Perpetuum-mobile-Projekts. [1]
Abb. 2.
Die Autorität, die Vilard de Honnecourt für die Nachwelt bedeutete, mochte viel dazu beigetragen haben, daß sein Perpetuum-mobile-Projekt gerade unter seinen Fachgenossen, den Architekten sehr bekannt war. Noch am Ende des 17. Jahrhunderts finden wir fast dieselbe Konstruktion wie bei Vilard von einem Architekten beschrieben. Alessandro Capra, Architekt in Cremona, nimmt in einem Werke aus dem Jahre 1683 die Idee des Rades, das durch Gewichte an seiner Peripherie bewegt wird, wieder auf. Aber Capra scheint sich der ganzen Schwierigkeit der Konstruktion bewußt gewesen zu sein. Damit die Schlegel (Abb. 3) von rechts nach links ihre Richtung ändern können, modifiziert Capra die Idee. Auf der Achse C schwebt frei ein gut equilibriertes Rad A. An dessen Peripherie hängen in gleichen Abständen an einer Art von Ösen 18 gleich schwere Gewichte. Unter dem Einfluß der Schwerkraft fallen die Gewichte B hinunter, ziehen das Rad mit und zwingen die Gewichte I ihre Richtung zu ändern. Capra erklärt die Wirkung der Maschine dadurch, daß die Gewichte in Lage B sich weiter vom Zentrum befinden und daher „mehr wiegen“ als die Gewichte I.
Abb. 3.